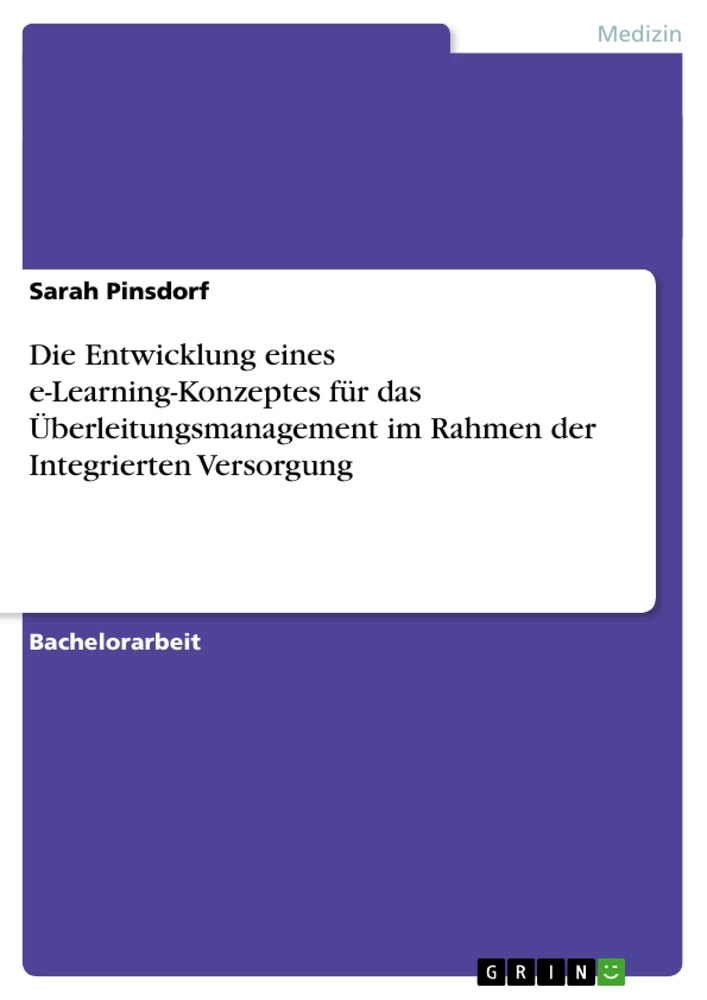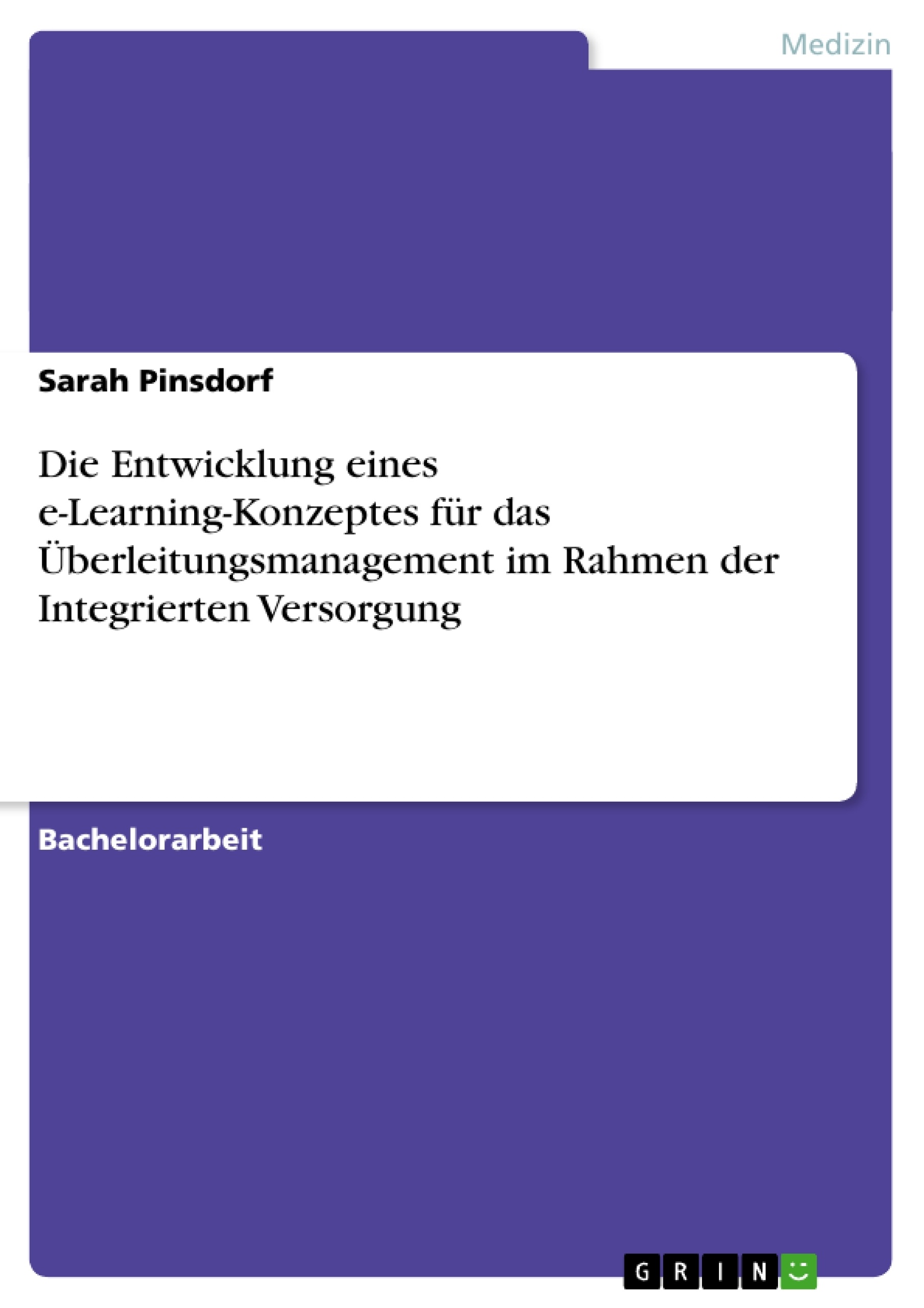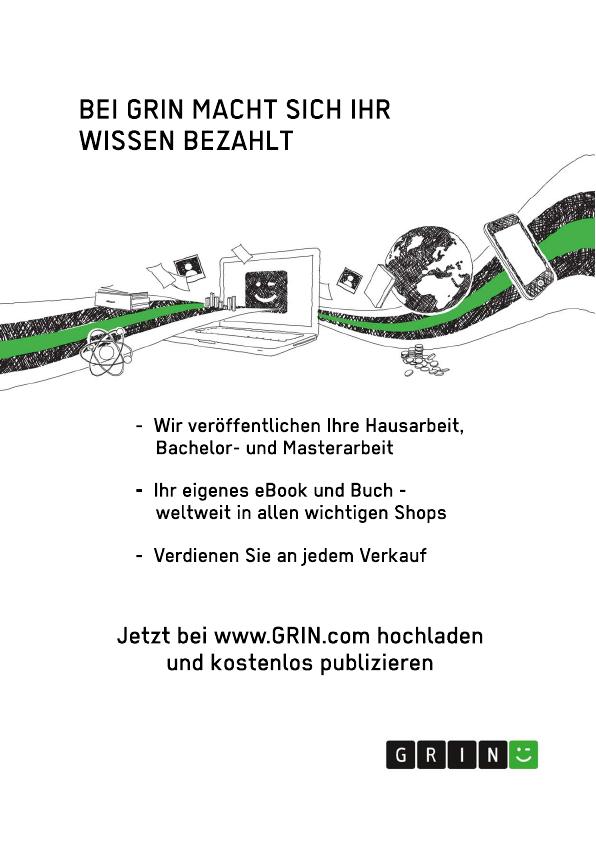Der Anteil an alten, multimorbiden und chronisch-kranken Patienten nimmt in Deutschland
seit mehreren Jahren kontinuierlich zu.1 Viele dieser Patienten sind im Anschluss
an einen stationären Krankenhausaufenthalt temporär oder dauerhaft pflegebedürftig
und benötigen ein gut strukturiertes Überleitungsmanagement seitens des Krankenhauses,
um eine bedarfsgerechte poststationäre Versorgung zu erhalten.2 Die Einleitung
des Überleitungsmanagements beginnt jedoch in vielen Krankenhäusern erst mit
der Entlassung des Patienten. Dies ist jedoch zu spät, um die Kontinuität der Behandlung
und Betreuung des Patienten über das Krankenhaus hinaus gewährleisten zu
können.
Im Rahmen dieser Arbeit wird zunächst relevantes Wissen zu den Themen Überleitungs-
und Entlassungsmanagement gesammelt. Ausführlich wird der Expertenstandard
Entlassungsmanagement beschrieben. Auf Basis dieser Informationen wird
nach einer kurzen Einführung in das Thema e-Learning ein e-Learning-Konzept für das
Überleitungsmanagement entwickelt. Im Rahmen der e-Learning-Einheit soll Pflegefachkräften
in kurzer Zeit und direkt am Arbeitsplatz relevantes Basiswissen zum Thema
Überleitungsmanagement vermittelt werden.
Inhaltsverzeichnis
II Tabellenverzeichnis
III Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Fragestellung und Zielsetzung
1.3 Vorgehen
2. Überleitungsmanagement im Rahmen der Integrierten Versorgung
2.1 Hintergrund
2.2 Definition Überleitungsmanagement
2.3 Ziele des Überleitungsmanagements
2.4 Rahmenbedingungen des Überleitungsmanagements
2.4.1 Integrierte Versorgung
2.4.2 Rechtliche Rahmenbedingungen
2.5 Expertenstandard Entlassungsmanagement in der Pflege
2.5.1. Assessment
2.5.2 Planung
2.5.3 Durchführung
2.5.4 Evaluation
2.6 Kritik
3. E-Learning
3.1 Hintergrund
3.2 Definition und Formen des e-Learning
3.2.1 Computer-Based-Training & Web-Based-Training
3.2.2 Virtual Classroom
3.2.3 Blended Learning
3.3 Potenziale des e-Learning
3.4 Erstellung von e-Learning-Einheiten
3.5 Kritik
4. E-Learning-Konzept für das Überleitungsmanagement
4.1 Zielgruppe
4.2 Lernziele
4.2.1 Theoretische Einführung
4.2.2 Lernziele des e-Learning-Konzeptes Überleitungsmanagement
4.3 Lerninhalte
4.3.1 Der Überleitungsbogen
4.3.2 Poststationäre Versorgungsmöglichkeiten
4.4 Drehbuch e-Learning Überleitungsmanagement
4.4.1 Technische Umsetzung
4.4.2 Inhaltliche Aufbereitung
5. Fazit
6. Ausblick
IV Literaturverzeichnis
II Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Ablauf Entlassungsmanagement
Tabelle 2: BRASS-Index
Tabelle 3: Barthel-Index
Tabelle 4: Aufbau Expertenstandard Entlassungsmanagement
III Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zusammenfassung
Der Anteil an alten, multimorbiden und chronisch-kranken Patienten nimmt in Deutschland seit mehreren Jahren kontinuierlich zu.[1] Viele dieser Patienten sind im Anschluss an einen stationären Krankenhausaufenthalt temporär oder dauerhaft pflegebedürftig und benötigen ein gut strukturiertes Überleitungsmanagement seitens des Krankenhauses, um eine bedarfsgerechte poststationäre Versorgung zu erhalten.[2] Die Einleitung des Überleitungsmanagements beginnt jedoch in vielen Krankenhäusern erst mit der Entlassung des Patienten. Dies ist jedoch zu spät, um die Kontinuität der Behandlung und Betreuung des Patienten über das Krankenhaus hinaus gewährleisten zu können.[3]
Im Rahmen dieser Arbeit wird zunächst relevantes Wissen zu den Themen Über- leitungs- und Entlassungsmanagement gesammelt. Ausführlich wird der Expertenstandard Entlassungsmanagement beschrieben. Auf Basis dieser Informationen wird nach einer kurzen Einführung in das Thema e-Learning ein e-Learning-Konzept für das Überleitungsmanagement entwickelt. Im Rahmen der e-Learning-Einheit soll Pflegefachkräften in kurzer Zeit und direkt am Arbeitsplatz relevantes Basiswissen zum Thema Überleitungsmanagement vermittelt werden
Abstract
The number of old, multimorbid and chronically ill patients in Germany grows continually for several years now.[4] Following the stationary hospitalization, many of these patients are temporarily or permanently in need of care and require a well-structured transition management on the part of the hospital to receive adequate post-hospital care.[5] However, the initiation of the transition management starts in many hospitals not until the patient’s discharge. Obviously, this point in time is too late to ensure continuous treatment and care after the hospitalization.[6]
In the context of this work, first of all relevant knowledge on the topics transition and discharge management is collected. The “Expertenstandard Entlassungsmanagement” is described in detail. Based on this information and following a short introduction to the topic e-Learning, an e-Learning concept for the transition management is developed. The purpose of this e-Learning unit is to impart relevant basic knowledge on the topic transition management to nursing staff in short time and directly at the workplace
1. Einleitung
Das Überleitungsmanagement erlangt im deutschen Gesundheitswesen aus verschiedenen Gründen immer größere Bedeutung. Um den steigenden Anforderungen gerecht werden zu können, müssen mehr Pflegefachkräfte explizit zu diesem Thema geschult werden. Die hohe Arbeitsbelastung der Pflegekräfte erschwert jedoch die Durchführung von Präsenzschulungen. Flexibel durchführbare e-Learning-Einheiten könnten diesen Schulungsbedarf langfristig decken.
1.1 Problemstellung
Aufgrund von Budgetdeckelungen[7], Tarifabschlüssen, steigenden Energiekosten und durch die Einführung des DRG-Systems nimmt der Kostendruck auf Krankenhäuser permanent zu.[8] Dies hat unter anderem für viele Patienten[9] eine Kürzung der Verweildauer zur Folge.[10] Diese Verkürzung des stationären Krankenhausaufenthaltes muss durch vermehrte und intensivere poststationäre Leistungen kompensiert werden.[11] [12] [13] Hinzu kommt, dass es aufgrund des demographischen Wandels immer mehr alte, chronisch kranke und multimorbide Patienten gibt, die nach einem stationären Aufenthalt vorübergehend oder dauerhaft pflegebedürftig sind.12 13 Das Angebot an poststationären Leistungen ist inzwischen so differenziert und komplex, dass viele Patienten mit der Frage nach der optimalen Versorgung nach ihrem Krankenhausaufenthalt überfordert sind und ihre eigene Lage und Bedürfnisse nur schwer einschätzen können.[14] Erschwerend hinzu kommt, dass die Überleitung der Patienten aus einer stationären Behandlung in eine Rehabilitationseinrichtung, eine ambulante Betreuung oder in ein Pflegeheim auch das deutsche Gesundheitswesen vor große Schnittstellenprobleme[15] stellt. Eines dieser Probleme ist, dass die Überleitung meist keinen einheitlichen Regeln folgt und so jedes Krankenhaus individuelle Überleitungsprozesse und -bögen entwickelt.[16] Weiterhin fühlt sich das Krankenhauspersonal oft nicht für Überleitungsprozesse zuständig oder ist überfordert. Ambulant tätige Ärzte und Fachkräfte in Pflegeheimen oder Rehabilitationskliniken können entlassene Patienten aufgrund mangelnder Informationsweitergabe nicht zeitnah und angemessen weiterbehandeln.[17] Diese Versorgungsbrüche können zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Patienten, und im schlimmsten Fall zu einer erneuten Krankenhauseinweisung, dem sogenannten Drehtüreffekt[18], führen.[19] Ein unzureichend organisiertes Überleitungsmanagement belastet folglich nicht nur die Patienten, sondern auch die beteiligten Leistungserbringer.[20]
Erste Schritte zur Verbesserung der Situation wurden im Jahr 2004 durch die Entwicklung des Expertenstandards Entlassungsmanagement in der Pflege gemacht. Eine Umfrage des Deutschen Krankenhausbarometers von 2007 ergab, dass bei der Umsetzung in deutschen Krankenhäusern noch erhebliche Defizite bestehen. Gerade einmal die Hälfte der befragten Krankenhäuser setzt einen Teil der im Expertenstandard genannten Standards um.[21] Da keine aktuelleren Studien bezüglich der Umsetzung gefunden wurden, wird davon ausgegangen, dass sich die Situation inzwischen verbessert hat, aber nach wie vor Optimierungsbedarf besteht.
Damit diese Standards zukünftig flächendeckend in den jeweiligen Krankenhausalltag implementiert werden können, bedarf es der vermehrten Schulung aller Beteiligten. Diese Arbeit befasst sich speziell mit der Schulung von Pflegefachkräften. Aufgrund des Schichtdienstes und des hohen, aber unregelmäßigen Arbeitsaufkommens ist es jedoch schwierig, zeitintensive und mit hohem Aufwand verbundene Präsenzschulungen abzuhalten. Sinnvoller ist es, zeit- und ortsunabhängige e-Learning-Einheiten anzubieten. Diese können je nach Arbeitsaufkommen immer wieder unterbrochen oder auch während des Nachtdienstes durchgeführt werden.
1.2 Fragestellung und Zielsetzung
Aus der Reflexion der dargestellten Entwicklungen ergeben sich vielfältige Fragen. Im Rahmen dieser Bachelorthesis wird der Schwerpunkt darauf gesetzt, wie eine e- Learning-Einheit entwickelt werden kann, mit deren Hilfe sich Pflegefachkräfte in möglichst kurzer Zeit das benötigte Fachwissen zum Thema Überleitungsmanagement aneignen können. Relevant ist jedoch nicht nur die Frage nach dem „Wie“, sondern auch, welche Inhalte in welchem Umfang Eingang in das e-Learning finden müssen, um Fachkräfte ausreichend zu qualifizieren. Ziel der Bachelorthesis ist es, ein vollständiges e-Learning-Konzept zu entwickeln, welches anschließend in der Praxis realisiert werden könnte. Die Inhalte werden so aufbereitet, dass sie für den Lernenden eine stringente Reihenfolge aufweisen.
1.3 Vorgehen
Im nachfolgenden Kapitel wird zunächst das Überleitungsmanagement im Rahmen der integrierten Versorgung dargestellt. Neben Aufgaben und Zielen des Überleitungsmanagements werden auch die aktuelle Situation und Probleme sowie Rahmenbedingungen dargelegt. Ausführlich wird der Expertenstandard Entlassungsmanagement beschrieben. Dieses Kapitel ist relativ umfangreich, da es die Basis für die Entwicklung des e-Learning-Konzeptes bildet und im weiteren Verlauf immer wieder auf Informationen dieses Kapitels zurückgegriffen wird. Im dritten Kapitel erfolgt eine Einführung in das Thema e-Learning. Hier wird auf die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit sowie auf mögliche Potenziale von e-Learnings eingegangen. Darüber hinaus werden verschiedene Arten des e-Learnings erläutert.
Das vierte Kapitel umfasst den Hauptteil und beschäftigt sich mit der Entwicklung eines e-Learning-Konzeptes für das Überleitungsmanagement. Hier werden einzelne Schritte der Entwicklung eines e-Learnings am Beispiel des Überleitungsmanagements dargestellt. Besonders ausführlich wird das Drehbuch beschrieben.
Nach einem Fazit schließt die Bachelorthesis mit einem Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Einsatzes von e-Learning-Einheiten im Krankenhaus.
2. Überleitungsmanagement im Rahmen der Integrierten Versorgung
In diesem Kapitel werden zunächst die Notwendigkeit eines strukturierten Überleitungsmanagements sowie die Schnittstellenproblematik im deutschen Gesundheitswesen beschrieben. Anschließend werden der Begriff, die Bedeutung sowie die Ziele des Überleitungsmanagements näher definiert. Des Weiteren werden Rahmenbedingungen wie die Integrierte Versorgung und die gesetzlichen Regelungen erläutert. Daraufhin wird ausführlich der Expertenstandard Entlassungsmanagement, der von einer Pflegefachkraft parallel zum Pflegeprozess durchgeführt wird, beschrieben. Abschließend erfolgt eine kurze Kritik zum Thema Überleitungsmanagement.
2.1 Hintergrund
Die Einführung der Diagnosebezogenen Fallgruppen (Diagnosis Related Groups, DRGs)[22] als neues Entgeltsystem erhöht den Kostendruck auf die Krankenhäuser. Durch die pauschale Vergütung pro Fall werden Anreize gesetzt, die Verweildauer des Patienten im Krankenhaus maßgeblich zu reduzieren, um kostendeckend arbeiten zu können.[23] Dies hat zur Folge, dass Leistungen von Nachsorgeeinrichtungen früher in Anspruch genommen werden müssen.[24] Hinzu kommt, dass die Anzahl an älteren, multimorbiden und pflegebedürftigen Menschen fortlaufend steigt.[25] Diese Gründe tragen dazu bei, dass in Zukunft mehr Leistungen außerklinisch erbracht werden müssen. Zukünftig wird das Krankenhaus ein Ort der intensiven Behandlung sein. Heilung und Pflege werden vermehrt nachstationär erbracht.[26] Dies betrifft neben Krankenhäusern vor allem ambulante Pflegedienste, aber auch Angehörige von Patienten. Um hier reibungslose Abläufe gewährleisten zu können, müssen Strukturen und Prozesse angepasst und vermehrt auf eine sektorenübergreifende Versorgung ausgerichtet werden. Eine verbesserte Abstimmung und Koordination zwischen den einzelnen Leistungserbringern ist ausschlaggebend für eine kontinuierliche Betreuung und Behandlung des Patienten.[27]
Aus diesem Grund nimmt die Bedeutung der Schnittstellen zwischen stationärer und poststationärer Versorgung beträchtlich zu. Dies betrifft zum einen den Wechsel der Versorgungseinrichtung und zum anderen die Zusammenarbeit der interdisziplinären Berufsgruppen, die den Patienten behandeln und betreuen.[28]
An diesen Schnittstellen kommt es häufig zu Problemen, da die Organisation der Nachsorge und die Aufgabenverteilung nicht verbindlich und einheitlich geregelt sind. Informationen werden oft fehlerhaft oder unvollständig übermittelt.[29] Die Krankenhäuser gestalten die Überleitungsbögen und die Prozesse nach eigenem Belieben.[30] Das Krankenhauspersonal fühlt sich nicht zuständig oder ist nur unzureichend qualifiziert.[31] Oft werden nur Teilprozesse wahrgenommen und die restliche Organisation dem Sozialdienst überlassen.[32] Auch die Qualität und der Informationsgehalt von Arztbriefen sind teilweise unzureichend und führen zu einer schlecht abgestimmten poststationären Versorgung.[33]
Dies verschärft die Schnittstellenproblematik zwischen den beteiligten Institutionen.[34] In vielen Fällen werden die soziale Situation und damit die potenzielle Notwendigkeit für eine poststationäre Betreuung zum Zeitpunkt der stationären Aufnahme nicht ausreichend berücksichtigt. Dies erhöht die Gefahr der Unterversorgung, insbesondere bei alten und alleine lebenden Menschen.[35] Hinzu kommt, dass die Angebote an Dienstleistungen für die Versorgung im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt inzwischen sehr differenziert und komplex sind. Viele Patienten und Angehörige sind mit der Organisation einer optimalen poststationären Versorgung überfordert und können ihre eigene Lage und ihre Bedürfnisse nur schwer zutreffend einschätzen.[36] Eine bessere und umfangreichere Beratung und das Aufzeigen verschiedener Lösungsmöglichkeiten tragen zu einer Entlastung und adäquaten Information von Patienten und Angehörigen bei. Dies kann dauerhaft auch das Image des Krankenhauses aufwerten.[37]
2.2 Definition Uberleitungsmanagement
Das Überleitungs- oder Entlassungsmanagement[38] befasst sich mit allen Tätigkeiten der Pflegekraft, die im Zusammenhang mit der Entlassung des Patienten aus einer stationären Einrichtung in eine poststationäre Versorgungseinrichtung oder in die häusliche Umgebung stehen.[39] Das Überleitungsmanagement soll Versorgungsbrüche bei der Entlassung von pflege- oder unterstützungsbedürftigen Patienten in poststationäre Versorgungseinrichtungen vermeiden und eine kontinuierliche und bedarfsgerechte Versorgung der Patienten sichern.[40] Dies erfolgt durch eine möglichst frühzeitige Identifizierung von Patienten mit poststationärem Versorgungs- oder Unterstützungsbedarf sowie die Feststellung, wie hoch der Unterstützungsbedarf sein wird.[41] Bei der Organisation der Entlassungs- oder Überleitungsplanung können die dezentrale, die zentrale und die kombinierte Überleitung unterschieden werden. Bei der dezentralen Überleitung werden Patienten von einer auf der gleichen Station tätigen Pflegefachkraft entlassen, während bei der zentralen Überleitung eine Pflegefachkraft für alle oder zumindest für mehrere Stationen zuständig ist. Bei der kombinierten Überleitung werden unproblematische Standard-Entlassungen dezentral geplant und ausgeführt, während komplexere Fälle zentral organisiert werden.[42]
2.3 Ziele des Überleitungsmanagements
Ziel des Überleitungsmanagements ist es, sowohl die Versorgung während des Krankenhausaufenthaltes als auch die poststationäre Versorgung des Patienten sicherzustellen, Schnittstellen zwischen den einzelnen Sektoren im Gesundheitswesen zu überwinden und somit Unterbrechungen der Versorgungskette zu vermeiden.[43] Eine kontinuierliche Betreuung und Behandlung vermindert das Risiko von Folgeschäden und -kosten, die durch Versorgungsbrüche entstehen können.[44] Durch eine verbesserte Koordination zwischen den einzelnen Leistungserbringern können Patienten früher aus der stationären Behandlung entlassen werden, ohne dass Drehtüreffekte befürchtet werden müssen.[45]
Die Ziele und Vorteile eines strukturierten Überleitungsmanagements können aus zwei Perspektiven betrachtet werden.
Für Patienten zählt vor allem die kontinuierliche Betreuung und Versorgung bei der Entlassung in eine poststationäre Einrichtung und die Vermeidung von Versorgungs- brüchen.[46] Ein weiteres Ziel ist die angemessene und umfangreiche Beratung hinsichtlich möglicher poststationärer Versorgungsangebote. Die verstärkte Einbindung des Patienten in den Überleitungsprozess erhöht zudem die Zufriedenheit und somit auch die Compliance[47] des Patienten.[48] [49] Ein gut funktionierendes Überleitungsmanagement führt desweiteren zu einer deutlichen Entlastung der Angehörigen. Beratung und Schulung geben Sicherheit und Vertrauen und führen so auch zu einer emotionalen Entlastung.[50]
Für das Krankenhaus ergeben sich durch die Schaffung transparenter Versorgungsprozesse weitere Vorteile. Die Einführung eines strukturierten Überleitungsmanagements dient der Prozessoptimierung, wodurch eine Effizienzsteigerung erreicht werden kann.[51] Die angestrebte Verweildauerreduktion kann zu Kosteneinsparungen führen. Durch die verbesserte Kooperation zwischen den einzelnen Leistungserbringern können Brüche in der Versorgungskette vermieden und somit Kosten für Folgeschäden oder erneute Krankenhauseinweisungen vermieden werden.[52] Bei einer erneuten Krankenhauseinweisung aufgrund derselben Diagnose muss das Krankenhaus für die entstehenden Kosten aufkommen, ohne erneut Zahlungen von der Krankenkasse zu erhalten.[53] Außerdem kann ein gutes Überleitungsmanagement das Image des Krankenhauses steigern und wirkt sich positiv auf die Qualität der Behandlung aus.[54]
2.4 Rahmenbedingungen des Überleitungsmanagements
Im folgenden Kapitel werden die Rahmenbedingungen erläutert, in deren Kontext das Überleitungsmanagement steht. Neben der Integrierten Versorgung, die ebenfalls einen Lösungsansatz zur Schnittstellenproblematik darstellt, werden die rechtlichen Rahmenbedingungen erläutert.
2.4.1 Integrierte Versorgung
Die Integrierte Versorgung soll als sektorenübergreifende Versorgungsform die Kooperation und Koordination zwischen Leistungserbringern aller Versorgungsebenen verbessern. Ziel ist es, die durch die sektorale Trennung verursachte Über-, Unter- und Fehlversorgung von Patienten zu vermeiden und eine qualitativ hochwertigere und stärker auf die Patientenbedürfnisse ausgerichtete Versorgung zu verwirklichen.[55] Erreicht werden soll dieses Ziel durch Integrationsversorgungsverträge zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern.[56] Insbesondere die flächendeckende Behandlung von Volkskrankheiten soll durch Verträge der Integrierten Versorgung verbessert werden.[57] Des Weiteren können Qualität und Effizienz der Versorgungsprozesse optimiert werden, um dem Patienten sowohl ambulant als auch stationär eine gut aufeinander abgestimmte Versorgung bieten zu können.[58] Wie bereits angesprochen, arbeiten die einzelnen Leistungserbringer im deutschen Gesundheitswesen zu isoliert, ohne Kooperation und Datenaustausch untereinander. Diese mangelnde Kommunikation und Kooperation führen zu erhöhten Arbeits- und Kostenaufwendungen durch unnötige Doppeluntersuchungen und schlecht ineinandergreifende Therapien.[59] Im Rahmen der Versorgungsverträge werden klinische Behandlungspfade entwickelt, die medizinische, pflegerische und ökonomische Aspekte der optimalen Patientenversorgung beinhalten. Unter Einbeziehung von medizinischen Leitlinien und Pflegestandards werden Tätigkeitslisten mit allen Arbeitsschritten in zeitlicher Abfolge erstellt. Diese dienen als Checklisten und erleichtern die Zuteilung von Verantwortlichkeiten und Aufgaben.[60]
2.4.2 Rechtliche Rahmenbedingungen
Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Integrierte Versorgung und das Überleitungsmanagement finden sich im fünften (SGB V) und im elften Sozialgesetzbuch (SGB XI).
Mit dem Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung wurde für die Versicherten ein Recht auf Versorgungsmanagement eingeführt.[61] Gemäß der Gesetzesgrundlage § 11 Abs. 4 SGB V haben Versicherte einen Anspruch darauf, bei der Lösung von Problemen, die den Wechsel des Versorgungsbereichs betreffen, unterstützt zu werden. Die beteiligten Leistungserbringer müssen untereinander alle benötigten Informationen über den Versicherten austauschen und eine sachgerechte Anschlussversorgung gewährleisten. Dies impliziert auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Pflegesektor.[62]
Nach § 112 Abs. 1 SGB V werden zwischen Krankenhaus und Krankenkasse Verträge geschlossen, die Art und Umfang der Krankenhausbehandlung klären. In diesen Verträgen sollen unter anderem die Aufnahme und die Entlassung, aber auch der Übergang vom Krankenhaus in die Pflege und das Versorgungsmanagement geregelt werden.[63]
Das Ziel von § 115 SGB V ist ebenfalls die Sicherung einer nahtlosen Behandlung des Versicherten. Auch hier wird der Anspruch der Versicherten auf ein Versorgungsmanagement aufgenommen.[64]
Mit dem Gesundheitsreformgesetz 2000 wurde in den §§ 140a-h SGB V die gesetzliche Grundlage für eine Integrierte Versorgung geschaffen. Durch das GKV- Modernisierungsgesetz 2004 und das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz 2007 wurden die gesetzlichen Grundlagen der Integrierten Versorgung bereits zweimal überarbeitet, da diese vorher in der Praxis kaum genutzt wurden.[65] Heute können „Ärzte, Fachärzte, Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehakliniken sowie andere zur Versorgung der Versicherten berechtigte Leistungserbringer“[66] mit der Krankenkasse Verträge zur Integrierten Versorgung abschließen. Diese Verträge sind sektorenübergreifend und stellen die Zusammenarbeit aller beteiligten Leistungserbringer einschließlich der Koordination zwischen den einzelnen Sektoren sicher. Nach § 11 Abs. 4 SGB V schließt dies auch das Versorgungsmanagement ein.[67] Die Krankenkassen können Versicherten für die Teilnahme an Verträgen einen Bonus gewähren.[68] Zur Verbesserung der Versorgung älterer Menschen können seit 2007 auch Pflegekassen und Pflegeeinrichtungen in Verträge mit einbezogen werden. Seit 2011 sind auch Pharmaunternehmen und andere Medizinproduktehersteller als Vertragspartner zugelassen.[69]
Seit dem Pflegeversicherungs-Weiterentwicklungsgesetz von 2008 werden in das Versorgungsmanagement auch Pflegeeinrichtungen einbezogen.[70] Nach § 7a SGB XI haben Pflegebedürftige einen Anspruch auf einen Pflegeberater[71], der sie individuell berät und Hilfestellung bei der Wahl von Sozialleistungen und anderen Hilfsangeboten gibt.[72] Pflegekassen sollen gemäß § 45 SGB XI unentgeltliche Pflegekurse für Angehörige anbieten.[73] Ziel ist es, Pflegepersonen[74] ausreichend pflegefachliche Fertigkeiten zu vermitteln und die psychische Belastung, die häufig bei häuslicher Langzeitpflege auftritt, zu mindern.[75]
Der im folgenden Kapitel näher beschriebene Expertenstandard Entlassungsmanagement hat ebenfalls eine rechtliche Relevanz. Gemäß der momentanen Rechtsprechung umfasst der Expertenstandard Entlassungsmanagement den aktuellen und allgemein anerkannten Stand der Pflegeforschung und gilt als antizipiertes Sachverständigengutachten. Aus der daraus entstehenden strafrechtlichen und zivilrechtlichen Wertigkeit ergeben sich bei Nichtbeachtung oder Vernachlässigung der Expertenstandards weitreichende haftungsrechtliche Konsequenzen.[76] 2.5 Expertenstandard Entlassungsmanagement in der Pflege Der Expertenstandard Entlassungsmanagement wurde 2004 von Fachexperten entwickelt und vom Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) herausgegeben. Im Jahr 2009 wurde der Expertenstandard noch einmal überarbeitet und an den aktuellen Forschungsstand angepasst.[77] Neben dem Expertenwissen basiert der Expertenstandard Entlassungsmanagement auf einer umfangreichen Literaturanalyse.[78] Er soll den Entlassungsprozess aus Krankenhäusern bundesweit vereinheitlichen und dient als „fachliche Grundlage für einen strukturierten, systematischen und gesteuerten Prozess“[79], der aus sechs Stufen besteht. Diese sechs Stufen können, analog zu den Phasen des Pflegeprozesses, den vier Phasen Assessment, Planung, Durchführung und Evaluation zu geordnet werden.[80] Der Expertenstandard ist grundsätzlich sehr offen formuliert, um Spielraum zu geben, die einzelnen Phasen individuell an jedes Krankenhaus anpassen zu können. Je nach Schwerpunktauftrag des Krankenhauses ist eine individuelle und organisationsbezogene Ausgestaltung, vor allem im Hinblick auf Verantwortungsbereiche und Aufgabenverteilung, zwingend erforderlich.[81] Unterteilt werden die Expertenstandards in drei Ebenen: die Strukturebene, die Prozessebene und die Ergebnisebene. In der Strukturebene werden Aussagen über benötigte Rahmenbedingungen und Arbeitsmittel, aber auch über Verantwortungsbereiche und Kompetenzen des Personals getroffen. Die Prozessebene beschreibt, was in der jeweiligen Phase von wem und wie getan werden muss. Die Ergebnisebene zeigt den Ist-Zustand nach den in der Prozessebene durchgeführten Maßnahmen und die Ziele, die erreicht werden sollten.[82] Aufbauend auf dem Expertenstandard können von Pflegeteams Praxisstandards entwickelt werden, die genaue Handlungs- und Arbeitsanweisungen enthalten und für jedes Krankenhaus individuell erstellt werden können.[83] Der Entlassungsprozess beginnt direkt bei der Patientenaufnahme mit einem Assessment, in dessen Rahmen Informationen gesammelt werden, die die Feststellung des Pflegebedarfs erlauben.[84]
Im Anschluss werden Ziele festgelegt und Maßnahmen geplant, die in der nächsten Phase durchgeführt werden.
Abschließend erfolgt die Kontrolle und Evaluation der durchgeführten Tätigkeiten.[85] Alle Schritte werden exakt dokumentiert, um die Nachvollziehbarkeit gewährleisten zu können.[86]
Ziel ist es, jedem Patienten ein individuelles Entlassungsmanagement zukommen zu lassen, um die nötige poststationäre Versorgung kontinuierlich und bedarfsgerecht zu sichern.86[87]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Ablauf Entlassungsmanagement
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an DNQP [2009], S. 10.)
2.5.1. Assessment
Gemäß dem Expertenstandard beginnt der Prozess der Überleitung bereits am Tag der stationären Aufnahme. Innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Aufnahme führt die Pflegefachkraft „eine erste kriteriengeleitete Einschätzung der erwartbaren poststationären Versorgungsrisiken und des Unterstützungsbedarfs durch.“[88] Dieses initiale Assessment wird bei allen Patienten durchgeführt und gibt erste Hinweise darauf, ob ein erhöhtes Risiko für einen poststationären Unterstützungsbedarf besteht. Das Assessment wird anhand festgelegter Kriterien durchgeführt, die mit dem Patienten durchgegangen werden. Es wird kein konkretes Assessment empfohlen, es werden lediglich Kriterien festgelegt, die im Rahmen des genutzten Assessments erfüllt werden sollen. Es sollen mögliche krankheits- und pflegebezogene sowie alltagsbezogene Versorgungs- oder Unterstützungserfordernisse abgefragt werden. Außerdem sind der psychosoziale und biografisch bedingte Unterstützungsbedarf relevant sowie Unterstützungserfordernisse hinsichtlich des erwartbaren Selbstmanagements des Patienten. Abschließend soll der Unterstützungsbedarf hinsichtlich „der Auswahl und Koordination verschiedener erforderlicher Hilfeleistungen und Hilfsmittel“[89] ermittelt werden.[90] Ziel ist es, ein möglichst genaues Bild der sozialen Situation des Patienten und seiner Angehörigen zu erhalten.[91] Alle Antworten werden dokumentiert.
Ein mögliches Assessment-Instrument, welches alle Kriterien erfüllt und im Zusammenhang mit dem Expertenstandard Entlassungsmanagement in der Literatur häufig genannt wird[92], ist der Blaylock Risk Assessment Screening Score (BRASS-Index). Weitere mögliche Instrumente, die auf ähnlichen Kriterien beruhen sind 13 Aktivitäten und existenzielle Erfahrungen des Lebens nach Krohwinkel und die 12 Lebensaktivitäten nach Roper et al.[93]
Der BRASS-Index wurde 1992 als Bestandteil eines Systems zur Entlassungsplanung von A. Blaylock und C. Casen entwickelt.[94] Er ermöglicht die Identifizierung von Patienten mit poststationärem Versorgungsbedarf und beinhaltet zehn Items, die in eine oder mehrere Einschätzungsmöglichkeiten unterteilt sind und denen jeweils Punkte zugeordnet werden können. Die abgefragten Kriterien sind Alter, Lebenssituation und soziale Unterstützung, funktioneller Status, kognitive Fähigkeiten, Verhaltensmuster, Mobilität, sensorische Defizite, Anzahl der vorherigen Krankenhausaufenthalte, Anzahl der medizinischen Diagnosen sowie die Anzahl der erforderlichen Medikamente. Nach Ausfüllen des BRASS-Index werden die einzelnen Punkte addiert. Die geringstmögli- che Summe liegt bei null, die höchstmögliche Summe bei 40. Für den Fall, dass ein Patient zehn oder mehr Punkte erreicht, muss eine gezielte Entlassungsplanung eingeleitet werden.[95]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[96]
Tabelle 2: BRASS-Index
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Hunt [2009] S. 209 und Dahmen [2008] S. 13.)
Falls im Rahmen des initialen Assessments festgestellt wird, dass ein poststationäres Versorgungsrisiko besteht, wird ein zweites differenziertes Assessment durchgeführt.
Diese detailliertere Informationssammlung bezieht nun auch vermehrt Angehörige mit ein. Gerade bei älteren Patienten ist oft die Kernfrage, wo sie nach dem Krankenhausaufenthalt leben. Mit Einverständnis des Patienten besuchen Pflegefachkräfte auch die häusliche Umgebung, um sich ein eigenes Bild der Wohnsituation machen zu können. Kann die Pflegekraft eine Rückkehr des Patienten in seine häusliche Umgebung nicht verantworten, so versucht sie gemeinsam mit dem Patienten und seinen Angehörigen eine tragbare Lösung zu finden.[97] Auch für das differenzierte Assessment wird seitens des DNQP kein konkreter Vorschlag gemacht, welches Instrument genutzt werden soll.
In der Praxis wird häufig auf den Barthel-Index zurückgegriffen.98 99 Dieser wurde 1965 von Mahony und Barthel entwickelt.100 Im Rahmen des Barthel-Index' wird die Beeinträchtigung der Selbstständigkeit des Patienten in Bezug auf die Ausübung von Alltagsfunktionen erfasst. Anhand einer Punkteskala von null bis 100 wird eine Aussage über den Schweregrad der Beeinträchtigung getroffen. Je niedriger die Punktzahl, desto schlechter geht es dem Patienten. Der Grad der Beeinträchtigung wird anhand folgender zehn Alltagsfunktionen beurteilt: „Essen und Trinken, Baden, Körperpflege, An- und Auskleiden, Stuhlkontrolle, Urinkontrolle, Toilettenbenutzung, Bett- bzw. Stuhltransfer, Mobilität und Treppensteigen“.101 102
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 3: Barthel-Index
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Bartrow [2012], S. 83f.)
Diese Einschätzung wird erneut durchgeführt und gegebenenfalls angepasst, wenn sich das Krankheitsbild während des Krankenhausaufenthaltes verändert. Wichtig ist, dass beide Befragungen, wenn auch nicht anhand der genannten Instrumente, dann doch anhand geeigneter Kriterien durchgeführt werden. Nur so kann eine systematische Einschätzung des Versorgungsbedarfs des Patienten ermittelt werden.103
2.5.2 Planung
Im Anschluss an das Assessment entwickelt die Pflegefachkraft in Kooperation mit dem Patienten und seinen Angehörigen sowie mit beteiligten Leistungserbringern eine individuell auf den Patienten abgestimmte Entlassungsplanung. Aus dieser Planung werden Handlungsempfehlungen und Tätigkeiten abgeleitet, die eine adäquate poststationäre Versorgung sicherstellen sollen. Hierzu gehört die „bedarfsgerechte Information, Beratung und Schulung“104 des Patienten und seiner Angehörigen mit dem Ziel, Versorgungsrisiken frühzeitig zu erkennen und die erforderliche Versorgung nach der Entlassung zu gewährleisten. Unter Einbeziehung aller Beteiligten sollte auch zu diesem Zeitpunkt der voraussichtliche Entlassungstermin bestimmt werden. Der Versorgungsbedarf und die Unterstützungsmöglichkeiten sollten abschließend geklärt sein.105
2.5.3 Durchführung
Auf Basis der Planung erfolgt die Durchführung der einzelnen Maßnahmen. Der Aufgabenbereich der Pflegefachkraft ist hier relativ umfangreich und umfasst die Information und Beratung sowie die Anleitung und Schulung von Patienten und Angehörigen. Darüber hinaus organisiert die Pflegefachkraft die benötigten Hilfsmittel, so zum Beispiel ein Pflegebett und Dienstleistungen wie Mahlzeitendienste. Eine weitere wichtige Aufgabe der Pflegefachkraft ist die Koordination der Zusammenarbeit aller an der Versorgung des Patienten beteiligten Leistungserbringer. Die Schulung und Beratung von Patient und Angehörigen nimmt besonders dann einen hohen Stellenwert ein, wenn nach der Entlassung keine professionelle Pflege stattfindet. Neben wichtigen Informationen zu Pflegehilfsmitteln und Pflegetechniken werden Patienten über mögliche Leistungsansprüche gegenüber der Kranken- oder Pflegekasse und dem Sozialamt als auch über verschiedene Möglichkeiten der poststationären Versorgung aufgeklärt. Angehörige werden über die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Pflegekursen oder die Entlastung durch ambulante Pflegedienste und Kurzzeitpflege informiert. Mit Zustimmung des Patienten informieren Pflegefachkräfte auch poststationäre Versorgungseinrichtungen und andere Beteiligte über den voraussichtlichen Entlassungstermin und den Pflegebedarf. Detaillierte schriftliche Informationen erhalten diese Einrichtungen auch noch einmal mit dem Überleitungsbogen, der von der Pflegefachkraft ausgefüllt wird und alle wichtigen Informationen zu „Pflegeproblemen, Zielen der Pflege, angewandten Pflegemaßnahmen, zum Status des Patienten, von ihm getroffene Regelungen und gegebenenfalls weitere Besonderheiten“106 enthält.107 Im Rahmen der Anleitung und Schulung werden dem Patienten und seinen Angehörigen wichtige Pflege- handlungen gezeigt und erklärt sowie bei Bedarf geübt. Wichtig ist, dass die Pflegefachkraft sicherstellt, dass sowohl der Patient als auch dessen Angehörige in der Lage sind, die verschiedenen Pflegehandlungen selbstständig durchzuführen. Die fortschreitende Verkürzung des Krankenhausaufenthaltes kann auch dazu führen, dass im Krankenhaus begonnene Übungen in der häuslichen Umgebung mit Unterstützung eines ambulanten Pflegedienstes weitergeübt werden müssen. Als Abschluss dieser Phase ist es besonders wichtig, dass die Pflegefachkraft die poststationäre Einrichtung über den Entlassungstermin informiert.[98]
2.5.4 Evaluation
Spätestens 24 Stunden vor der Entlassung prüft die Pflegefachkraft, ob die Durchführung aller Maßnahmen mit der ursprünglichen Planung übereinstimmt und führt erneut ein Gespräch mit dem Patient und seinen Angehörigen. Der gesamte Entlassungsprozess wird ein letztes Mal überprüft und eventuelle Modifikationen werden vorgenommen.[99] Nach diesem Gespräch ist der Patient für die Entlassung bedarfsgerecht vorbereitet. Eine wichtige, vor allem auch rechtlich bedeutsame Funktion hat in diesem Rahmen die Dokumentation des Entlassungsprozesses. Verfasst werden müssen der Überleitungsbogen mit allen wichtigen Informationen für die poststationäre Versorgungseinrichtung und der Pflegebericht.[100] [101]
Innerhalb von 48 Stunden nach der Entlassung nimmt die Pflegefachkraft Kontakt mit dem Patienten, seinen Angehörigen oder der betreuenden Einrichtung auf, um sicherzugehen, dass die Entlassungsplanung bedarfsgerecht und umsetzbar war.[102] Hier haben Patient und Angehörige auch noch einmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder Probleme mitzuteilen. So kann die Pflegefachkraft gegebenenfalls weitere Maßnahmen veranlassen. Eine erneute Kontaktaufnahme bietet nicht nur dem Patienten Vorteile. Diese Art von Feedback hilft auch den Pflegefachkräften, ihre Arbeit kontinuierlich zu optimieren.[103]
2.6 Kritik
Die Implementierung eines Überleitungsmanagements bedeutet gerade zu Beginn einen erhöhten Aufwand für das Krankenhaus und setzt das Vorhandensein personeller Ressourcen voraus. Werden Ziele und Notwendigkeit der Einführung eines Überleitungsmanagements nicht ausreichend an die Mitarbeiter vermittelt, kann bereits im Vorfeld mit Widerstand gegen den hierdurch verursachten erhöhten Arbeitsaufwand gerechnet werden. Nur eine klar strukturierte Aufgabenverteilung und eindeutig verteilte Zuständigkeiten können Mitarbeiter ausreichend motivieren, ihre Aufgaben pflichtbewusst wahrzunehmen.[104] Das Entlassungsmanagement hat sich aus Sicht der Leistungserbringer nach der Einführung der DRGs verschlechtert. Im Vordergrund steht nach wie vor die stationäre Behandlung, nicht aber die bedarfsorientierte und sektorenübergreifende Überleitung in eine poststationäre Versorgungseinrichtung oder die häusliche Umgebung, obwohl diese im Rahmen der alternden Bevölkerung immer mehr an Bedeutung gewinnt. Zukünftig müssen diese Schnittstellen vermehrt untersucht werden, um die Koordination und Kooperation zwischen den einzelnen Leistungserbringern verbessern zu können. Regelmäßige Besprechungen zwischen beteiligten Pflegefachkräften und Krankenhausärzten, bestenfalls auch unter Einbezug Verantwortlicher nachstationärer Einrichtungen, können die Informationsverteilung verbessern und tragen zu einer optimalen Überleitung des Patienten bei. Eine frühzeitige interdisziplinäre Planung der Entlassung oder Überleitung ermöglicht auch mehr Vorbereitungszeit hinsichtlich der Optimierung des Einsatzes personeller Ressourcen.[105] Fraglich ist jedoch, wie ein nicht-vergütetes Entlassungsmanagement im Rahmen der primär wirtschaftlich orientierten DRGs optimiert werden kann.[106]
3. E-Learning
Um vor der Entwicklung der Schulungseinheit Überleitungsmanagement ein Grundverständnis für e-Learning zu vermitteln, werden in den folgenden Kapiteln zunächst die Hintergründe der Einführung von e-Learning-Einheiten anstelle von Präsenzschulungen beschrieben. Anschließend werden verschiedene Formen und mögliche Potenziale von e-Learning-Einheiten sowie deren Evaluation dargestellt. Abschließend erfolgt eine kurze Kritik der Thematik.
3.1 Hintergrund
In der heutigen Zeit leben wir in einer Informationsgesellschaft, in der aufgrund von stetiger Forschung und Entwicklung der schnelle Transfer und die Vermittlung von Wissen immer mehr an Bedeutung gewinnen.[107] Rasche Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und steigende regulatorische Anforderungen erhöhen den Druck auf die Unternehmen, ständig auf dem jeweils aktuellen Stand der Wissenschaft zu agieren. Insbesondere dienstleistungsorientierte Unternehmen sind immer mehr auf gut geschulte Mitarbeiter angewiesen.[108] Oft reicht die Auffrischung von bereits Gelerntem nicht mehr aus. Gerade auch der Pflegeberuf entwickelt sich kontinuierlich weiter. Der Aufgabenbereich wird immer komplexer, was berufsbegleitende und qualifizierte Fort- und Weiterbildungen erforderlich macht, da nur so die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit erhalten werden kann.[109] In vielen Ländern[110] ist bereits eine Fortbildungspflicht für Pflegekräfte gesetzlich verankert. In Deutschland ist dies so nicht der Fall.[111] Lediglich im Rahmen der im SGB V und SGB XI fixierten qualitätssichernden Anforderungen sind Leistungserbringer in der Pflege verpflichtet, sich hinsichtlich aktueller pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse fort- und weiterzubilden.[112] Neben der gesetzlichen Verpflichtung sind Fort- und Weiterbildungen aber auch aus anderen Gründen notwendig und sinnvoll. So rückt auch die Mitarbeiterbindung immer mehr in den Fokus des Interesses. Durch vermehrte Fort- und Weiterbildung kann die Möglichkeit der Selbstverwirklichung der Mitarbeiter erhöht und somit auch die Wahrscheinlichkeit der länger andauernden Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter gesteigert werden.[113] Dies ist insbesondere in einer Zeit des drohenden Pflegenotstandes und von anhaltendem Fachkräftemangel von großer Bedeutung.[114]
Aus Sicht der Unternehmen haben Fortbildungen jedoch nicht ausschließlich Vorteile. Sie verursachen hohe Kosten und insbesondere die normalerweise üblichen Präsenzschulungen sind sehr zeitintensiv. Bei einer Präsenzschulung entstehen neben direkten Kosten für die Schulung, Raummieten, Verpflegungs- und Reisekosten vor allem indirekte Opportunitätskosten aufgrund der Freistellung der Mitarbeiter und dem daraus resultierenden Produktionsverlust. Je größer das Unternehmen und je mehr Mitarbeiter gleichzeitig geschult werden müssen, desto deutlicher fallen diese Kosten ins Gewicht.[115]
Um diesen negativen Effekten entgegenzuwirken, werden anstelle oder als Ergänzung von Präsenzschulungen immer häufiger flexible e-Learning-Einheiten eingesetzt.[116]
3.2 Definition und Formen des e-Learnings
E-Learning (electronical learning = elektronisch unterstütztes Lernen) wird heute als Überbegriff für nahezu alle Bildungsangebote genutzt, die in irgendeiner Weise mit der digitalen Welt in Verbindung stehen.[117] Sehr umfassend kann e-Learning als die Wissensvermittlung und -kontrolle mit Hilfe elektronischer Medien definiert werden.[118]
Im Folgenden werden vier unterschiedliche Formen des e-Learning beschrieben.
3.2.1 Computer-Based-Training & Web-Based-Training
Computer-Based-Trainings (CBTs) ermöglichen zeit- und ortsunabhängiges Lernen dadurch, dass Softwareanwendungen auf CD-ROM oder DVD vertrieben werden. Da keine Verbindung zum Internet besteht und somit Gruppenaktivitäten oder E-MailVerkehr mit dem Tutor ausgeschlossen sind, steht beim CBT das Selbststudium im individuellen Lerntempo im Vordergrund.[119] Meist werden im Rahmen des CBT zunächst Lerninhalte präsentiert, oft handelt es sich um reines Faktenwissen, und anschließend werden Aufgaben und Fragestellungen gezeigt, die auf Basis des vorher Gelernten beantwortet werden sollen. Abschließend erfolgt auf Grundlage der gegebenen Antworten eine Erfolgskontrolle. Diese dient auch als Feedback für den Lernen- den.[120]
Das Web-Based-Training (WBT) ist eine Weiterentwicklung des CBT und hat dieses inzwischen zu großen Teilen ersetzt. Der elementare Unterschied zwischen diesen beiden Trainings ist, dass für das WBT ein Internetzugang zwingend erforderlich ist.
Dies schränkt zwar das anvisierte ortsunabhängige Lernen ein, bietet dafür aber viele neue Möglichkeiten der Kommunikation und der Wissensvermittlung.[121] WBTs sind auf einem zentralen Server gespeichert und können direkt über das Internet oder Intranet abgerufen werden und müssen nicht mehr über einzelne Datenträger verbreitet werden.[122] Ein Nachteil ist, dass je nach Übertragungsgeschwindigkeit im Internet Darstellungen und Animationen nur langsam oder gar nicht geladen werden können und somit nur begrenzt nutzbar sind.[123] Neben der asynchronen Kommunikation zwischen Lernendem und Tutor oder Gruppenteilnehmern ist nun auch ein zeitgleicher Austausch möglich. Ein weiterer Vorteil gegenüber einem CBT ist, dass Inhalte gegebenenfalls schnell und einfach neuen Erkenntnissen und Forschungsergebnissen angepasst werden können. Dies erspart Zeit und vor allem Kosten, da aktualisierte Inhalte nicht erneut auf CD-ROM oder DVD gebrannt und verbreitet werden müssen. Außerdem können Lerndaten zentral verwaltet und somit die Lerninhalte dem Lernfortschritt des Teilnehmers angepasst werden.[124]
3.2.2 Virtual Classroom
Der Virtual Classroom (virtuelles Klassenzimmer) ermöglicht die Kombination von CBT und WBT mit den Vorteilen klassischer Präsenzseminare.[125] Der Vortragende wird bei seinem Seminar gefilmt und die Aufnahmen können zeitgleich im Internet verfolgt werden. Ein großer Vorteil ist, dass über den Virtual Classroom eine große Zahl von Zuhörern gleichzeitig angesprochen werden kann. Auch kann das Seminar zusätzlich visuell und auditiv aufgewertet werden.[126] Zwar tritt die bei e-Learning-Einheiten häufig postulierte Zeitunabhängigkeit in den Hintergrund, dafür können ohne Zeitverzögerungen Fragen gestellt und beantwortet werden, die Teilnehmer müssen ihren Arbeitsplatz nicht verlassen und können Reisezeiten sparen.[127] Je nach Teilnehmerzahl und Ausgestaltung des Virtual Classroom kann auch über Head-Sets und Webcams untereinander kommuniziert werden. Über eine interaktive Tafel, auf die jeder Teilnehmer schreiben kann, können gemeinsam Themen erarbeitet und gespeichert werden.[128]
3.2.3 Blended Learning
Im Rahmen des Blended Learning wird versucht, eine optimale Mischung aus Präsenzseminaren und e-Learning-Einheiten zu erstellen. Ziel ist es, die Vorteile beider Schulungsarten zu nutzen, während die Nachteile beider Methoden minimiert wer den.[129] Präsenzschulungen und e-Learning-Einheiten sollen einander ergänzen, wobei das e-Learning der Präsenzschulung untergeordnet wird und die Stellung eines unterstützenden Mediums hat.[130]
3.3 Potenziale des e-Learnings
Im Zusammenhang mit e-Learning gibt es mehrere Aspekte, die dieses gegenüber einer Präsenzschulung attraktiver machen. Die zentrale und wahrscheinlich wichtigste Eigenschaft von e-Learning ist die Steigerung der Flexibilität der Lernenden durch die Orts- und Zeitunabhängigkeit. Lernende können den Zeitpunkt und die Dauer des Lernens mittels e-Learning frei wählen und somit auch ihr Lerntempo selbst bestimmen. Die Ortsunabhängigkeit wird jedoch dadurch begrenzt, dass zumindest ein PC und je nach Art des e-Learning auch eine Intranet- oder Internetverbindung vorhanden sein müssen.[131]
Hinzu kommen Vorteile und Verbesserungen gegenüber einer Präsenzschulung durch mehr motivationsfördernde Effekte. Im Rahmen von e-Learning-Einheiten können Sachverhalte realitätsnäher und interessanter dargestellt werden als in einer Präsenzschulung. Außerdem ist eine individuellere Abstimmung der Lerninhalte auf die Bedürfnisse des Lernenden möglich. Eine tatsächliche Motivationssteigerung gegenüber Präsenzschulungen kann aber nur dann erzielt werden, wenn das Potenzial eines eLearning weitestgehend ausgeschöpft wird. Wichtig sind die Ausrichtung auf eine konkrete Zielgruppe unter Berücksichtigung einer didaktischen Zielsetzung und der Einsatz von multimedialen Lerninhalten. Aufgrund der langen und kostenintensiven Entwicklung werden einzelne dieser Aspekte oftmals vernachlässigt. Dies bringt negative Konsequenzen mit sich, die dazu führen können, dass sich die positiven Effekte zumindest teilweise relativieren.[132]
Ein weiterer positiver Aspekt des e-Learnings ist die Möglichkeit, es individuell auf das Vorwissen und die Bedürfnisse des Lernenden abzustimmen. Idealerweise kann der Lernende die Lerninhalte sowie die Reihenfolge der Bearbeitung selbst auswählen und somit den gesamten Lernprozess selbst steuern.[133] Nicht zuletzt können im Rahmen von e-Learning-Einheiten hohe Kosteneinsparungspotenziale generiert werden.[134] Diese werden insbesondere auf eine Reduzierung des schulungsbedingten Arbeitsausfalls sowie auf Reise- und Übernachtungskosten zurückgeführt.[135] Durch den Einsatz von e- Learning-Einheiten fallen im Idealfall keine Reise- und Übernachtungskosten mehr an,die entstehen können, wenn beispielweise eine Krankenhauskette mit mehreren Standorten zentrale Präsenzschulungen abhält. Zusätzlich fällt die Reisezeit nicht mehr ins Gewicht, falls diese als Arbeitszeit angerechnet wurde. Der schulungsbedingte Arbeitsausfall kann durch die individuelle Bestimmung des Lerntempos und unter Beachtung des jeweiligen Vorwissens für jeden Mitarbeiter auf ein Minimum reduziert werden. Da die Implementierung eines e-Learning-Systems je nach vorhandenen Ressourcen sehr teuer sein kann, lohnt sie sich erst ab einer gewissen Anzahl von geplanten Schulungen. Die Lizenzgebühren oder gegebenenfalls die Entwicklung einer eigenen e-Learning-Einheit sind ebenfalls sehr kostenintensiv und lohnen sich erst ab einer bestimmten Teilnehmerzahl.[136]
3.4 Erstellung von e-Learning-Einheiten
Die Entwicklung und Erstellung einer e-Learning-Einheit umfasst acht Arbeitsschritte. Im ersten Schritt, der Projektinitialisierung, werden das Budget für das e-Learning freigegeben und Ziele, erste Ideen, Bedingungen und Probleme in einem Exposé niedergeschrieben.[137] Anschließend werden der Projektleiter und das Projektteam ausgewählt. Je nach Art und Umfang der e-Learning-Einheit setzt sich dieses aus Graphikdesignern, Programmierern, Medienautoren und Screendesignern zusammen. Mit entsprechender Software können e-Learning-Einheiten aber auch relativ einfach selbst entwickelt und erstellt werden. Der nächste Arbeitsschritt ist das technische Briefing mit allen Beteiligten. Hier werden die technische Umsetzung und das Design diskutiert. Auf der Basis der Ergebnisse wird ein Styleguide erstellt, der die Grundlage für die weitere Entwicklung der e-Learning-Einheit darstellt. Ein zweites Briefing befasst sich mit der Bestimmung der Lerninhalte. Die Ergebnisse dieses Briefings bilden die Basis für die nun folgende Konzeption. Diese beginnt mit einem Grobkonzept, das auf den Ergebnissen des zweiten Briefings und auf dem Styleguide beruht.[138] Nach der Abnahme beginnt der Medienautor mit der Erstellung des Feinkonzepts. Dieses durchläuft mehrere Korrekturschleifen, bevor es zum Drehbuch weiterentwickelt werden kann. Nach Drehbuchabnahme wird mit der technischen Umsetzung begonnen, deren Ergebnis die Beta-Version des e-Learnings ist. Diese durchläuft intensive Testphasen, bevor mit der finalen Produktion begonnen werden kann.[139] Eine zunehmende Rolle spielt in diesem Bereich auch die Evaluation. Der Begriff Evaluation existiert im Bildungsbereich bereits seit den 1970er Jahren und beschreibt Begriffe wie Qualitätskontrolle und -sicherung sowie die Wirkungskontrolle.[140] Ziel ist es, mit Hilfe von Evaluationen Bildungsangebote systematisch hinsichtlich „ihrer Qualität, Funktionalität, Wirkung und ihrem Nutzen zu analysieren und zu bewerten“.[141]
Da auch immer mehr Bildung in Form von e-Learning-Einheiten angeboten wird, ist es sinnvoll, auch diese einer Qualitätskontrolle in Form von Evaluationen zu unterziehen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein e-Learning zu evaluieren. Unterschieden wird oft zwischen der formativen und der summativen, der internen und der externen, der subjektiven und der objektiven sowie zwischen der quantitativen und der qualitativen Evaluation.
In einer prozessbegleitenden oder auch formativen Evaluation wird das e-Learning kontinuierlich bereits während der Entwicklungsphase beurteilt und verbessert. Dies ermöglicht eine schrittweise Optimierung des Gesamtproduktes und dient der Vermeidung von Fehlentwicklungen. Auf diese Art und Weise kann das Produkt nach und nach explizit auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Zielgruppe abgestimmt werden.
Bei den produktbewertenden oder summativen Evaluationen steht die abschließende Qualitätsbewertung des bereits entwickelten e-Learning im Mittelpunkt.
Die interne Evaluation bzw. Selbstevaluation wird von den Entwicklern selbst durchgeführt, während die externe Evaluation bzw. Fremdevaluation von Personen außerhalb des Entwicklungsteams ausgeführt wird.[142]
Durch den Anwender kann eine subjektive Evaluation durchgeführt werden. Diese beschränkt sich eher auf weiche Kriterien wie die Benutzerfreundlichkeit oder das Design. Bei der objektiven Evaluation sollen quantitative und statistisch abgesicherte Daten ermittelt werden. Kriterien wären beispielsweise Fehlerraten oder die Dauer der Durchführung einer e-Learning-Einheit.[143]
Qualitative und quantitative Evaluationen werden hinsichtlich der zugrunde liegenden Forschungsmethode differenziert. Während bei der quantitativen Vorgehensweise statistisch auswertbare Daten im Mittelpunkt stehen, sind bei qualitativen Verfahren die Interpretation von subjektiven Aussagen und Meinungen sowie deren Hintergründe relevant.[144]
3.5 Kritik
Der Austausch bzw. die Ergänzung von Präsenzschulungen durch e-Learning- Einheiten bietet, wie bereits angesprochen, viele Vorteile für das Unternehmen. Durch den Wegfall von Raummiete, Verpflegung, Reise und Freistellung der Mitarbeiter sowie den geringeren Produktivitätsverlust können enorme Kosteneinsparungen generiert werden.[145] E-Learning-Einheiten bieten zeit- und ortsunabhängige Weiterbildungen und können ideal berufsbegleitend durchgeführt werden. Eingangstests ermöglichen eine individuelle Abstimmung der Inhalte der Lerneinheit auf das Vorwissen des Lernenden. Außerdem kann jeder Mitarbeiter sein Lerntempo selbst bestimmen. Eine große Auswahl an Tools ermöglicht die bedarfsgerechte Anpassung des e-Learnings an die jeweiligen Anforderungen der Unternehmen. Die Interaktivität von e-Learning- Einheiten ermöglicht es, auch abstrakte Inhalte durch Simulationen anschaulich darzustellen. Kleinere Zwischentests und Übungen fördern ein aktives Lernen und erhöhen die Motivation der Teilnehmer. Durch Abschlusstests kann der individuelle Lernerfolg jedes Teilnehmers ermittelt und bei Bedarf dokumentiert werden.
E-Learning hat jedoch nicht nur Vorteile. Der Umgang mit den neuartigen Medien muss oft erst erlernt werden. Hier hilft der Einsatz von Blended-Learning. In einem ersten kurzen Präsenzseminar werden den Teilnehmern die Nutzung der e-Learning- Einheit erläutert und offene Fragen geklärt.
Des Weiteren ist ein hohes Maß an Selbstdisziplin und Selbstmotivation seitens des Lernenden erforderlich, da e-Learning-Einheiten meist als Selbststudium konzipiert werden und Wissen eigenständig erarbeitet werden muss.[146] Ein weiteres Problem ist die Gefahr der sozialen Isolation. Da e-Learning-Angebote in erster Linie auf Einzellernende ausgerichtet sind, werden die sozialen Kontakte zum Trainer und zu anderen Gruppenmitgliedern stark reduziert.[147]
Hinzu kommt der hohe Kostenfaktor der Erstellung und Wartung, der mit der Komplexität des e-Learnings steigt. Sinnvoll wird der Einsatz von e-Learning-Einheiten daher in der Regel erst dann, wenn das Lernangebot eine große Zielgruppe anspricht und häufig eingesetzt werden kann.[148] In Anbetracht dessen, dass ein fertig entwickeltes eLearning von theoretisch unbegrenzt vielen Mitarbeitern durchgeführt und beliebig oft wiederholt werden kann, relativieren sich diese Kosten jedoch.
In Bezug auf den Einsatz von e-Learning-Einheiten im Krankenhaus können weitere Probleme festgestellt werden. Der im Krankenhaus übliche Schichtdienst hat einen negativen Einfluss auf den Biorhythmus des Menschen, der durch Phasen höherer und geringerer Leistungsfähigkeit gekennzeichnet ist. Dies führt insbesondere während der Nachtschicht häufig zu einem Leistungstief, welches Konzentrationsschwächen mit sich bringt.[149] Der ursprüngliche Vorteil, dass das Pflegepersonal e-Learning- Einheiten zeitunabhängig auch während der Nachtschichten durchführen kann, relativiert sich somit teilweise und kann nicht verallgemeinert werden. Dies schließt jedoch nicht aus, dass ein Teil des Pflegepersonals durchaus auch nachts in der Lage ist, e- Learning-Einheiten zu absolvieren.
4. E-Learning-Konzept für das Überleitungsmanagement
Im folgenden Kapitel werden die einzelnen Arbeitsschritte und Bestandteile eines e- Learning-Konzeptes für das Überleitungsmanagement erläutert. Begonnen wird mit der Definition der Zielgruppe, da diese ausschlaggebend für die Inhalte und den Aufbau der e-Learning-Einheit ist. Anschließend werden der Aufbau und die Unterscheidung von Lernzielen beschrieben sowie konkrete Lernziele und Lerninhalte für das Überleitungsmanagement definiert. Abschließend erfolgt die Entwicklung eines Konzeptes, das den Aufbau und die Inhalte der e-Learning-Einheit wiedergibt. Um Redundanzen zu vermeiden, wird bewusst auf die explizite Erstellung eines Grob- und eines Feinkonzeptes verzichtet. Es erfolgt stattdessen die zusammenfassende Darstellung und Beschreibung des fertigen Drehbuchs.
4.1 Zielgruppe
Eine e-Learning-Einheit muss immer genau auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmt sein. Entscheidende Faktoren sind die Lernfähigkeit und der Lernwille, aber auch das Vorwissen der Teilnehmer.[150] Zusätzlich sollten die Größe und die Zusammensetzung der Zielgruppe, homogen oder heterogen bezüglich verschiedender Merkmale, bestimmt werden. Bei einer sehr heterogenen Zielgruppe empfiehlt es sich gegebenenfalls verschiedene Versionen der e-Learning-Einheit zu erstellen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Ausgestaltung und Inhalte zu unspezifischer werden. Dies kann dazu führen, dass ein Teil der Gruppe überfordert und ein Teil gelangweilt ist. Beides hemmt die Motivation weiter am e-Learning teilzunehmen. Ferner können Alter, Bildungsniveau und Lernort relevante Kriterien zur Bestimmung der Zielgruppe sein. Im Falle der Entwicklung eines e-Learnings spielt die Medienkompetenz der potenziellen Teilnehmer noch eine wichtige Rolle.[151] Eine schlechte Abstimmung auf die Zielgruppe wirkt sich negativ auf die Motivation der Teilnehmer und somit auch auf den Lernerfolg aus.[152] Aus diesem Grund bezieht sich das hier entwickelte e-Learning nur auf Pflegefachkräfte im Krankenhaus und nicht zusätzlich auf Ärzte, Sozialdienst oder Personal in poststationären Einrichtungen. Für diese Zielgruppen sollten angepasste e-Learning- Einheiten erstellt werden, die spezifisch auf das dort vorhandene Fachwissen und die besonderen Gegebenheiten ausgerichtet sind.
Um ein effizientes e-Learning entwickeln zu können, muss die Zielgruppe Pflegefachkräfte zunächst hinsichtlich IT-Kenntnissen, fachlichem Vorwissen, Arbeitsrhythmus und Lernmotivation beziehungsweise Lernwille beschrieben werden. Um eine rege Nutzung des Lernangebots in dieser Zielgruppe zu erreichen, scheinen gerade diese vier Faktoren elementare Bedeutung zu haben. Andere Faktoren, wie Lernort oder Bildungsniveau, sind in der Zielgruppe homogen und eher zweitrangig, da das e-Learning grundsätzlich am Arbeitsplatz ausgeführt wird und alle Teilnehmer eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger beziehungsweise eine gleichwertige Ausbildung absolviert haben.
Die IT-Kenntnisse von teilnehmenden Pflegefachkräften müssen vorab ermittelt werden, um feststellen zu können, wie groß der Bedarf an kurzen Präsenzseminaren zur Einführung in die Nutzung von e-Learning-Einheiten ist. Bei einer eher geringen IT- Affinität der Mitarbeiter kann es sinnvoll sein, ein Blended-Learning durchzuführen, in dem sich Präsenzschulungen und e-Learning-Einheiten abwechseln.
Die Erfassung des erwarteten Vorwissens ist wichtig für den Aufbau der e-Learning- Einheit, um ein angemessenes Einstiegsniveau festzulegen. Es ist nicht sinnvoll, Wissen in das e-Learning zu integrieren, welches in der Regel bei allen Pflegefachkräften vorausgesetzt werden darf. So gibt es die Möglichkeit, zu Beginn einen Einstufungstest durchführen zu lassen[153] oder von vorneherein einen Anfänger- und einen Fortgeschrit- tenen-Kurs anzubieten. Im Rahmen des hier entwickelten e-Learnings wird auf diesen Test jedoch verzichtet, da das Vorwissen der Teilnehmer als relativ homogen eingeschätzt wird.
Ähnlich sieht es mit dem Arbeitsrhythmus aus. Wenn davon ausgegangen wird, dass Pflegefachkräfte selten länger als 20 Minuten am Stück Zeit haben, um eine e- Learning-Einheit durchzuführen, macht es wenig Sinn, Videosequenzen von 30 Minuten Länge zu integrieren. Hier ist es sinnvoller, mehrere kurze e-Learning-Abschnitte zu entwickeln, die aufeinander aufbauen, aber nicht zwingend in einem Durchgang absolviert werden müssen.
Die Lernmotivation spielt ebenfalls eine große Rolle. Ist das im e-Learning vermittelte Wissen existenziell, um weiter im Krankenhaus beschäftigt bleiben zu können, so ist die extrinsische Motivation der Mitarbeiter größer, am e-Learning teilzunehmen, als wenn es um Zusatz- oder Auffrischungskurse geht.[154] Da unklar ist, in welcher Form das hier entwickelte e-Learning später eingesetzt wird, wird versucht, die Wissensvermittlung möglichst abwechslungsreich, praxisnah und interaktiv zu gestalten.
4.2 Lernziele
Als Lernziel wird das angestrebte Lernergebnis eines Lernenden bezogen auf einen bestimmten Inhalt bezeichnet.[155]
Der folgende Teil gibt zuerst eine theoretische Einführung in die Besonderheiten von Lernzielen. Im Anschluss werden konkrete Lernziele für das e-Learning-Konzept Überleitungsmanagement beschrieben.
4.2.1 Theoretische Einführung
Jedes Lernziel wird über den Inhalt und das zu erwartende Verhalten definiert. Während unter Inhalt der zu erlernende Sachverhalt verstanden wird, bezeichnet das Verhalten die Art und Weise, wie der Inhalt angewandt werden kann. Bei dem Lernziel „Die Vor- und Nachteile von e-Learning-Einheiten im Krankenhaus erkennen“ handelt es sich bei „Die Vor- und Nachteile von e-Learning-Einheiten im Krankenhaus“ um den Inhalt, während „erkennen“ das angestrebte Verhalten beschreibt.[156] Der Verhaltensteil eines Lernziels kann weiter in drei Lernzielbereiche differenziert werden. Unterschieden wird zwischen kognitiven, affektiven und psychomotorischen Lernzielbereichen. Der kognitive Lernzielbereich bezieht sich auf den Verstand und das Wissen. Der affektive Lernzielbereich beinhaltet Änderungen im Verantwortungsbereich und in der Werthaltung, während der psychomotorische Lernzielbereich manuelle und körperliche Fähigkeiten impliziert. Die einzelnen Lernzielbereiche können nicht immer klar voneinander abgegrenzt werden, oft sind sie überlappend, wobei einer der Lernzielbereiche in der Regel überwiegt. In der Schule und im Studium sind größtenteils kognitive und affektive Lernzielbereiche zu finden, während Ausbildungen einen höheren Anteil an psychomotorischen Lernzielbereichen umfassen.
Um die verschiedenen Lernzielbereiche näher umschreiben zu können, werden die einzelnen Bereiche in Niveaustufen unterteilt. Diese Stufen werden als Lernzieltaxonomien bezeichnet.[157] Die Lernzieltaxonomien gelten sowohl für kognitive und affektive als auch für psychomotorische Lernzielbereiche und werden definiert als eine Ordnung von Verhaltensstufen, die einer bestimmten Gesetzmäßigkeit folgen. Die Lernzieltaxonomie hat vor allem im kognitiven Bereich große Bedeutung gewonnen und wird in die vier Stufen Wissen, Verstehen, Anwenden und Probleme lösen unterteilt. Während auf der Wissensstufe eine reine Reproduktion des Gelernten stattfindet, ist auf allen anderen Stufen bereits produktives Denken gefordert. Verstehen bedeutet Wissen in eigenen Worten wiedergeben und erklären zu können. Auf der Anwendungsstufe muss Gelerntes bereits auf neue, andere Sachverhalte übertragen werden können. Auf der Stufe der Problemlösung müssen verschiedene gelernte Dinge miteinander kombiniert werden. Gemäß der Lernzieltaxonomie sollen Lernziele so formuliert sein, dass sowohl Lernzielbereich als auch Verhaltensstufe erkennbar sind.[158]
4.2.2 Lernziele des e-Learning-Konzeptes Überleitungsmanagement
Im Rahmen des e-Learning-Konzeptes für das Überleitungsmanagement werden vornehmlich kognitive Lernzielbereiche auf allen Verhaltensstufen angestrebt. Im Folgenden werden die einzelnen Lernziele definiert und näher erläutert.
1. „Die Ziele des Überleitungsmanagements kennen und ihre Hintergründe verstehen.“ Die Pflegefachkraft ist in der Lage, die Ziele des Überleitungsmanagements zu nennen und die Gründe und Problematiken hinter diesen Zielen zu erklären.
2. „Die rechtlichen Rahmenstrukturen für das Überleitungsmanagement und die Integrierte Versorgung kennen.“
Die Pflegefachkraft sollte Grundkenntnisse über rechtliche Rahmenbedingungen haben, die dem Überleitungsmanagement sowie der Integrierten Versorgung zugrunde liegen. Das explizite Wissen über die jeweiligen Paragraphen ist zweitrangig; wichtiger ist, dass der Pflegefachkraft bewusst wird, dass z.B. Patienten einen gesetzlichen Anspruch auf Hilfe bei der Überleitung in eine andere Versorgungseinrichtung haben.[159]
3. „Den Expertenstandard Entlassungsmanagement anwenden und in der eigenen Einrichtung umsetzen.“
Die Pflegefachkraft kennt die einzelnen Prozessschritte sowie die Ergebnisse der einzelnen Schritte des Entlassungsmanagements. Darüber hinaus kennt sie die Grundvoraussetzungen und die Strukturen, die benötigt werden, um ein Entlassungsmanagement gemäß dem Expertenstandard durchführen zu können.
4. „VerschiedeneAssessment-Instrumente kennen und anwenden.“
Die Pflegefachkraft kennt z.B. den BRASS-Index als initiales Assessment-Instrument und z.B. den Barthel-Index als differenziertes Assessment-Instrument. Die Pflegefachkraft ist in der Lage, die entsprechenden Instrumente anzuwenden.
5. „Die wichtigsten Bestandteile eines Überleitungsbogens kennen.“
Die Pflegefachkraft kennt die wichtigsten Bestandteile des Überleitungsbogens.
6. „Arten und Vor- und Nachteile poststationärer Versorgungsmöglichkeiten kennen, an Patienten und Angehörige vermitteln sowie diese bei der Entscheidungsfindung unterstützen.“
Die Fachpflegekraft kennt verschiedene Möglichkeiten der poststationären Versorgung, wie voll- oder teilstationäre Versorgung im Pflegeheim und die Versorgung durch Angehörige in Verbindung mit einem ambulanten Pflegedienst. Sie ist in der Lage, den Patienten sowie seine Angehörigen über die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren und ihnen Vor- und Nachteile aufzuzeigen. Ferner ist sie in der Lage, die Situation und den Pflegebedarf des Patienten richtig einzuschätzen, um ihn bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen.
4.3 Lerninhalte
Um die Lernziele zu erreichen, wird ein Großteil der Inhalte aus Kapitel 2 -Überleitungsmanagement im Rahmen der Integrierten Versorgung - in das e-Learning integriert. Neben den Zielen und rechtlichen Rahmenbedingungen des Überleitungsmanagements wird intensiv auf den Expertenstandard Entlassungsmanagement und die dazugehörigen Assessment-Instrumente eingegangen.
Weitere Inhalte der Lerneinheit, die zuvor noch nicht eingehender behandelt wurden, sind der Überleitungsbogen und die Möglichkeiten der poststationären Patientenversorgung. Diese zwei Themen werden im Folgenden näher erläutert.
4.3.1 Der Überleitungsbogen
Im Überleitungsbogen werden „alle relevanten Informationen zu Pflegeproblemen, Zielen der Pflege, angewandte Pflegemaßnahmen, zum Status des Patienten, von ihm getroffene Regelungen und gegebenenfalls weitere Besonderheiten“[160] festgehalten. Dadurch wird eine hohe Transparenz hinsichtlich aller Informationen, die den Zustand und die Behandlung des Patienten betreffen, gewährleistet. Auf der Basis dieser Informationen ist eine effektive, kontinuierliche und bedarfsgerechte Behandlungsplanung sichergestellt und unnötige Rückfragen können vermieden werden. Oft sind die Überleitungsbögen verschiedener Krankenhäuser oder Haus- und Fachärzte nicht einheitlich strukturiert und beinhalten unterschiedliche Informationen. Dies kann dazu führen, dass im Überleitungsbogen Informationen fehlen, die für andere Einrichtungen wichtig sind.[161] Aus diesem Grunde ist es sinnvoll, gemeinsam mit den lokalen Leistungserbringern auf Basis der vorhandenen Überleitungsbögen neue, individuell angepasste Überleitungsbögen zu entwickeln.[162]
4.3.2 Poststationäre Versorgungsmöglichkeiten
Die Pflegefachkraft sollte, um ihre Patienten hinsichtlich poststationärer Versorgungsmöglichkeiten umfassend informieren zu können, genaue Kenntnisse über verschiedene Betreuungs- und Unterstützungsangebote in ihrer Region haben.[163]
[...]
[1] Vgl. Bundesärztekammer [2010], S. 5.
[2] DNQP [2009], S. 10.
[3] Vgl. Möller [2007], S. 376.
[4] Vgl. Bundesärztekammer [2010], S. 5.
[5] DNQP [2009], S. 10.
[6] Vgl. Möller [2007], S. 376.
[7] Die Budgetdeckelung wurde 1993 eingeführt und sollte der drohenden Kostensteigerung der Krankenkassen entgegenwirken. Die Koppelung der jährlichen „Budgeterhöhungen für Krankenhäuseran die Entwicklung der beitragspflichtigen Einnahmen dergesetzlichen Krankenkassen“ (Roth [2011], S. 22.) begrenzt jedoch bis heute die Einnahmemöglichkeiten der Krankenhäuser. (Vgl. Roth [2011], S. 22.)
[8] Vgl. Rabe [2009], S. 43f.
[9] Zur sprachlichen Vereinfachung und damit zur verbesserten Lesbarkeit wird im Text lediglich eine Geschlechtsform verwendet. Das jeweils andere Geschlecht ist ausdrücklich mit gemeint.
[10] Vgl. Barmer GEK [2010].
[11] Vgl. Birkner [2008], S. 127f.
[12] Vgl. Fischer [2012], S. 58f.
[13] Vgl. Bundesärztekammer [2010], S. 5.
[14] Vgl. Schneider [2006], S. 57f.
[15] „Von der Schnittstellenproblematik spricht man, wenn es zu Informationsverlusten oder fehlerhaften Informationen bei der Zusammenarbeit von Personen innerhalb einer oder zwischen verschiedenen Berufsgruppen und Institutionen kommt. Dies geht in der Regel mit erhöhtem Arbeitsaufwand und erhöhten Kosten einher.“ (Messer [2008], S. 59.)
[16] Vgl. Schneider [2006], S. 60.
[17] Vgl. Menche [2011a], S. 52.
[18] „Der Drehtüreffekt bezeichnet die erneute Aufnahme eines Patienten mit derselben Diagnose, nachdem er das Krankenhaus erst kurz zuvor verlassen hat.“ (Dangel [2004], S. 1.)
[19] Vgl. Möller [2007], S. 376.
[20] Vgl. Dangel [2004], S. 1f.
[21] Vgl. Blum/Offermanns/Perner [2007], S. 74f.
[22] „Diagnosebezogene Fallgruppen (DRGs): DRGs sind ein Patientenklassifikationssystem, das in einer klinisch relevanten und nachvollziehbaren Weise Art und Anzahl der behandelten Krankenhausfälle in Bezug zum Ressourcenverbrauch des Krankenhauses setzt.“ (InEK [2011], S. 1.).
[23] Vgl. Mühlbauer [2004], S. 9.
[24] Vgl. Warmbrunn [2006], S. 29.
[25] Vgl. Ballsieper/von Reibnitz/Lemm [2012], S. 2.
[26] Vgl. Schneider [2006], S. 53.
[27] Vgl. Warmbrunn [2006], S. 29.
[28] „Die Medizinischen Dienste beraten die gesetzliche Kranken- und Pflegekassen in Fragen der allgemeinen medizinischen und pflegerischen Versorgung und begutachten im Einzelfall.“ (MDK [o.J.])
[29] Vgl. Menche [2011a], S. 52.
[30] Vgl. Schneider [2006], S. 60.
[31] Vgl. Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. [2004], S. 39.
[32] Vgl. Dangel [2004], S. 8.
[33] Vgl. Jauch [2007], S. 569.
[34] Vgl. Dangel [2004], S. 1.
[35] Vgl. Ballsieper/von Reibnitz/Lemm [2012], S. 2.
[36] Vgl. Schneider [2006], S. 57f.
[37] Vgl. Schneider [2006], S. 58.
[38] Im Rahmen dieser Arbeit wird nicht genauer zwischen den beiden Begriffen differenziert. Auch Begriffe wie Pflegeüberleitung und Versorgungsmanagement werden aufgrund ungenauer oder überlappender Definitionen weitgehend synonym verwandt.
[39] Vgl. Menche [2011a], S. 52.
[40] Vgl. Ohnimus/Schellerer [2005], S. 59.
[41] Vgl. Moers/Schiemann [2008], S. 322.
[42] Vgl. Menche [2011b], S. 28.
[43] Vgl. Ballsieper/von Reibnitz/Lemm [2012], S. 2.
[44] Vgl. Buhr/Müller/Braun/Klinke/Rosenbrock [2008], S. 9.
[45] Vgl. Schneider [2006], S. 57f.
[46] Vgl. Menche [2011a], S. 56.
[47] „Als Compliance bzw. Non-Compliance wird das Befolgen oder Nicht-Befolgen ärztlicher/pflegerischer Anordnungen im Sinne von therapiekonformen Krankheitsverhalten bezeichnet“ (Kulbe [2009], S. 43.)
[48] Vgl. Schnura/Müller-Schoppen [2009], S. 139.
[49] Vgl. Menche [2011a], S. 56.
[50] Vgl. Hauke/Bauer/Holzer [2007], S. 161f.
[51] Vgl. Bauer [2007], S. 360.
[52] Vgl. Ballsieper/von Reibnitz/Lemm [2012], S. 8.
[53] Vgl. Menche [2011a], S. 56.
[54] Vgl. Schneider [2006], S. 57f.
[55] Vgl. Schneider [2006], S. 65f.
[56] Vgl. Amelung/Lägel [2008], S. 43.
[57] Vgl. Bundesministerium für Gesundheit [2010a].
[58] Vgl. Bertram [2005], S. 46.
[59] Vgl. Dahme/Wohlfahrt [2007], S. 75.
[60] Vgl. Greiling/Dudek [2009], S. 5.
[61] Vgl. Bundesministerium für Gesundheit [2010b].
[62] Vgl. § 11 Abs. 4 SGB V.
[63] Vgl. § 112 Abs. 1 SGB V.
[64] Vgl. § 115 SGB V.
[65] Vgl. Bohle [2008], S. 1f.
[66] Bundesministerium für Gesundheit [2010a].
[67] Vgl. §§ 140a und 140b Abs. 3 SGB V.
[68] Vgl. Bundesministerium für Gesundheit [2010a].
[69] Vgl. Bundesministerium für Gesundheit [2012], S. 2.
[70] Vgl. Bundesministerium für Gesundheit [2010b].
[71] Als Pflegeberater werden Pflegefachkräfte, Sozialversicherungsfachangestellte oder Sozialarbeiter mit entsprechender Zusatzqualifikation bezeichnet. (Vgl. Bundesärztekammer [2010], S. 7.)
[72] Vgl. § 7a SGB XI.
[73] Vgl. § 45 SGB XI.
[74] Pflegepersonen im Sinne des SGB XI sind Personen, die nicht erwerbsmäßig einen Pflegebedürftigen wenigstens 14 Stunden wöchentlich in seiner häuslichen Umgebung pflegen (Vgl. § 19 SGB XI).
[75] Vgl. Simon [2010], S. 333.
[76] Vgl. Schmidt [2009], S. 4.
[77] Vgl. Andreae/Weniger [2006], S. 63.
[78] Vgl. Ballsieper/Lemm/von Reibnitz [2012], S. 10.
[79] Menche [2011a], S. 52.
[80] Vgl. Hein [2011], S. 6.
[81] Vgl. DNQP [2009], S. 8.
[82] Vgl. Andreae/Weniger [2006], S. 63.
[83] Vgl. Andreae/Weniger [2006], S. 63.
[84] Vgl. Menche [2011a], S. 52.
[85] Vgl. Dangel [2004], S. 7.
[86] Vgl. Menche [2011a], S. 52.
[87] Vgl. DNQP [2009], S. 10.
[88] DNQP [2009], S. 10.
[89] Schmidt [2009], S. 44.
[90] Vgl. Schmidt [2009], S. 44.
[91] Vgl. von Reibnitz [2009], S. 56.
[92] Vgl. Ballsieper/Lemm/von Reibnitz [2012], S. 117.
[93] Vgl. Menche [2011b], S. 46.
[94] Vgl. Krankenhaus Göttlicher Heiland [o.J.], S. 2.
[95] Vgl. Hunt [2009], S. 209f.
[96] Aktivitäten des täglichen Lebens
[97] Vgl. Menche [2011a], S. 53.
[98] Vgl. Menche [2011a], S. 54.
[99] Vgl. Menche [2011a], S. 55.
[100] Der Pflegebericht beschreibt den Pflegeverlauf des Patienten und beinhaltet alle wichtigen Informationen, die benötigt werden, um seinen momentanen Zustand sowie seinen Pflegeverlauf zu verstehen. (Vgl. Schrimpf/Becherer/Ott [2011], S. 76.)
[101] Vgl. Menche/Klare [2005], S. 23.
[102] Vgl. DNQP [2009], S. 10.
[103] Vgl. Menche [2011a], S. 55.
[104] Vgl. Ballsieper/Lemm/von Reibnitz [2012], S,
[105] Vgl. von Reibnitz [2009], S. 178.
[106] Vgl. Offermanns [2011], S. 48f.
[107] Vgl. Rey [2009], S. 15.
[108] Vgl. Dittler [2011], S. 206.
[109] Vgl. Herzig-Walch [2009], S. 60.
[110] z.B. in Großbritannien, den USA, den Skandinavischen Ländern und den Niederlanden (Vgl. HerzigWalch [2009], S. 60.)
[111] Vgl. Herzig-Walch [2009], S. 60.
[112] Vgl. Höfert [2011], S. 122f.
[113] Vgl. Schmidt [2011], S. 14.
[114] Vgl. Kellner [2011], S. 2.
[115] Vgl. Meier [2006], S. 60.
[116] Eine Umfrage des Statistischen Bundesamtes ergab, dass bereits 55 % der deutschen Großunternehmen e-Learning, zumindest in Teilen des Unternehmens, einsetzen. (Vgl. Statista [2010])
[117] Vgl. Karl [2009], S. 17.
[118] Vgl. Treumann/Ganguin/Arens [2012], S. 39.
[119] Vgl. Letzas [2003], S. 13.
[120] Vgl. Karl [2009], S. 24.
[121] Vgl. Karl [2009], S. 24.
[122] Vgl. Moriz [2008], S. 18.
[123] Vgl. Moriz [2008], S. 18.
[124] Vgl. Mispelbaum [2008], S. 31 f.
[125] Vgl. Karl [2009], S. 25.
[126] Vgl. Moriz [2008], S. 21.
[127] Vgl. Czerwionka/Klebl/Schrader [2009], S. 96.
[128] Vgl. Roche [2008], S. 101.
[129] Vgl. Neuhoff/Fricke [2007], S. 48.
[130] Vgl. Moriz [2008], S. 22.
[131] Vgl. Weber [2008], S. 34.
[132] Vgl. Weber [2008], S. 35f.
[133] Vgl. Weber [2008], S. 36f.
[134] Vgl. Weber [2008], S. 34.
[135] Vgl. Weber [2008], S. 37.
[136] Vgl. Weber [2008], S. 37.
[137] Vgl. Mair [2005], S. 4.
[138] Vgl. Mair [2005], S. 5.
[139] Vgl. Mair [2005], S. 6.
[140] Vgl. Niegemann/Hessel/Hochscheid-Mauel/Aslanski/Deimann/Kreuzberger [2004], S. 291.
[141] Niegemann/Hessel/Hochscheid-Mauel/Aslanski/Deimann/Kreuzberger [2004], S. 291.
[142] Vgl. Mayer [2010], S. 17.
[143] Vgl. Mayer [2010], S. 17f.
[144] Vgl. Mayer [2010], S. 18.
[145] Vgl. Letzas [2003], S. 67.
[146] Vgl. Thiry/Bryant [2008], S. 111.
[147] Vgl. Weber [2008], S. 38.
[148] Vgl. Sommer [2004], S. 26.
[149] Vgl. Menche [2011a], S.61.
[150] Vgl. Hesselmann [2011], S. 401f.
[151] Vgl. Mair [2005], S. 49.
[152] Vgl. Kerres [2001], S. 135.
[153] ' Vgl. Popp [2006], S. 157.
[154] Dies ist in diesem Rahmen nicht wissenschaftlich belegt. Grundsätzlich ist aber anzunehmen, dass freiwillige Angebote seltener in Anspruch genommen werden als Pflichtkurse. Mitarbeiter, die freiwillig an einem Angebot teilnehmen, werden dies wahrscheinlich mit einer höheren intrinsischen Motivation tun als Teilnehmer, die hierzu verpflichtet werden.
[155] Vgl. Schelten [2004], S. 200.
[156] Vgl. Schelten [2004], S. 200.
[157] Vgl. Schelten [2004], S. 201.
[158] Vgl. Schelten [2004], S. 202.
[159] Vgl. § 11 Abs. 4 SGB V.
[160] Menche [2011a], S. 54.
[161] Vgl. Menche/Klare [2005], S. 23.
[162] Vgl. Maikranz-Boenig/Beul [2008], S. 68.
[163] Vgl. Schmidt [2009], S. 39.