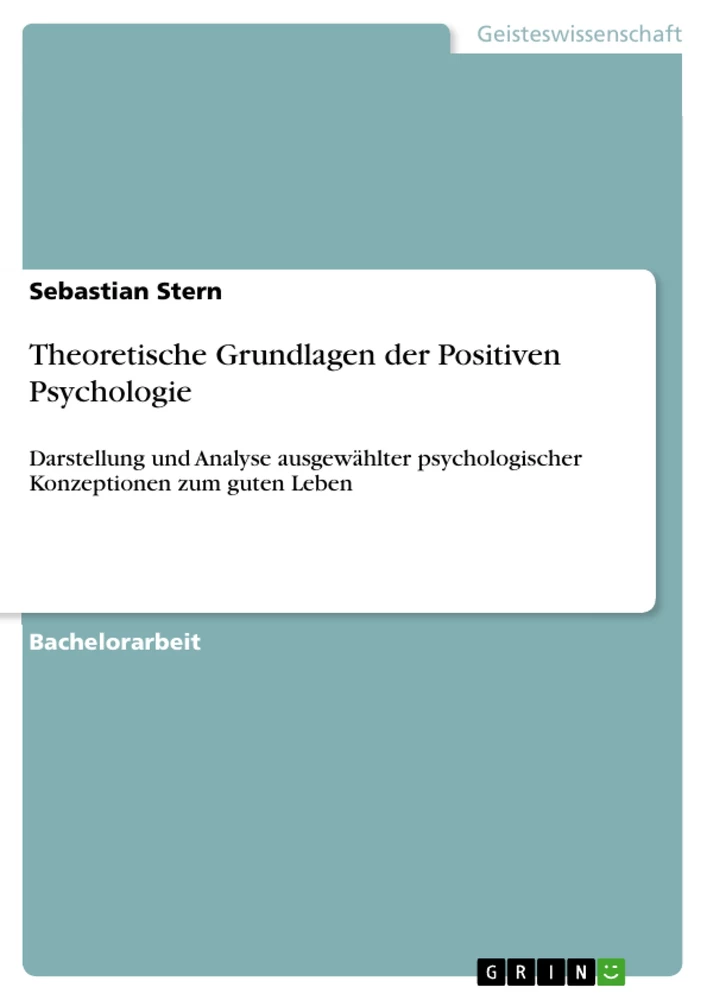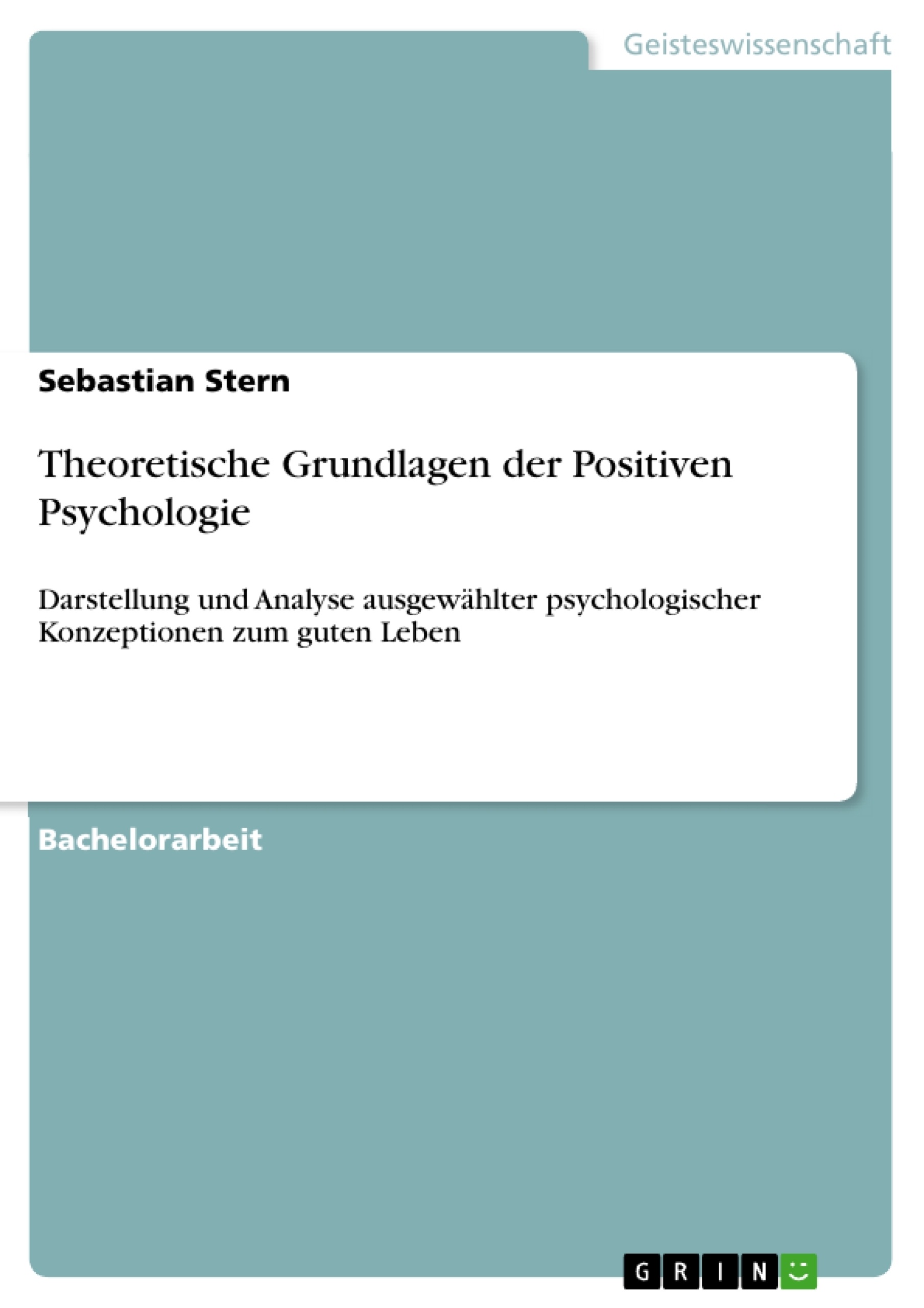Die Geschichte der Psychologie, seit dem Ende des ersten Weltkrieges, entwickelte sich in eine einseitige Richtung. Von den drei ursprünglichen Aufgaben der Psychologie, nämlich der Heilung von Krankheiten, dem Erkennen und Fördern von Talenten und dem Versuch mehr Erfüllung in das Leben von Menschen zu bringen, blieb nur erstere übrig. Diese Entwicklung war zu Anfang eine Reaktion auf die Rückkehr traumatisierter amerikanischer Soldaten aus dem ersten Weltkrieg, deren Leiden es zu heilen oder zumindest zu mindern galt. Durch die Gründung des „United States Department of Veterans Affairs“ (VA) und dem „National Institute of Mental Health“ (NIMH) war es leichter Fördergelder für die Erforschung psychischer Leiden zu akquirieren, als für die Forschung an anderen relevanten Gebieten der Psychologie (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).
Die Humanistische Psychologie, die als Die Humanistische Psychologie, die als Gegenpol zu den defizitorientierten Strömungen des Behaviorismus und der Psychoanalyse zu verstehen ist, stellte Mitte des zwanzigsten
Jahrhunderts das Individuum wieder in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses. Die Humanpsychologen, zum Beispiel Carl Rogers und Abraham Maslow, gingen davon aus, dass der Mensch neben vier Mangelbedürfnissen (Physiologische Bedürfnisse, Bedürfnis nach Sicherheit, Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Bedürfnis nach (Selbst-)
Wertschätzung) auch ein Wachstumsbedürfnis hat, das, nach dessen Befriedigung, zur Selbstverwirklichung führt (Quittmann, 1996, S. 229). An dieser Stelle lässt sich die Humanistische Psychologie als Grundlage für das Entstehen der Positiven Psychologie verstehen, da die Positive Psychologie den Ansatz des individuellen Wachstums, das Aufblühen von Personen (zum Beispiel durch das Erkennen und Ausbilden von Charakterstärken) wieder aufgreift. Neben den diversen Ähnlichkeiten dieser beiden Strömungen, unterschieden sie sich sich in drei Punkten gravierend: Erstens befasst sich die Positive Psychologie nicht nur mit individuellem Wohlbefinden, sondern erachtet das kollektive Wohlbefinden in gleichem Maße als wichtig. Des weiteren versteht sich die Positive Psychologie als empirische Wissenschaft, die anhand bewährter Messmethoden fundierte Ergebnisse über das menschliche Wohlbefinden erzielen möchte. [...]
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Traditionelle Glückstheorien
1.2 Subjektives und Psychologisches Wohlbefinden
2 Die Theorie des authentischen Glücks
2.1 Kritik an der Theorie des authentischen Glücks
3 Die Theorie des Wohlbefindens - PERMA
3.1 Positive Gefühle
3.1.1 Gefühle, Affekte, Emotionen und Stimmungen - Eine Begriffsdefinition
3.1.2 Die Geschichte der Positiven Gefühle
3.1.3 Was bedeuten Positive Gefühle für die Positive Psychologie?
3.1.4 Die Grenzen der Positiven Gefühle
3.1.4.1 Positive Affektivität
3.1.4.2 Die Hedonistische Tretmühle
3.1.5 Positive Gefühle in drei Zeitebenen
3.1.5.1 Die Vergangenheit in positivem Licht
3.1.5.2 Der optimistische Blick in die Zukunft
3.1.5.3 Postive Gefühle und Handlungen in der Gegenwart
3.1.6 Wer ist glücklich?
3.1.7 Positive Gefühle mehren
3.1.8 Interventionen
3.2 Engagement
3.2.1 Belohnungen schlagen Vergnügen: Der Flow
3.2.1.1 Die Komponenten des Flow
3.2.1.2 Die Schattenseite des Flow
3.2.2 Charakterstärken
3.2.2.1 Die Definition der Charakterstärken
3.2.2.2 VIA Klassifikationen der Charakterstärken
3.2.2.3 Die Messung der Charakterstärken
3.2.2.4 Bedeutende empirische Erkenntnisse
3.3 Positive Beziehungen
3.3.1 Die Theorie der Gleichheit
3.3.2 Die Bindungstheorie
3.3.3 Klassifikationen von Beziehungen
3.3.4 Positive Institutionen
3.3.4.1 Die Familie
3.3.4.2 Die Schule
3.3.4.3 Interaktionen und Spannungen zwischen Schule und Familie
3.3.5 Schlussfolgerung
3.4 Sinn
3.4.1 Was ist Sinn?
3.4.2 Mihaly Csikszentmihalyi - Sinn als Harmonie
3.4.3 Viktor Frankl - Drei Wege zum Sinn
3.5 Zielerreichung
3.6 Fazit
4 Literaturverzeichnis