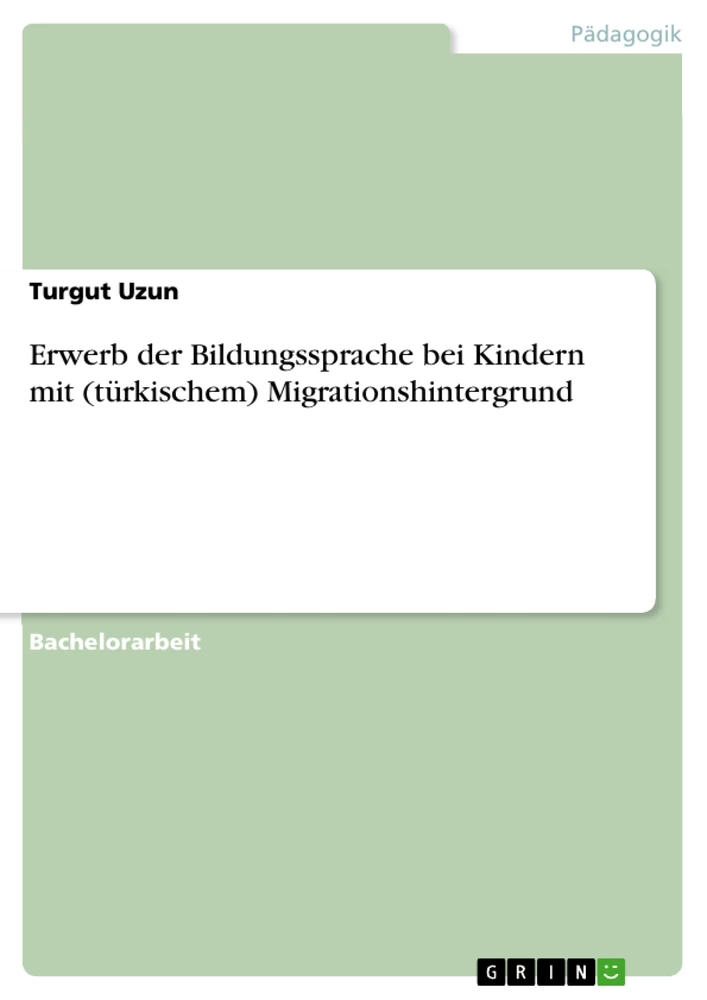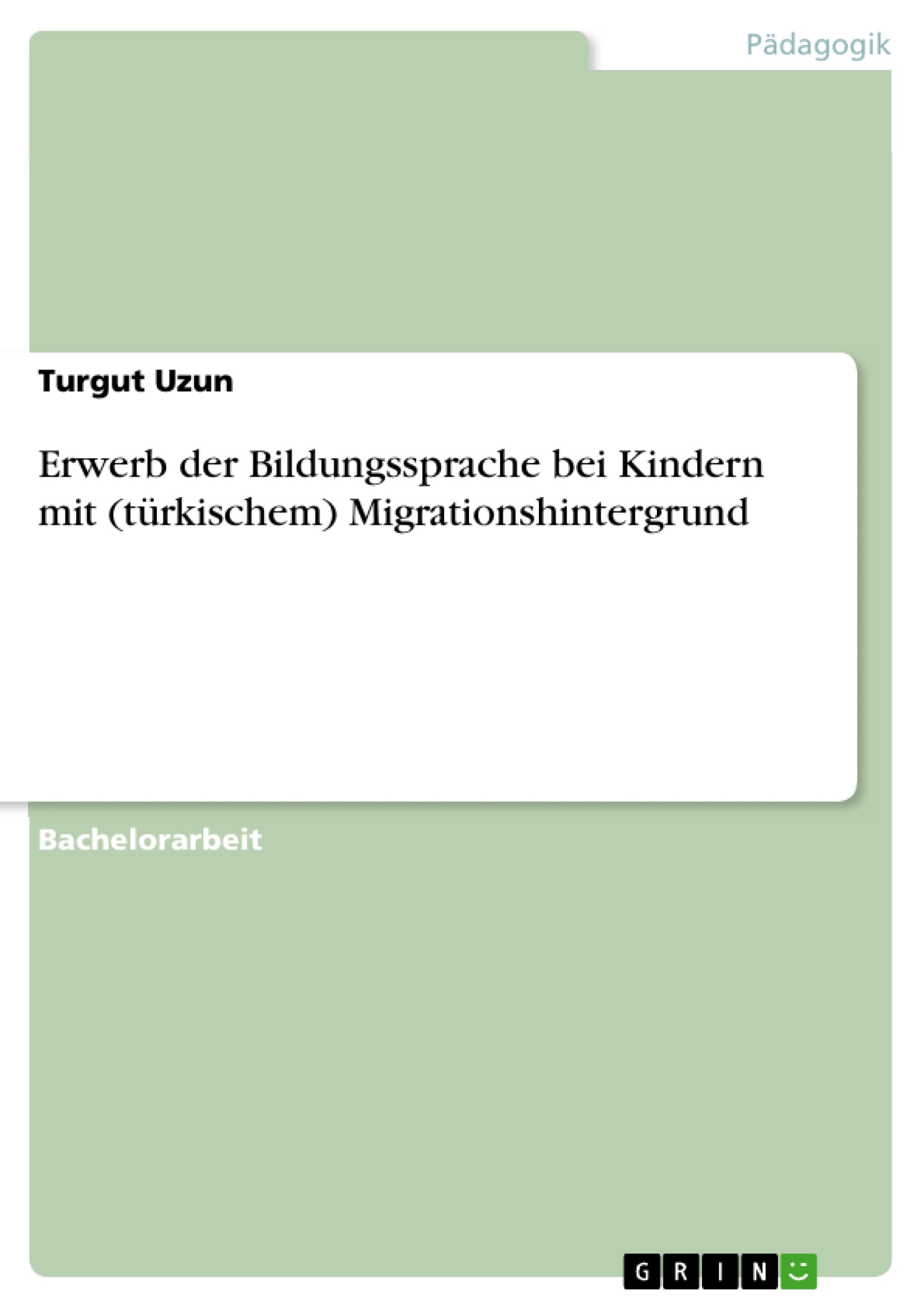Diese Arbeit wird sich mit den Erwerbsbedingungen der Bildungssprache von Kindern mit Migrationshintergrund beschäftigen. Im Einzelnen wird darauf eingegangen, welche Hürden es gibt und welche Konsequenzen sich daraus
ergeben. Der Migrationshintergrund, der eine wichtige Bedeutung in dieser Arbeit darstellt, wird in allen Einzelheiten diskutiert. Zunächst wird die allgemein aktuelle Lage und die Wirkung von Migration auf Bildung anschließend die Bildungssprache ausgearbeitet und behandelt. Das Thema ist eng verbunden mit dem Gebiet
DaZ-Deutsch als Zweitsprache, jedoch wird es im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt, weil es ansonsten den Umfang der Arbeit sprengen würde.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Migration
2.1 Erläuterungen zu Migration
2.2 Definition - Migration
2.3 Migration – aktueller Zustand
3. Migration und Bildung
3.1 Ungleichheiten im Bildungssystem
3.2 Gegebenheiten im Bildungsalltag
3.3 Benachteiligungen im Bildungssystem
4. Spracherwerb
5. Bildungssprache
5.1 Definition - Bildungssprache
5.2 Wissenschaftlicher Bezug
5.3 Merkmale der Bildungssprache
6. Erwerb der Bildungssprache
6.1 Anforderungen der Schule
6.2 Erwerbsprobleme und allgemeine Schwierigkeiten
6.2.1 Leistungsunterschiede in der Sprachproduktion
6.2.2 Leistungsunterschiede im Hörverstehen
6.2.3 Auswertung
6.3 Möglichkeiten zur Förderung
7. Fazit
8. Literaturverzeichnis