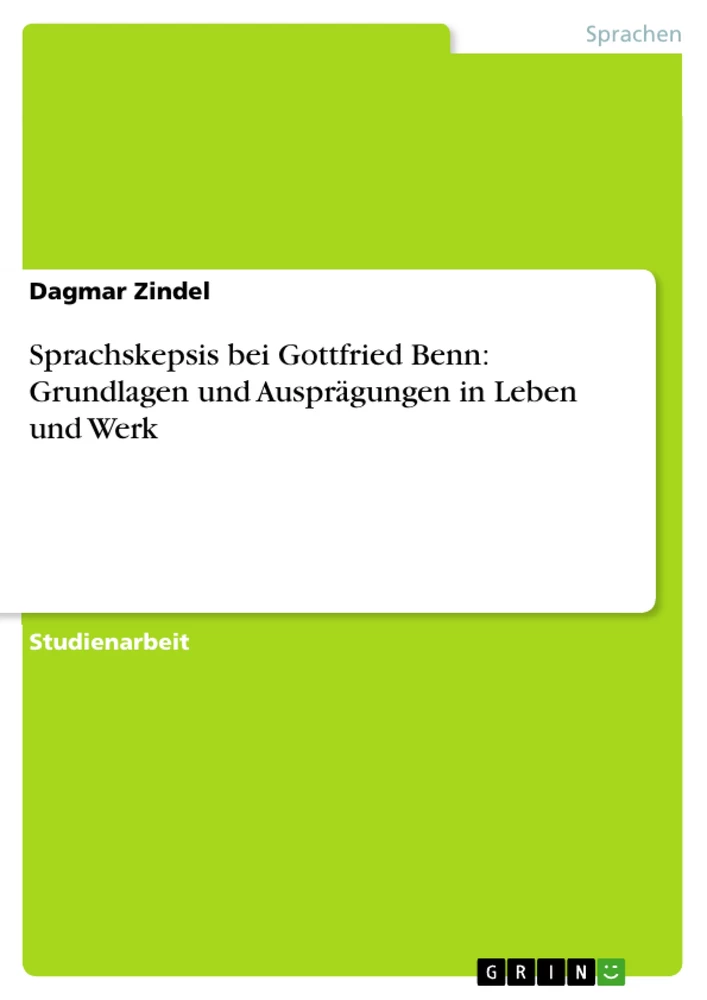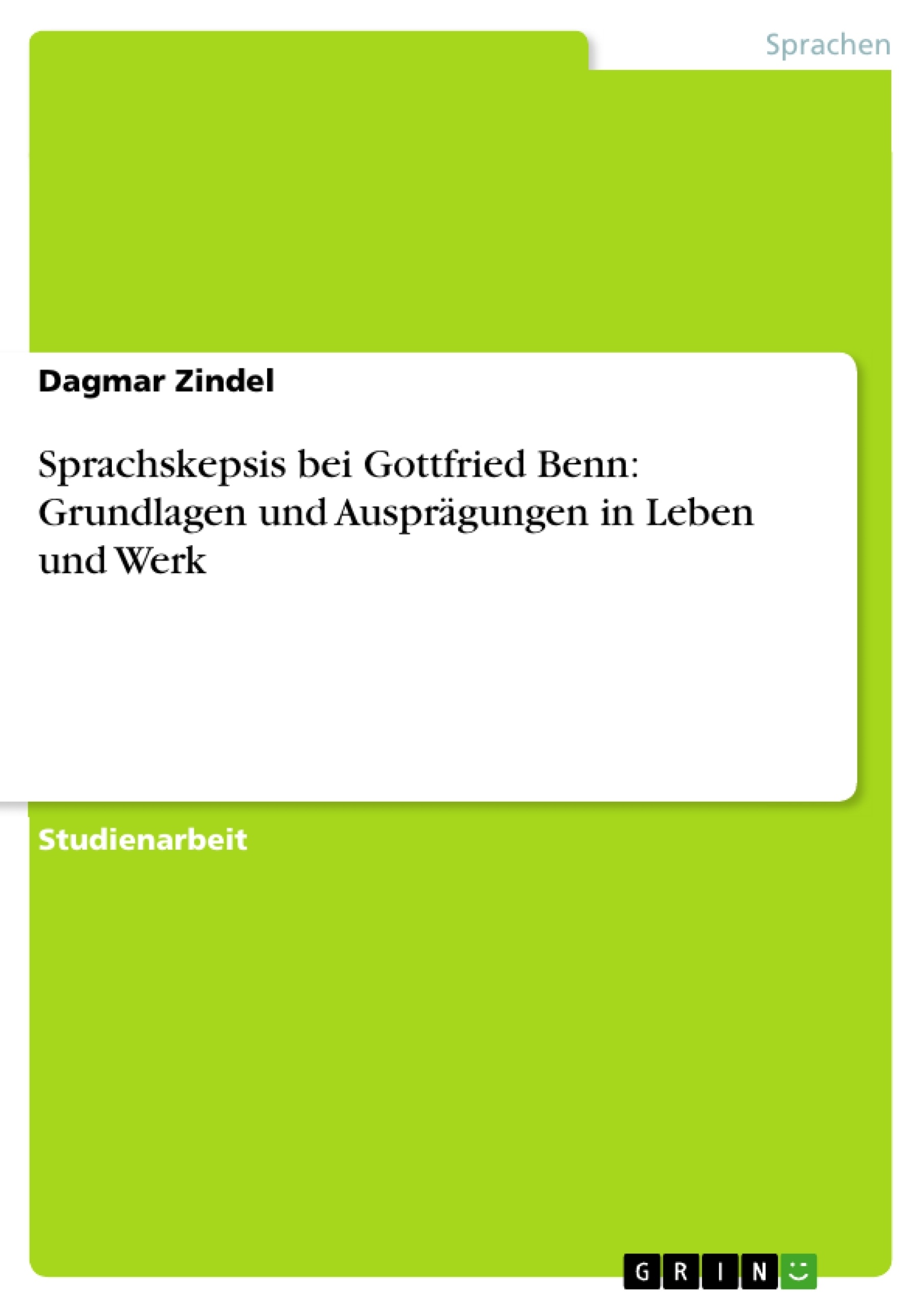Die gesellschaftlichen, geisteswissenschaftlichen und technischen Entwicklungen um 1900 führen zu einem Phänomen der Orientierungslosigkeit, einem Zustand, in dem althergebrachte Erklärungs- und Deutungsmuster nicht mehr gültig erscheinen und „die Welt […] kein verläßliches Gefüge mehr“ bildet. Vor diesem Hintergrund entwickelt sich eine neue Form von Sprachskepsis, die die labile Beziehung zwischen Ich und Wirklichkeit widerspiegelt: Sprache sei ebenso nicht selbstverständlich und künstlich wie die Wirklichkeit selbst. So wird denn die Adäquationstheorie, die von einer Übereinstimmung von wahrnehmbarer Welt, erkennendem Geist und darstellender Sprache ausgeht, abgelehnt. Die moderne Sprachskepsis bleibt jedoch kein literaturwissenschaftliches Phänomen, sondern spiegelt die gesellschaftliche Wirklichkeit und entfaltet philosophische Diskurse.
Gottfried Benn gilt als einer der bedeutendsten Dichter der literarischen Strömung des Expressionismus. Durchaus in der Tradition der literarischen Strömung ist Benns literarisches Werk durch eine besondere Sprachverwendung gekennzeichnet: sie ist, im Gegensatz zur traditionellen literarischen Sprachverwendung, nicht auf Harmonie und Wohlklang ausgelegt, markiert also einen Bruch zur ästhetisierten Dichtungssprache. Seine enge Verbindung zu Friedrich Nietzsche und einige seiner literarischen Werke, so z.B. das 1948 erschienene Gedicht Ein Wort , lassen vermuten, dass mit der Benn eigenen Sprachverwendung eine tiefe Sprachskepsis einhergeht. Im Jahr 1935 konstatiert Benn jedoch, dass die Sprachkrise Ausdruck der Krise des Menschen und somit nur eine Erscheinungsform der Sinnkrise sei. Hiermit bestätigt er einerseits den bereits beschriebenen Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen und Entwicklungen und Sprachskepsis, andererseits lässt diese Aussage aber auch Zweifel an tatsächlich sprachskeptischen Tendenzen bei Benn zu.
Die Benn-Forschung ist umfangreich und kaum überschaubar. Gerade wurde von Marcus Hahn ein umfassendes Werk zu Benn und der Wissenschaftsgeschichte vorgelegt, was die bisherige Forschung bei all ihrem Umfang dennoch um einige neue Aspekte bereichert. Allerdings bleiben die Aussagen zu Benns Haltung zum Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit in Relation zum Umfang der Forschung dürftig, was nicht zuletzt darauf hinweist, dass dies kein eindeutiges, klar zu benennendes ist. Fraglich ist also, ob Benn als bekannter Nietzsche-Adept tatsächlich auch...
Inhalt
1 Einleitung
2 Moderne Sprachskepsis
2.1 Allgemeines
2.2 Sprachskepsis bei Nietzsche
3 Sprachskepsis bei Gottfried Benn
3.1 Benns Sprachskepsis – Merkmale und Ausprägungen
3.2 Bezüge zu Nietzsche
3.3 Sprachskepsis in Benns literarischem Werk
4 Fazit
Literaturverzeichnis
„Es ist heute tatsächlich so, es gibt nur zwei verbale Transzendenzen: die mathematischen Lehrsätze und das Wort als Kunst. Alles andere ist Geschäftssprache, Bierbestellung.“[1]