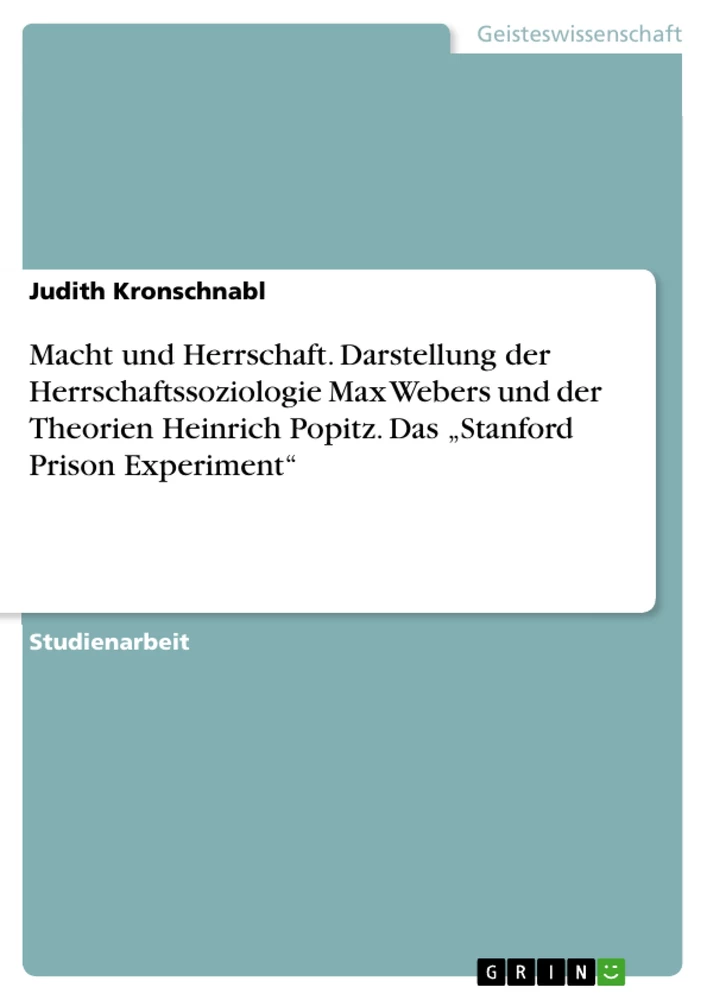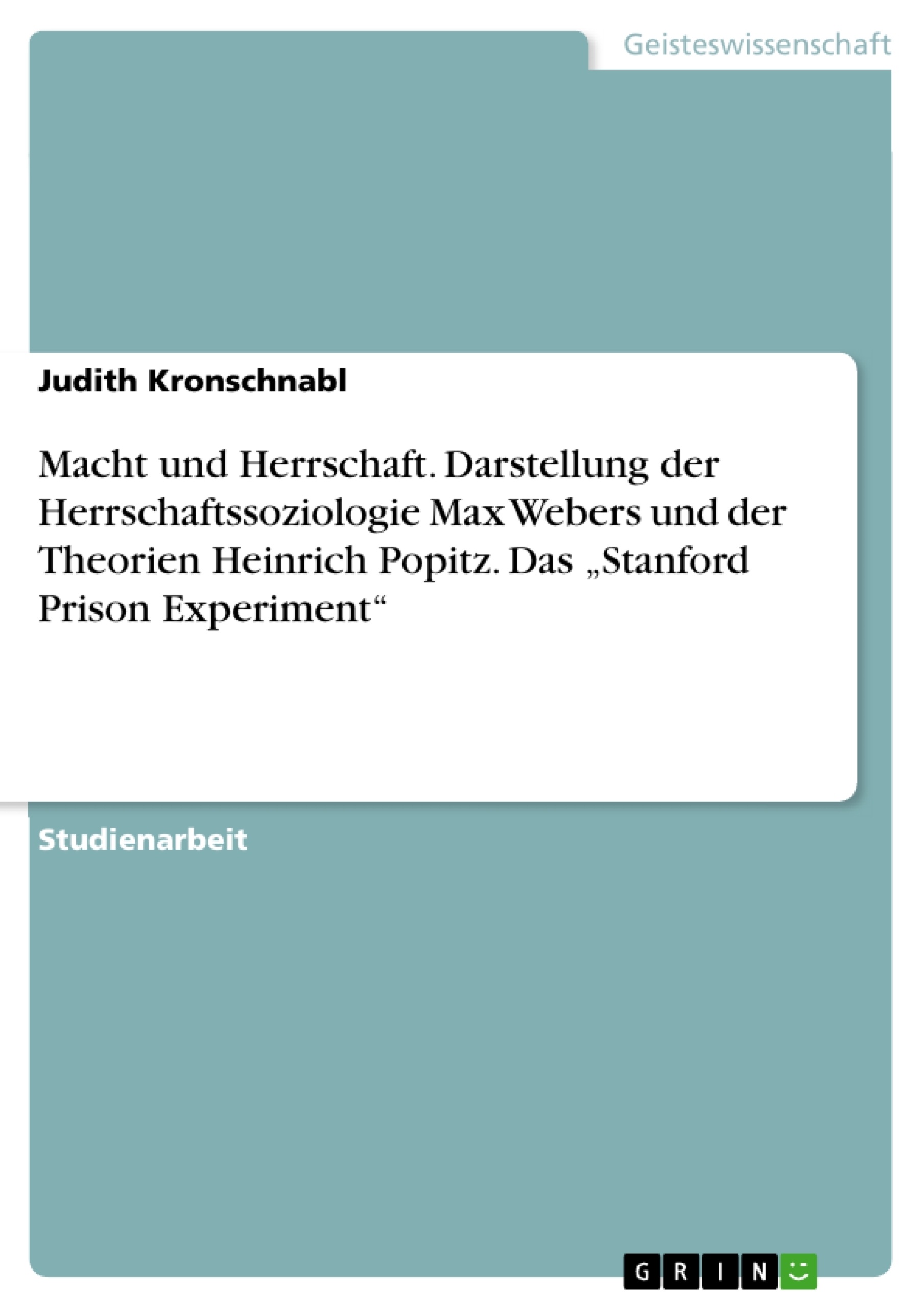„Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht.“ (Weber 1922, S.28). Diese Definition Webers ist die wohl bekannteste und gebräuchlichste Definition von Macht. Doch wie lässt sich diese Chance auch gegen den Willen einer Überzahl erfolgreich durchsetzten? Kurz gesagt: Wie gelingt es Wenigen, Macht über Viele auszuüben, selbst wenn dies zu deren Nachteil geschieht? Wie konstituiert sich Macht und welche Machtformen gibt es?
Um die Betrachtung des Machtbegriffs zur Beantwortung dieser Fragen in einem überschaubaren Rahmen zu halten, sollen im Folgenden die von Weber entwickelten Typologien der Herrschaft nur kurz erläutert werden, um dann genauer auf Heinrich Popitz weiterführenden Überlegungen zur Institutionalisierung von Macht und zu den Prozessen der Machtbildung eingehen zu können.
Letzteres soll dem Leser zum Ende dieser Hausarbeit anhand des 1971 an der Universität Stanford von dem Psychologen Phillip Zimbardo durchgeführten Gefängnis-Experiments verdeutlicht werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Max Weber – Die Typen der Herrschaft
2.1. Legale Herrschaft mit bürokratischem Verwaltungsstab
2.2. Traditionale Herrschaft
2.3. Charismatische Herrschaft
3. Heinrich Popitz – Phänomene der Macht
3.1. Prämissen der Problematisierung von Macht
3.2. Anthropologische Grundformen der Macht
3.3. Stufen der Institutionalisierung von Macht
4. Prozesse der Machtbildung - The Stanford Prison Experiment
5. Schlussbemerkungen
6. Literaturverzeichnis