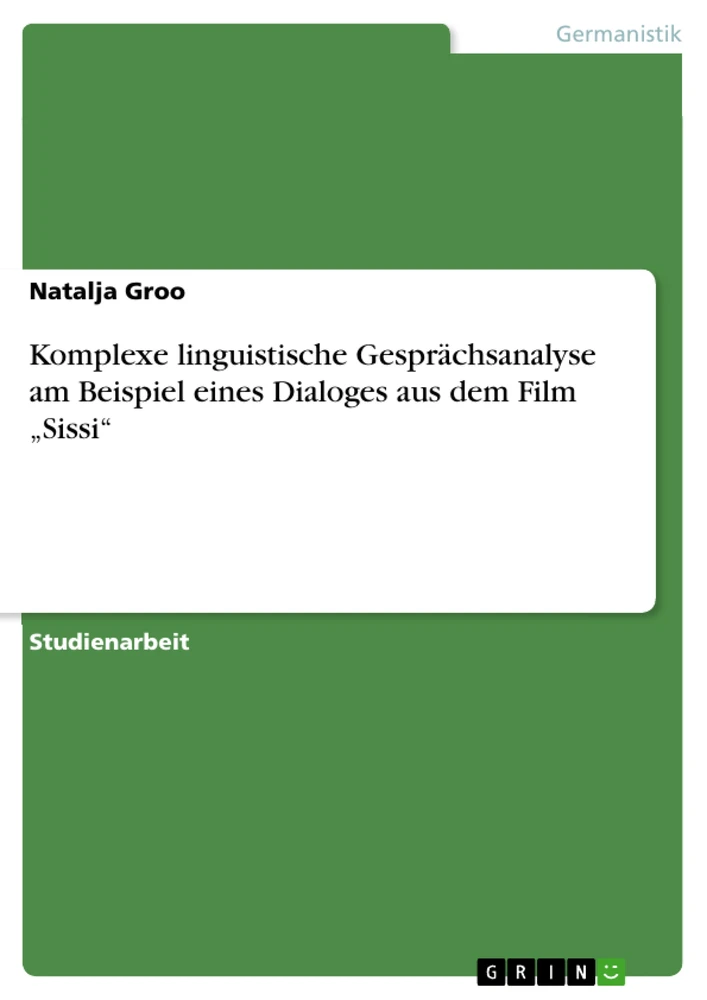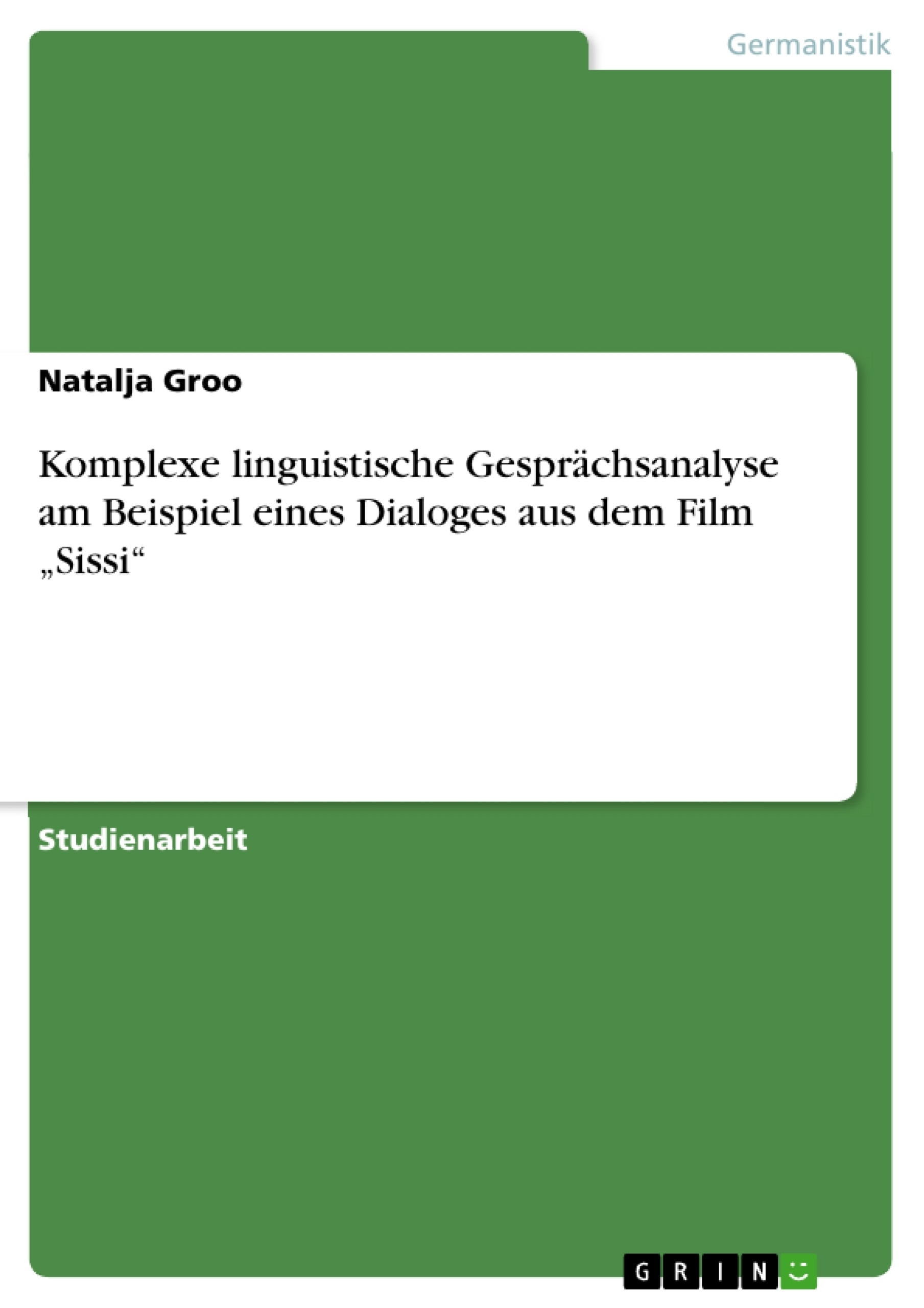In der vorliegenden Arbeit möchte ich ein inszeniertes Gespräch aus dem bekannten Film des Jh. „Sissi“ unter gesprächsanalytischen Gesichtspunkten analysieren. Die Bedeutung dieser Szene, dieses Dialogs für den gesamten Film, die persönlichen Entwicklungen der Figuren, aber auch die Aktualität der Sprache sollen bei dieser Analyse irrelevant sein. Gleich nach dem ersten Anhören des ausgewählten Gesprächs, war mir klar, dass die Gesprächspartnerverhältnisse einen ungleichen sozialen Charakter tragen. Aber welche sprachlichen Merkmale haben mich auf diese Folgerung gestoßen? Dank welcher Mittel empfinde ich das Gespräch als asymmetrisch? Das Ziel dieser Analyse ist, mittels soziopragmatischen Kategorien Antworten auf diese Fragen zu finden. Interessant wäre für mich auch, die Besonderheiten eines inszenierten Gesprächs auszuarbeiten. Als Grundlage für die Gesprächsanalyse werden Erarbeitungen aus dem Seminar und vor allem gesprächsanalytische Aspekte nach Henne und Rehbock dienen.
Inhaltsangabe
Einleitung
I Soziologische und pragmatische Situierung des Gesprächs
II Das Gespräch zwischen Kaiserin vonösterreich und Sissi in gesprächsanalytischer Notation
III Die Makrostruktur des Gesprächs
III.1 Die Anfangsphase des Gesprächs
III.2 Die Gesprächsmitte
III.3 Die Beendigungsphase
IV Die Meso- und Mikroebene des Gesprächs
Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Einleitung
In der vorliegenden Arbeit möchte ich ein inszeniertes Gespräch aus dem bekannten Film des 20. Jh. „Sissi“ unter gesprächsanalytischen Gesichtspunkten analysieren. Die Bedeutung dieser Szene, dieses Dialogs für den gesamten Film, die persönlichen Entwicklungen der Figuren, aber auch die Aktualität der Sprache sollen bei dieser Analyse irrelevant sein.
Gleich nach dem ersten Anhören des ausgewählten Gesprächs, war mir klar, dass die Gesprächspartnerverhältnisse einen ungleichen sozialen Charakter tragen. Aber welche sprachlichen Merkmale haben mich auf diese Folgerung gestoßen? Dank welcher Mittel empfinde ich das Gespräch als asymmetrisch? Das Ziel dieser Analyse ist, mittels soziopragmatischen Kategorien Antworten auf diese Fragen zu finden. Interessant wäre für mich auch, die Besonderheiten eines inszenierten Gesprächs auszuarbeiten.
Als Grundlage für die Gesprächsanalyse werden Erarbeitungen aus dem Seminar und vor allem gesprächsanalytische Aspekte nach Henne und Rehbock dienen.
I Soziologische und pragmatische Situierung des Gesprächs
Henne und Rehbock unterscheiden bei ihrer Gesprächsanalyse drei Hauptebenen1: die Makroebene („Gesprächseröffnung“, „Gesprächsmitte“ und „Gesprächsbeendigung“), die Mesoebene (die Gesprächsschritte, der Sprecherwechsel und die Gesprächssequenz) und die Mikroebene (syntaktische, lexikalische und phonologisch-/prosodische Strukturen). Bevor ich aber zu der eigentlichen Analyse des Gesprächs übergehen werde, möchte ich einige Kurzinformationen über den Film und dem Gespräch vorauslaufende Ereignisse erläutern, da diese einige Besonderheiten des Gesprächs erklären und wichtiges Kontextwissen für die weitere Analyse liefern.
Das Gespräch wurde einemösterreichischen Historienfilm „Sissi“ aus dem Jahr 1955 entnommen, der von den frühen Jahren der Kaiserin Elisabeth (1837-1898) erzählt. Er basiert auf dem gleichnamigen, erstmals 1952 im Titania-Verlag in Stuttgart in zwei Teilen veröffentlichten Roman von Marie Blank-Eismann.
Prinzessin Elisabeth, genannt Sissi, ist die zweitälteste Tochter von Herzogin Ludovika und Herzog Max in Bayern. Sie wächst unbeschwert mit ihren sieben Geschwistern im elterlichen Schloss am Starnberger See auf. Das ungestüme Mädchen ist tierlieb, naturverbunden und verlebt eine glückliche Kindheit ohne standesübliche Zwänge. Zusammen mit ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester Helene reist die sechszehnjährige Sissi aus dem bayerischen Possenhofen insösterreichische Bad Ischl. Auf Initiative der Kaiserinmutter, Erzherzogin Sophie, soll Helene, genannt Néné, ihren Cousin, den jungen Kaiser Franz Joseph, in der kaiserlichen Sommerresidenz treffen, um sich alsbald mit ihm zu verloben. Aber der junge Kaiser entscheidet sich für Sissi, was gegen den Wunsch der Kaiserin ist. Auf der Geburtstagsfeier gesteht Franz Joseph Sissi offen seine Liebe und bittet sie, ihn zu heiraten. Um ihre Schwester Néné nicht zu verletzen, erteilt sie ihm eine Absage. Gleich danach begegnen sich Sissi und die Kaiserin unerwartet in einem Raum der Sommerresidenz und zwischen ihnen entsteht ein Gespräch.
Nach den soziopragmatischen Kriterien von H. Henne und H. Rehbock2 kann man das Gespräch wie folgt charakterisieren:
Seiner Funktion im gesellschaftlichen Leben nach dient das Gespräch einer privat- persönlichen Unterhaltung und ist einerseits arbeitsentlastet, andererseits politisch orientiert, wenigstens mit dem zukünftigen Leben eines Reichs eng verbunden. Zwei Frauen treffen plötzlich zusammen und äußern sich zu der neu entstandenen Situation. Die Kaiserin drückt ihre Unzufriedenheit aus, da sie mit der neuen Kandidatur der Braut für ihren Sohn nicht einverstanden ist. In diesem Gespräch handelt sie nicht als eine private Person (Tante), sondern als Staatsfrau, nämlich Kaiserin. Sissi möchte ihrerseits die bevorstehende Rolle nicht einnehmen, ist von der plötzlich geänderten Stimmung der Kaiserin unangenehm überrascht und muss sich während des ganzen Gesprächs gegen die Vorwürfe der Kaiserin währen. Das soziale Verhältnis der Gesprächspartner ist deutlich asymmetrisch, was soziokulturell bedingt ist (Tante-Nichte / Kaiserin-Untertanen).
Das Gespräch verläuft zeitlich simultan und räumlich nah (face-to-face). Das ist ein interpersonales dyadisches Gespräch. Die Gesprächspartnerinnen sind gegenseitig bekannt und besprechen unvorbereitet mehrere Bereiche eines konkreten Themas. Das Verhältnis von Kommunikation und nichtsprachlichen Handlungen ist apraktisch, weil das Gespräch von „gesprächsbegleitenden Funktionen entlastet“ und nicht „in außersprachliche Handlungen verflochten“3 ist.
Bei der Gesprächsgattungsbestimmung bin ich davon ausgegangen, dass ein Gespräch, welches einem Film entnommen wurde, nicht als natürlich-spontan charakterisiert werden kann. Dieses Gespräch kann ich nur, genau wie auf der Bühne aufgeführte Gespräche, als fiktional und inszeniert bestimmen. Natürlich soll das inszenierte Gespräch dem Zuschauer als spontan und natürlich erscheinen, darin steckt ja auch die Kunst des Theaters und Kinos. Aber bei genauer Untersuchung kann man trotzdem einige Merkmale und Besonderheiten finden, die ein inszeniertes Gespräch von dem natürlichen unterscheiden. Im Weiteren werde ich probieren, diese Besonderheiten zu bestimmen.
Der Ausgangspunkt für die Analyse ist das Gespräch zwischen Kaiserin und Sissi in einer gesprächsanalytischen Notation. Gestik, Mimik, Intonation, Ton und alle Handlungen der Figuren werden in der Spalte „Kommentar“ registriert.
II Das Gespräch zwischen Kaiserin vonösterreich und Sissi in gesprächsanalytischer Notation
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
1 H. Henne/H. Rehbock: Einführung in die Gesprächsanalyse, 4. Aufl. de Gruyter Verlag. Berlin/New York 2001.
2 H. Henne, H. Rehbock: Einführung in die Gesprächsanalyse. 4., durchgesehene und erw. Aufl. Walter de Gruyter. Berlin/New York 2001, S. 22-32.
3 H. Henne, H. Rehbock: Einführung in die Gesprächsanalyse, S. 31.