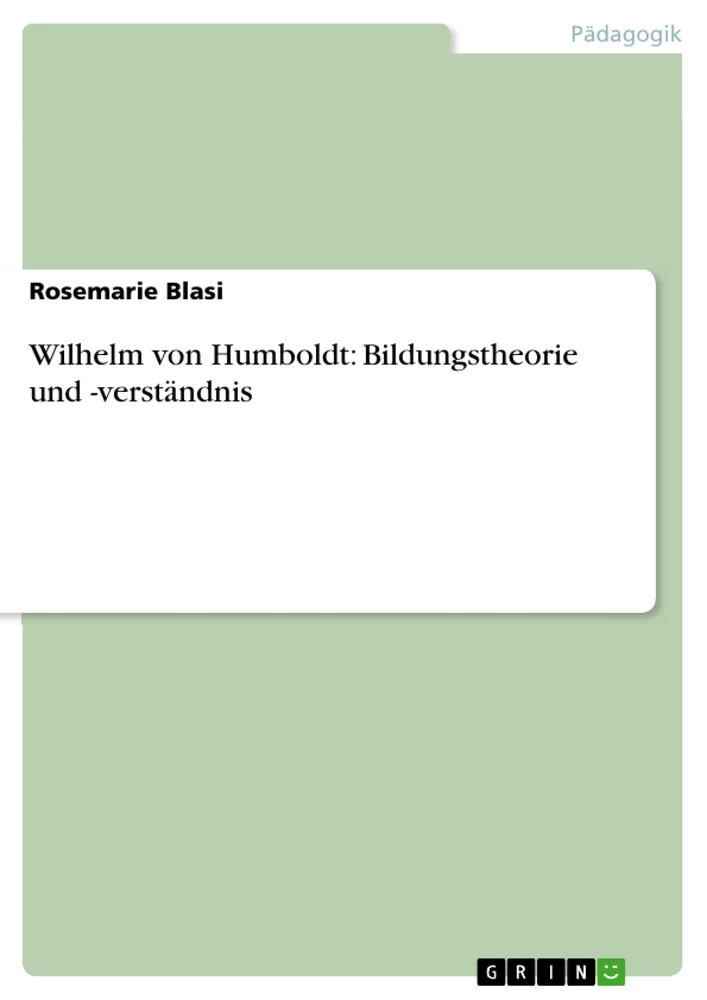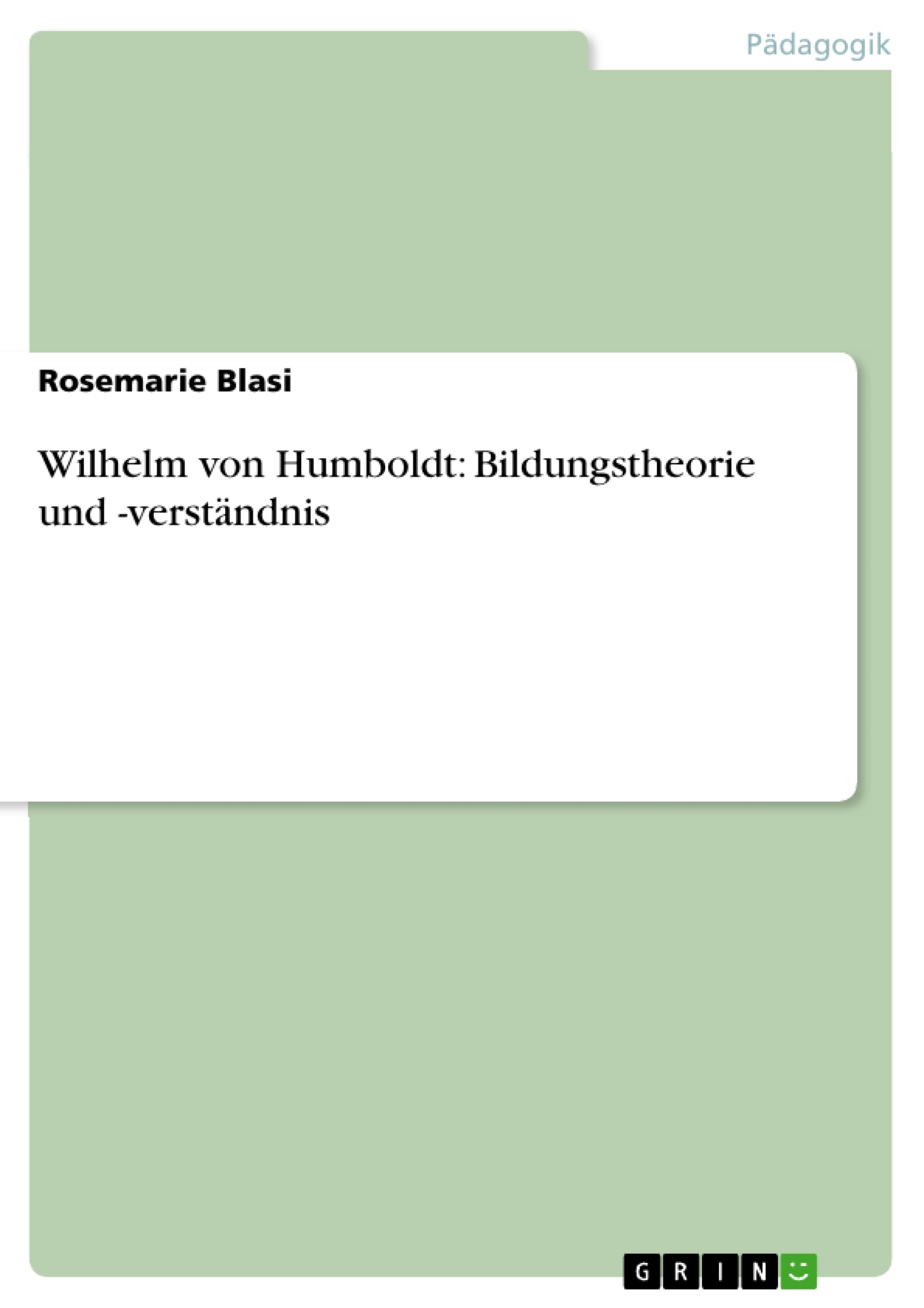Fast täglich werden wir über Medien mit Bildung und Universität konfrontiert. Da kommen wir nicht umhin uns mit bekannten Bildungstheoretikern auseinanderzusetzen. Den meisten Menschen ist er als Wilhelm von Humboldt bekannt, Gründer der Humboldt-Universität in Berlin, preußischer Resident in Rom, Reformator des preußischen Bildungswesens, Diplomat und Bevollmächtigter auf dem Wiener Kongress. Humboldt befasste sich mit vielen Bereichen des Lebens, ein Bereich war die Bildung. Im Mittelpunkt steht bei Humboldt generell der Mensch als Ganzes, als Individuum, das in größtmöglicher Freiheit sich selbst zum Menschen bilden soll. Jeder soll lernen sein Leben als Lernprozess zu begreifen und mit Problemen kognitiv und nicht mit Gewalt umzugehen. Er selber sprach fünf Sprachen fließend, dazu gehörten Latein und Griechisch. Um Humboldts Bildungsverständnis zu verstehen, bzw. richtig zu bewerten, ist es notwendig, seine Biographie zu betrachten.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Wilhelm von Humboldt und das Leben
3. Fragmente aus Humboldts Schriften
4. Die Bildungstheorie - Wilhelm von Humboldt
5. Humboldts neuzeitliche Bildungstheorie und deren Forscher
6. Bildungsroman und Bildungstheorie
6.1 Interpretationen von Klaus Dieter Sorg –
Wilhelm Meisters Lehrjahre
7. Resümee
8. Literatur