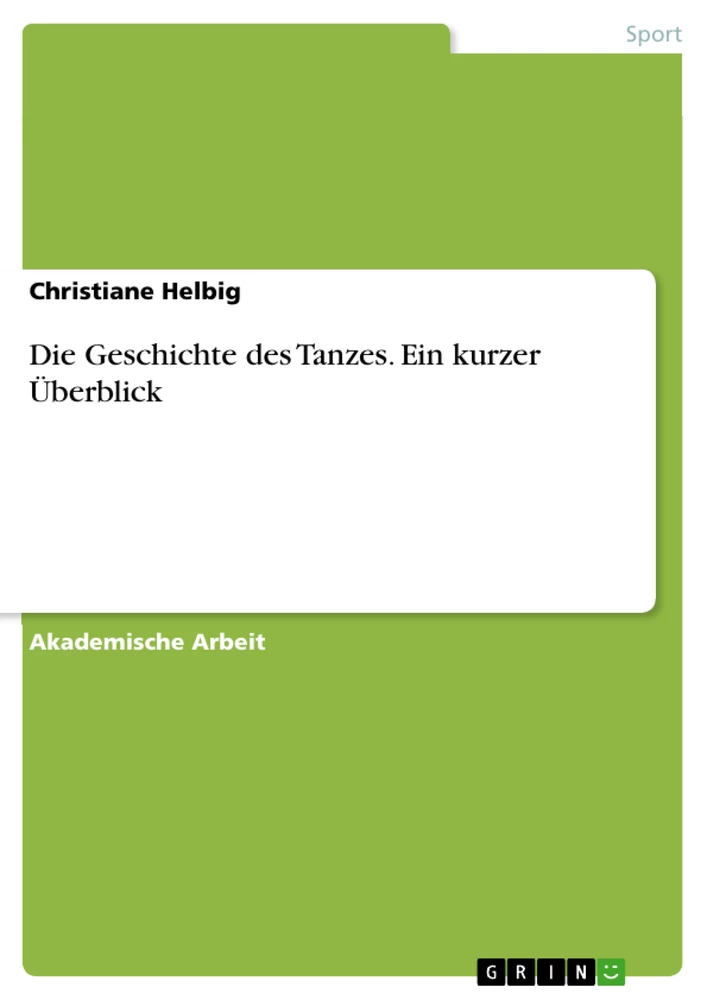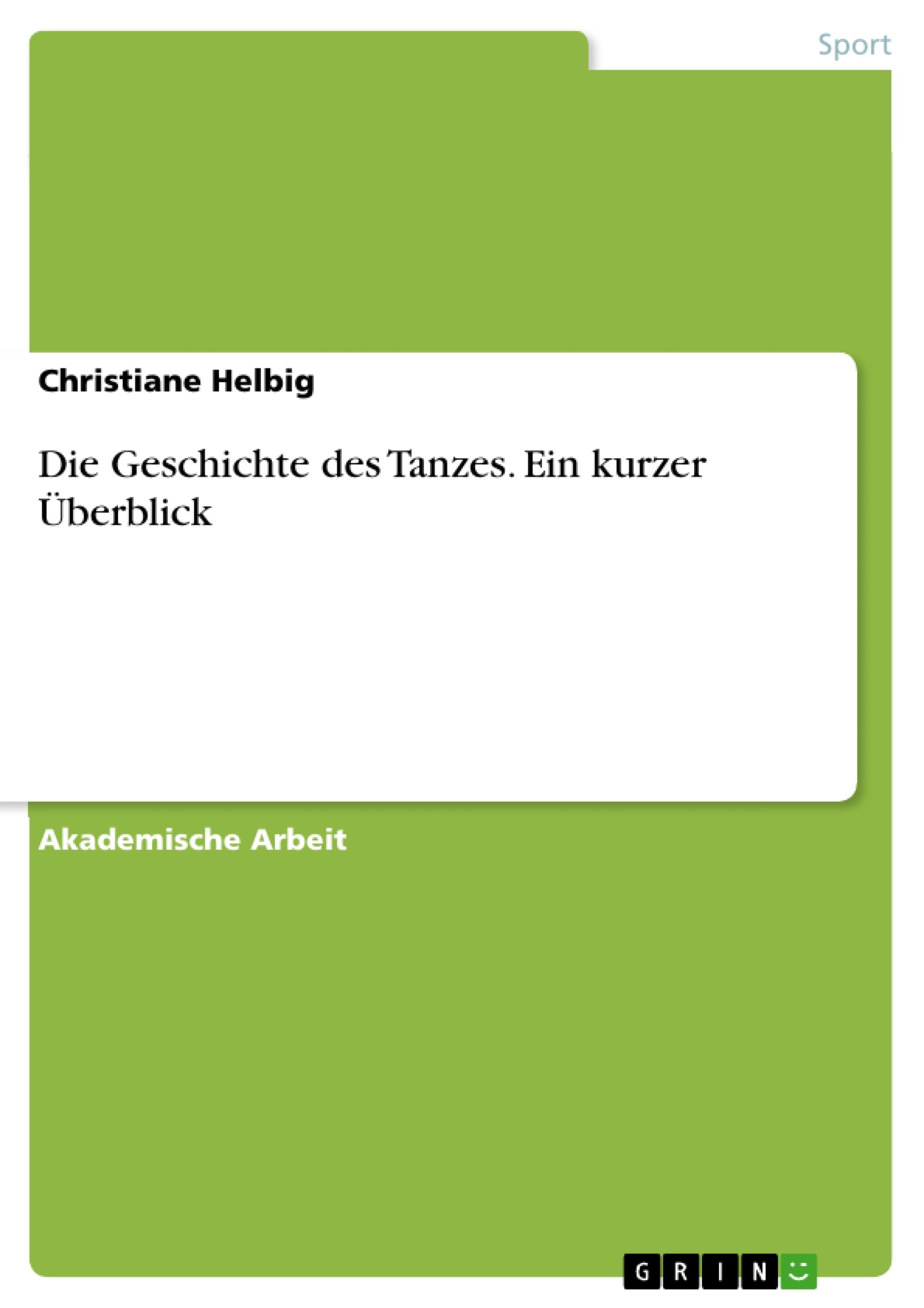Der Tanz gehört zum Leben der Menschen. Er ist neben der Musik eine der ursprünglichsten künstlerischen Lebensäußerungen. Die folgende geschichtliche Darstellung soll bereits bekannte Assoziationen mit konkretem Leben füllen und die Spannweite der verschiedenartigen soziokulturellen und individuellen Bedeutungen des Tanzes in den historischen Epochen herausstellen. Die Entwicklungslinie bis in die Gegenwart zeigt den Weg des Tanzes von einem tradierten Bestandteil einer gemeinschaftlichen Weltsicht hin zu einer subkulturellen Sinngebung von Tanz.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2 Geschichte des Tanzes
2.1 Naturvölker
2.2 Kulturvölker des Mittelmeerraums
2.3 Frühchristliche Zeit
2.4 Mittelalter
2.5 Renaissance
2.6 Ballett
2.7 Der Moderne Tanz
2.8 Jazzdance
3 Schlussbetrachtung
Literatur