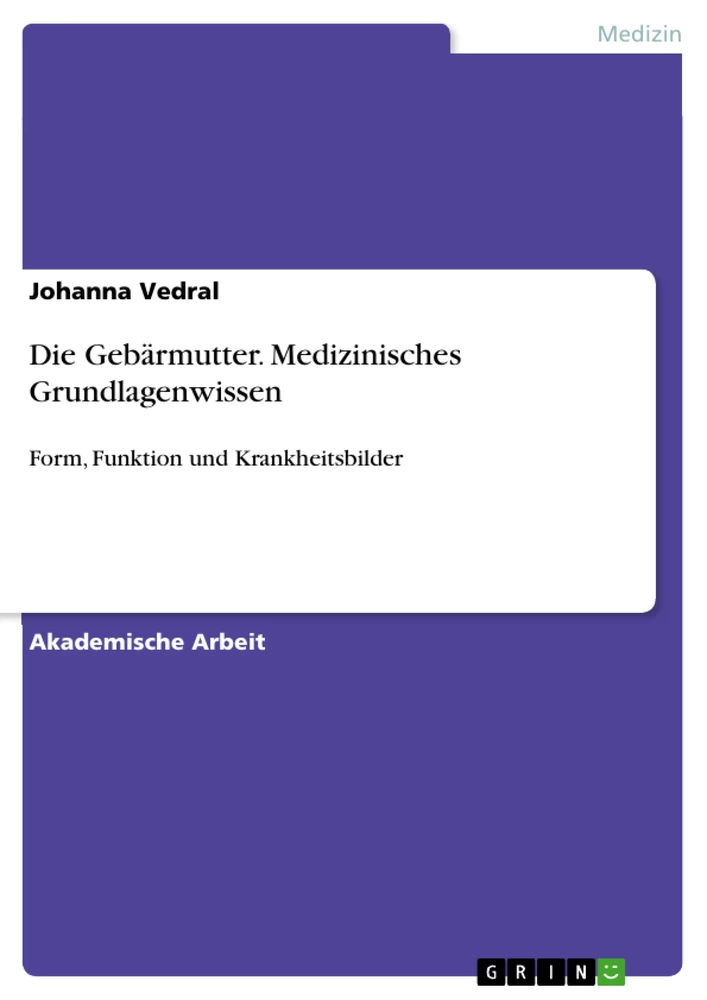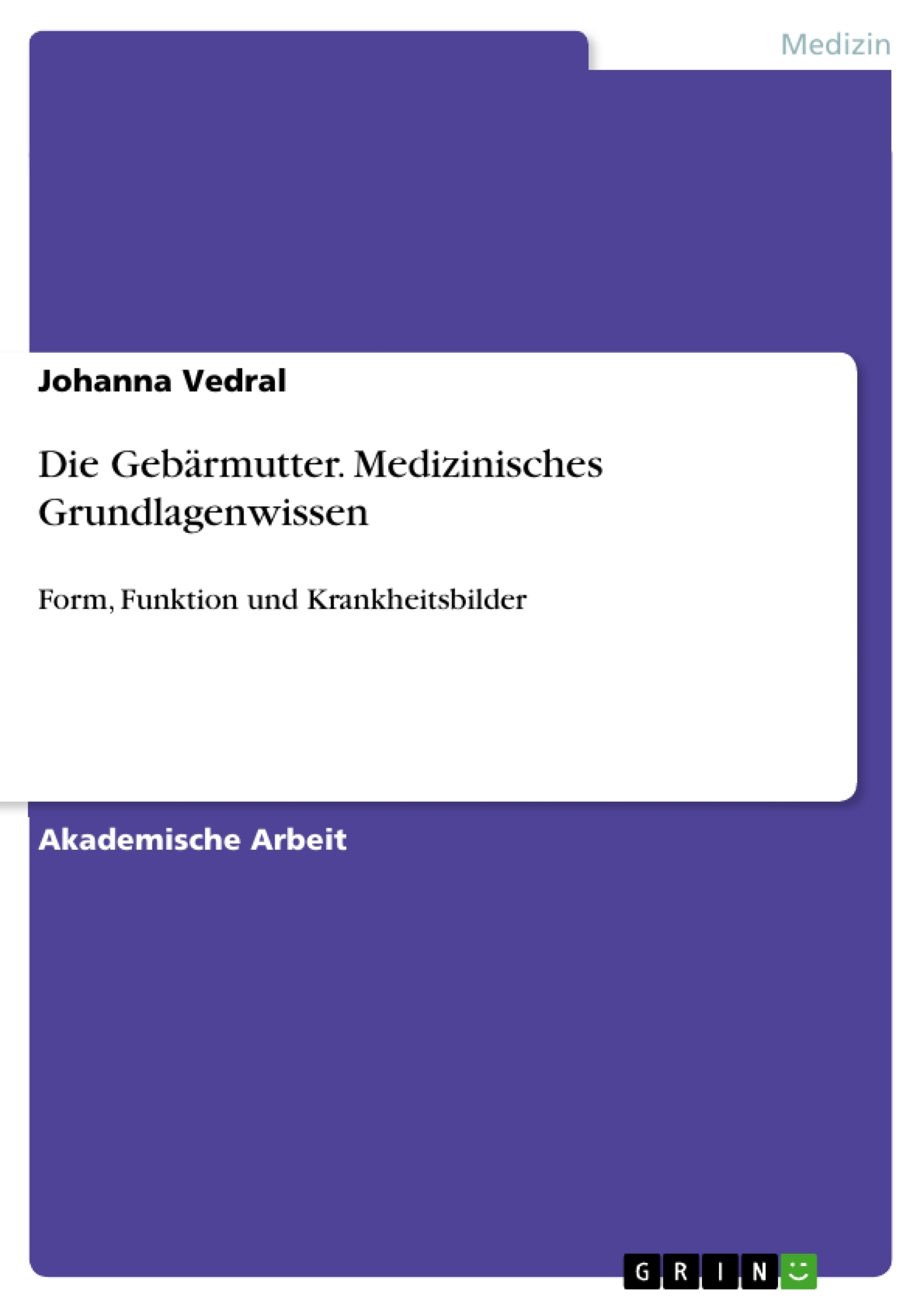Die Gebärmutter ist ein auch nach der Reproduktionsphase wichtiges Organ, das stark symbolisch besetzt werden kann. Im vorliegenden Buch finden Sie medizinisches Grundlagenwissen zur Bedeutung der Gebärmutter und einen kurzen Überblick zur Rolle der Gebärmutter in der Medizingeschichte.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 DIE GEBÄRMUTTER - medizinisches Grundlagenwissen
1.1 Aufbau und Lage der Gebärmutter
1.2 Funktionen der Gebärmutter
1.2.1 Die Gebärmutter als Sexualorgan
1.2.2 Einfluss der Gebärmutter auf die Eierstöcke und deren Hormonproduktion
1.2.3 Einfluss der Gebärmutter auf das Nervensystem
1.2.4 Die weiblichen Sexualhormone und ihre Rolle im ovariellen und uterinen Zyklus
1.2.5 Zusammenhänge zwischen dem Regelkreis der Sexualhormone und der Beta-Endorphine
2 Medizinisches Grundwissen über die Hysterektomie
2.1 Indikationen für eine Gebärmutterentfernung
2.2 Operationstechniken
2.3 Körperliche Reaktionen als Folge der Operation
2.4 Die Indikationendiskussion
3 Die „Krankheit Frau“
3.1 Medizingeschichtliche Betrachtung der Gebärmutter
3.2 Wissenschaftsmythen - die Erfindung der "Krankheit Frau"
3.3 Aus Sicht der Frauen: die Gebärmutter als Symbol
3.4 Selbstkonzept, Körperbild und "Vollwertigkeitsgefühl"
3.5 Das Objekt der Gynäkologie schaut zurück
Schlusswort
Literaturverzeichnis (und weiterführende Literatur)