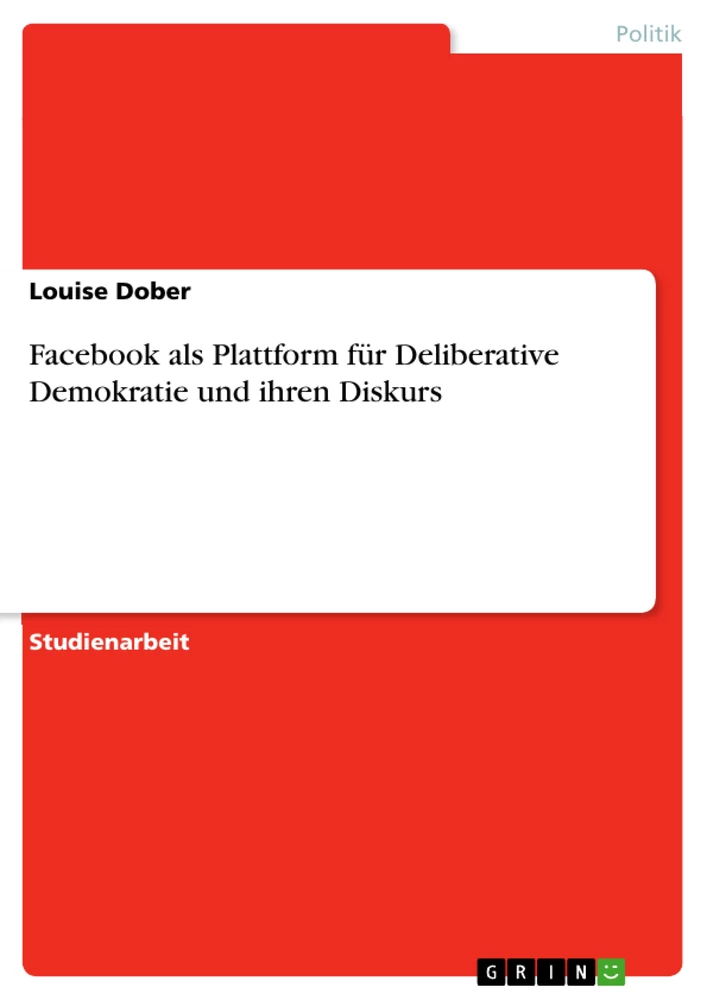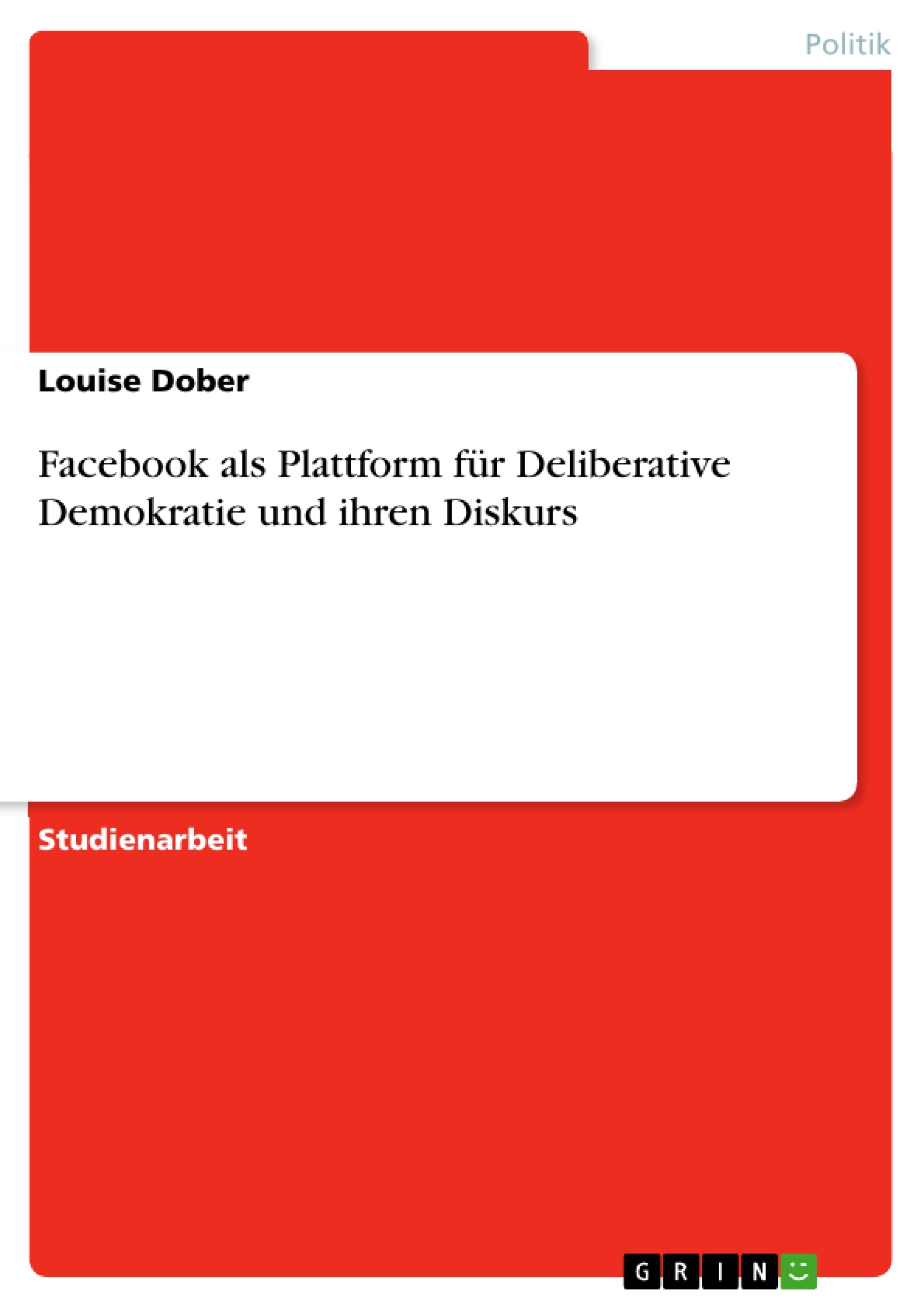Die Hypothese der vorliegenden Arbeit lautet, dass soziale Netzwerke einen nicht unerheblichen Teil zur deliberativen Demokratie beitragen und somit den Diskurs in der Öffentlichkeit fördern und die Bindung zwischen Bürgern und Politikern festigen. Als Grundlage der Hypothesenüberprüfung wird der Schweizer Volksentscheid zur Regulierung der Einwanderung von Ausländern, der im Februar beschlossen wurde, herangezogen. Die Forschung zu diesem Thema ist sehr aktuell und tiefgreifend. Aber nicht nur die neueste Forschungsliteratur findet sich in dieser Arbeit wieder; auch die Arbeiten von Jürgen Habermas und Peter Dahlgren stellen eine wichtige Grundlage dar. Als Basis für die Untersuchung, inwieweit soziale Netzwerke den öffentlichen und kommunikativen Diskurs beeinflussen, sollen zuerst die theoretischen Grundlagen geschaffen und die verwendeten Begriffe geklärt werden. Des Weiteren wird in einem kurzen Abriss die direkte Demokratie in der Schweiz genauer erläutert. Neben der Klärung des Begriffs der Deliberation wird auch ein soziales Netzwerk (Facebook) betrachtet und gleichzeitig die Analyse des vorher genannten Beispiels vollzogen. In der Schlussbetrachtung lässt sich dann zeigen, ob die oben genannte Hypothese verifizierbar ist.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Vorarbeit
A. Demokratiebegriff
B. Demokratietheorien: Deliberative Demokratie
C. Direkte Demokratie
1. Volksinitiative
2. Rechtliche Grundlage
D. Civic Culture
E. Soziale Netzwerke: Facebook
III. Analyse
A. Beispiel der Volksinitiative „gegen Massen-
Einwanderung“ in der Schweiz 12
1. Facebook-Webpräsenz
a) Gegen Masseneinwanderung – SVP
b) NEIN zur SVP-Abschottungsinitiative Bilaterale
c) Die Antwort auf die Volksabstimmung:
Ecopop NEIN
B. Diskurs
IV. Schlussbetrachtung
V. Literaturverzeichnis
A. Literatur
B. Webpages