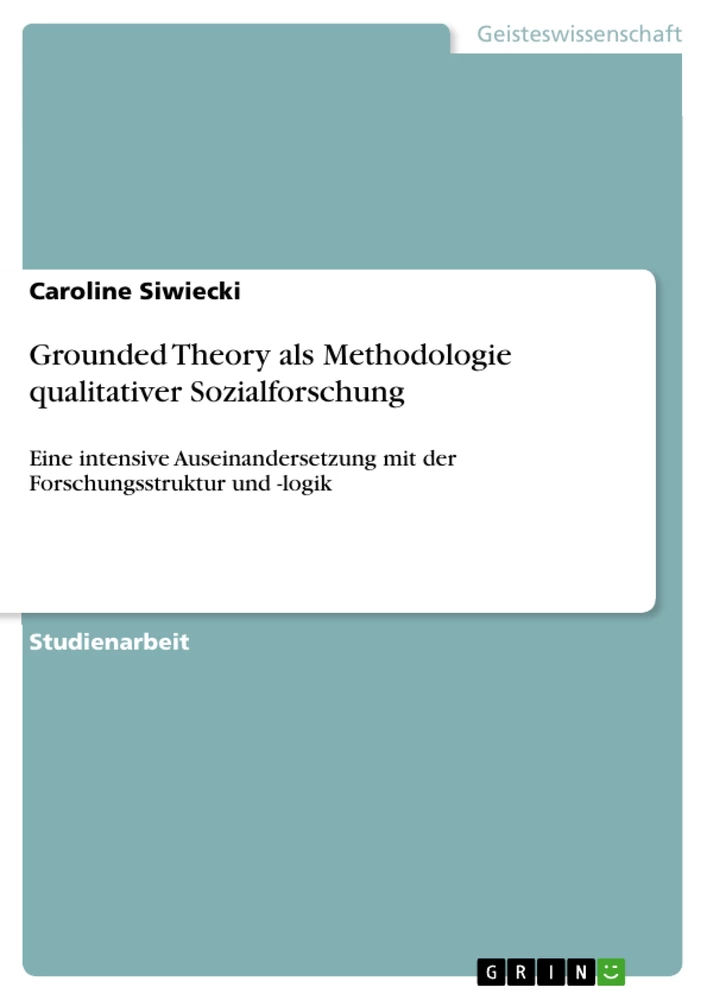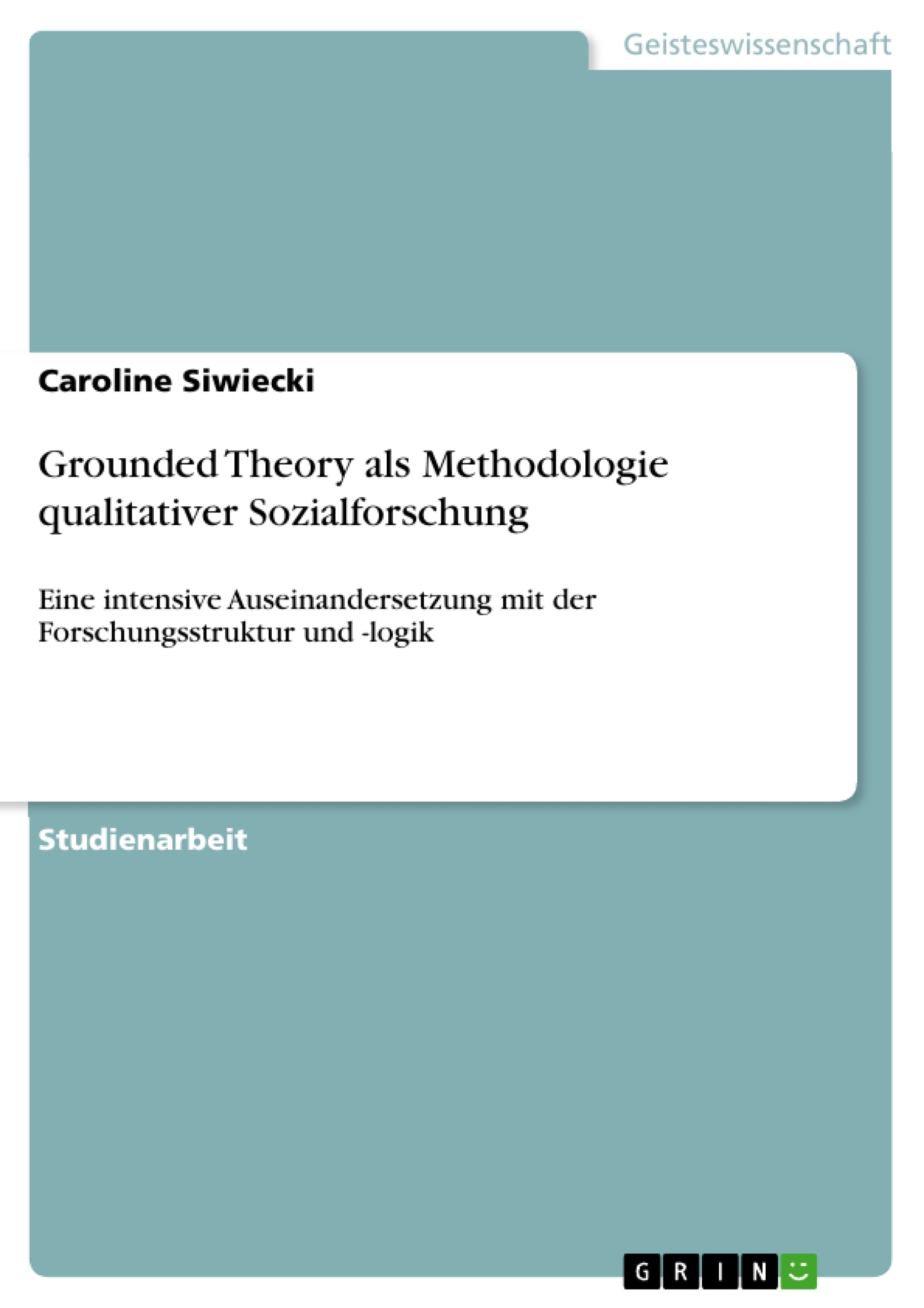In der qualitativen, wie auch quantitativen Sozialforschung herrscht eine zunehmende methodische Vielfalt, mit einer jeweils inhaltlich unterschiedlichen Komplexität. Aus diesem Grund und in Hinblick auf eine Masterarbeit, war es ein großes Anliegen meinerseits, sich näher mit einer ausgewählten Methode zu beschäftigen.
In dieser Ausarbeitung wird daher ausführlich auf die Methodologie der Grounded Theory nach Anselm Strauss und Juliet Corbin eingegangen. Dabei wird zunächst allgemein in die qualitative Forschungsweise eingeführt (Kapitel 2). Anschließend folgt in Kapitel 3 der Kern der Arbeit: Die Grounded Theory wird in ihrer Vorgehensweise ausführlich expliziert. Schließlich folgt ein kritischer Teil (Kapitel 4) und das Schlusswort (Kapitel 5).
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einführung
2. Qualitative Sozialforschung - Paradigmen
3. Grounded Theory (nach Strauss & Corbin)
3.1 Theoretische Sensibilität
3.2 Theoretisches Sampling
3.3 Vergleichende Analyse
3.4 Theoretisches Kodieren - Herzstück der Grounded Theory
3.4.1 Offenes Kodieren
3.4.2 Axiales Kodieren
3.4.3 Selektives Kodieren
4. Kritik
5. Schlusswort
6. Literaturverzeichnis