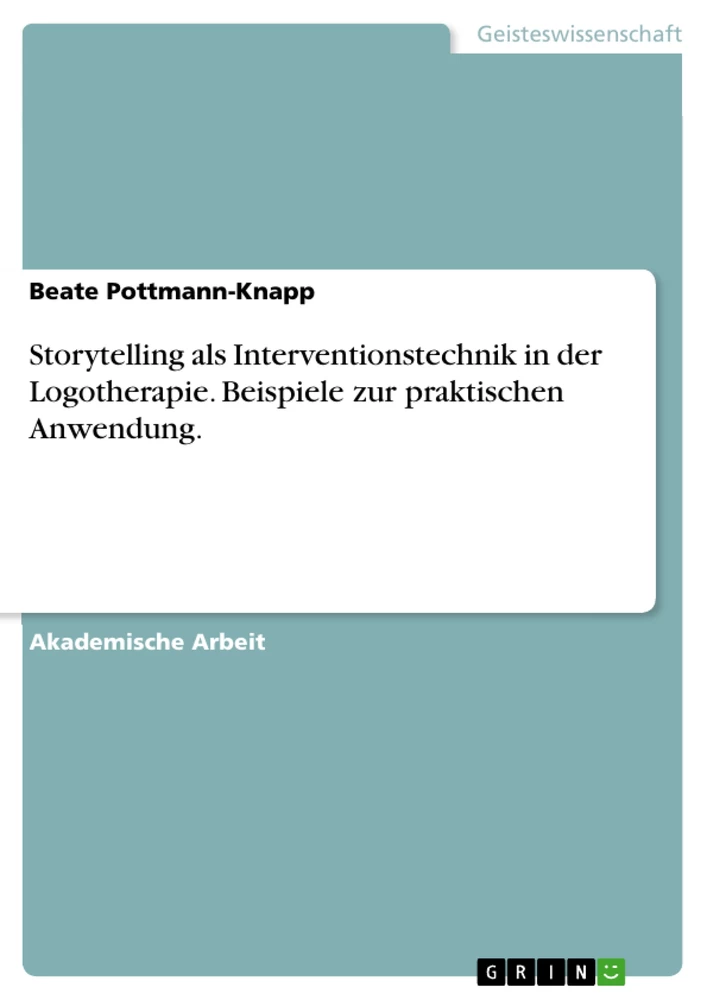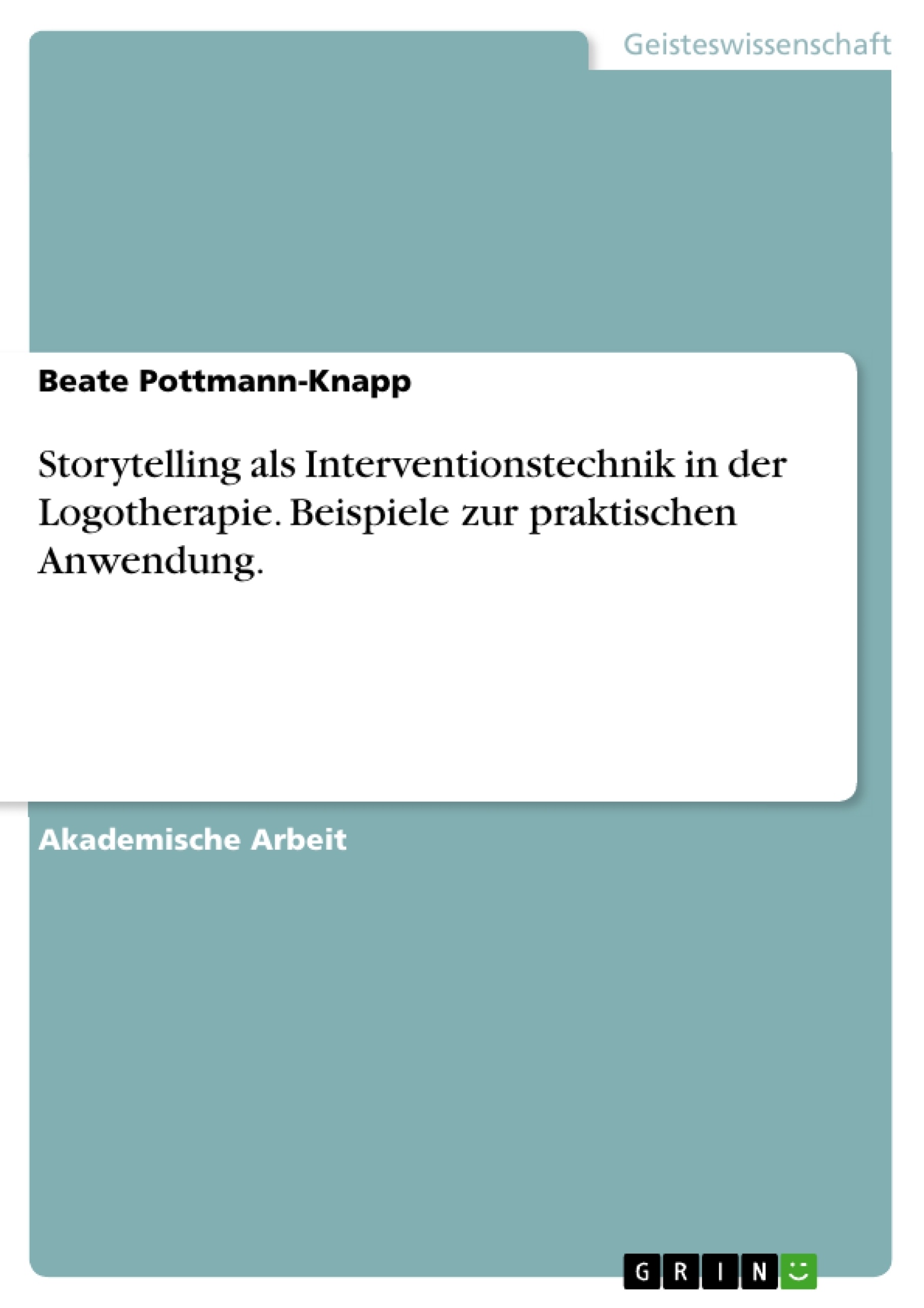Die Grundaussagen der Lehre von der Logotherapie und Existenzanalyse, ihr zugrunde liegendes Menschenbild und ihr geistiges Grundkonzept lassen den Schluss zu, dass die Technik des Geschichten Erzählens sich als hervorragendes therapeutisches Instrumentarium eignet, um das Thema eines Patienten aufzuarbeiten und dazu notwendige seelische Entwicklungen zu fördern.
Obwohl die Geschichte Vorgaben des Therapeuten enthält, lässt sie viel Freiraum für das ob und wie der Verarbeitung.
Die Arbeit führt in die Grundlagen des Geschichte erzählens und -erstellens ein und gibt konkrete Beispiele zu Erfahrungen der Autorin mit Storytelling im Therapiealltag.
Aus dem Inhalt:
- Das Sammeln von Informationen.
- Das Imaginieren der Geschichte.
- Geschichten als Beispiele.
Inhaltsverzeichnis
1. EINLEITUNG
2. DEFINITION
3. KRITERIEN EINER SINNVOLLEN GESCHICHTE
4. AUSWIRKUNGEN
5. DER PROZESS
5.1 Eingangsphase /Arbeitsschritte
5.1.1 Das Sammeln von Informationen
5.1.2 Vorschlag für eine Checkliste:
5.2 Kreative Phase
5.2.1 Das Imaginieren der Geschichte
5.2.2 Wahl des Erzählmodells
5.2.3 Wahl des Gestaltungsmodells
5.3Therapeutische Phase
5.3.1 Der Prozess des Schreibens
5.3.2 Das Vortragen / Das Erzählen
5.3.3 Das Aufarbeiten
6. GESCHICHTEN ALS BEISPIELE
6.1 Die geschlossene Geschichte
6.2 Offenes Ende
6.3 Die Offene Geschichte
6.4 Die Interaktive Geschichte
6.5 Die spontane Geschichte
7. EINE FALLGESCHICHTE
7.1 Herausarbeiten von Ähnlichkeiten und Elementen der klassischen Tragödie
7.2 Herausarbeiten von Ähnlichkeiten und Elementen des Strukturphasenmodells
7.3 Herausarbeiten von Ähnlichkeiten und Elementen der epischen Form
7.4 Herausarbeiten von Ähnlichkeiten und Elementen der Drei-Ebenen Kommunikation
7.5 Herausarbeiten von Ähnlichkeiten und Elementen der Logotherapie
7.6 Herausarbeiten von Ähnlichkeiten und Elementen der logotherapeutischen Geschichte
7.6.1 Eingangsphase
7.6.2 Kreative Phase und therapeutische Phase
7.7 Herausarbeiten von Ähnlichkeiten und Elementen der logotherapeutischen Philosophie
7.8 Exploration/Anamnese/Verlauf
7.9 Ergebnis
8. ZUSAMMENFASSUNG UND ABSCHLUSS
9. LITERATURVERZEICHNIS (inklusive weiterführender Literatur)
10. ANHANG