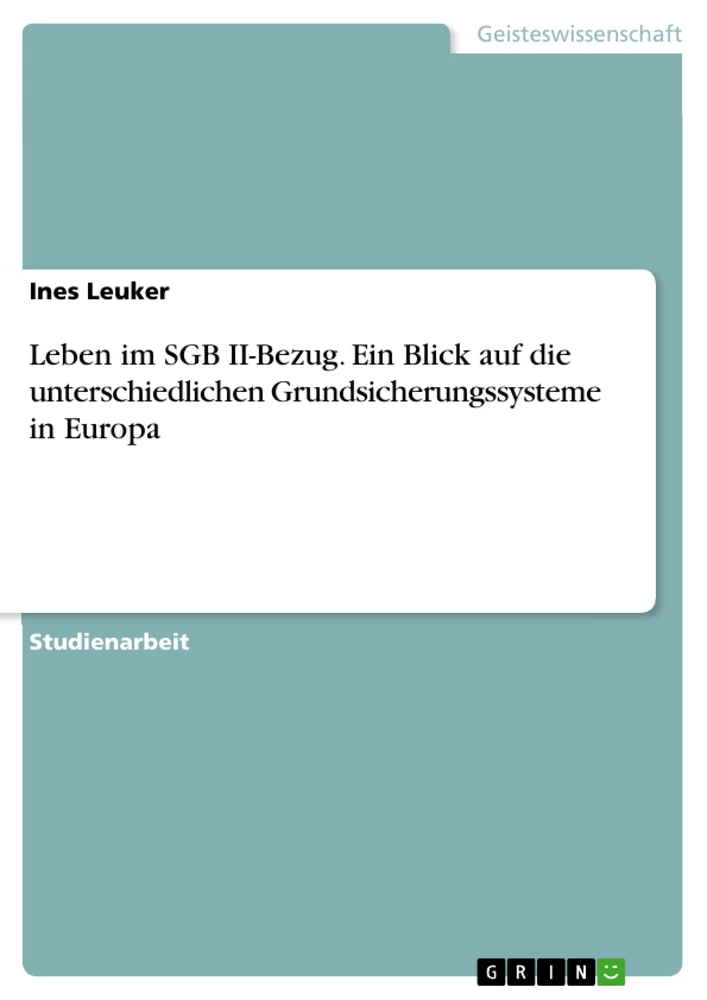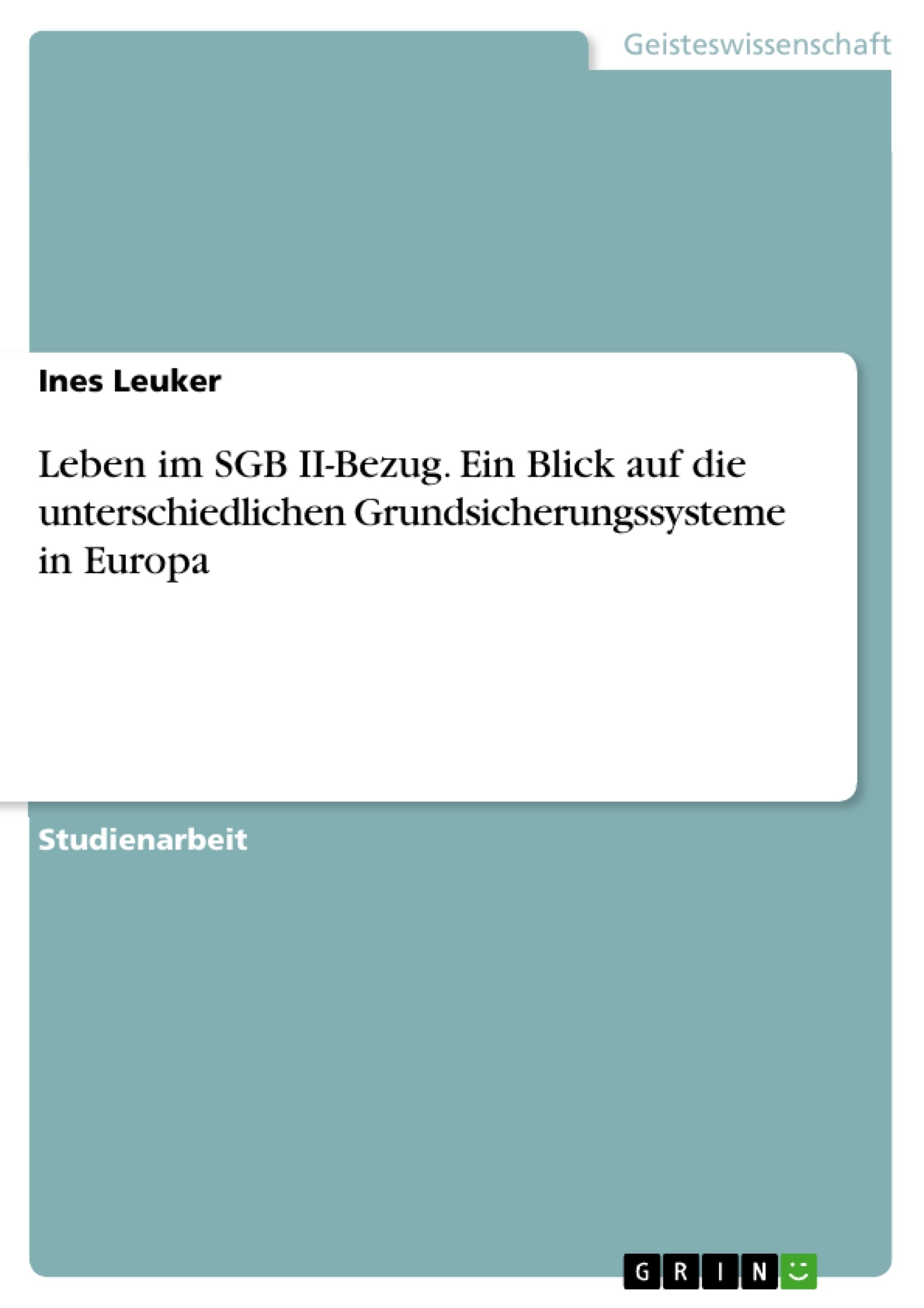Das zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) wurde als Folge der Arbeitsmarktreformen im Januar 2005 geschaffen und hatte die Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe zur Folge.
Ziel und Aufgabe des SGB II ist die Grundsicherung für Arbeitssuchende und ist beim Großteil der Bevölkerung vor allem unter dem Begriff „Hartz IV“ bekannt. Die Arbeitsmarktreform sollte arbeitsfähige Personen dazu anhalten wieder eine Arbeit aufzunehmen, wobei der Zumutbarkeitsbegriff sehr weit gefasst wurde. Bei Zuwiderhandlung drohen nun Sanktionen, wie z.B. Streichung von Sozialleistungen.
Besonders von der Reform betroffen waren die bisherigen Bezieher der Arbeitslosenhilfe, deren Leistungsbezüge nun beinahe auf den Stand der damaligen Sozialhilfe sanken. (vgl. Schmidt, 2012: 93) Somit kann auch von einem rekommodifizierenden Effekt als Teil der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik gesprochen werden, also von einer Vermarktung menschlicher Arbeitskraft. (vgl. Schmid, 2010: 141) Schon im Vorfeld der Reform wurde das neue Gesetz heftig umstritten und ist bis heute kontroversen Diskussionen ausgesetzt. (vgl. Hartmann 2013: 7ff.)
In meiner Hausarbeit werde ich näher auf das Leben im SGB II – Bezug eingehen, indem ich relevante rechtliche Grundlagen erläutere, die politische Entwicklung aufzeige und zur Veranschaulichung konkrete Beispiele dar stelle.
Zum besseren Verständnis beginne ich mit einer Begriffsdefinition.
Im weiteren Verlauf meiner Arbeit vergleiche ich den Sozialstaat Deutschland mit zwei weiteren wohlfahrtsstaatlichen Ländern der EU im Hinblick auf die Sicherungssysteme für Arbeitssuchende.
Zusätzlich besteht meine Hausarbeit aus einem inhaltlichen Transfer zur Einführungsveranstaltung der Politikwissenschaften von Prof. Dr. Albers aus dem Wintersemester 2013 / 2014, wodurch der europäische Vergleich gut ergänzt wird.
Abschließend ziehe aus allen Teilbereichen ein zusammenfassendes Fazit.
1. Inhalt
2. Einleitung
3. Begriffsdefinitionen
4. Rechtliche Grundlagen
5. Politische Entwicklung
6. Leben im SGB II - Bezug
7. Europäischer Vergleich
8. Inhaltlicher Transfer
9. Fazit
10. Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten