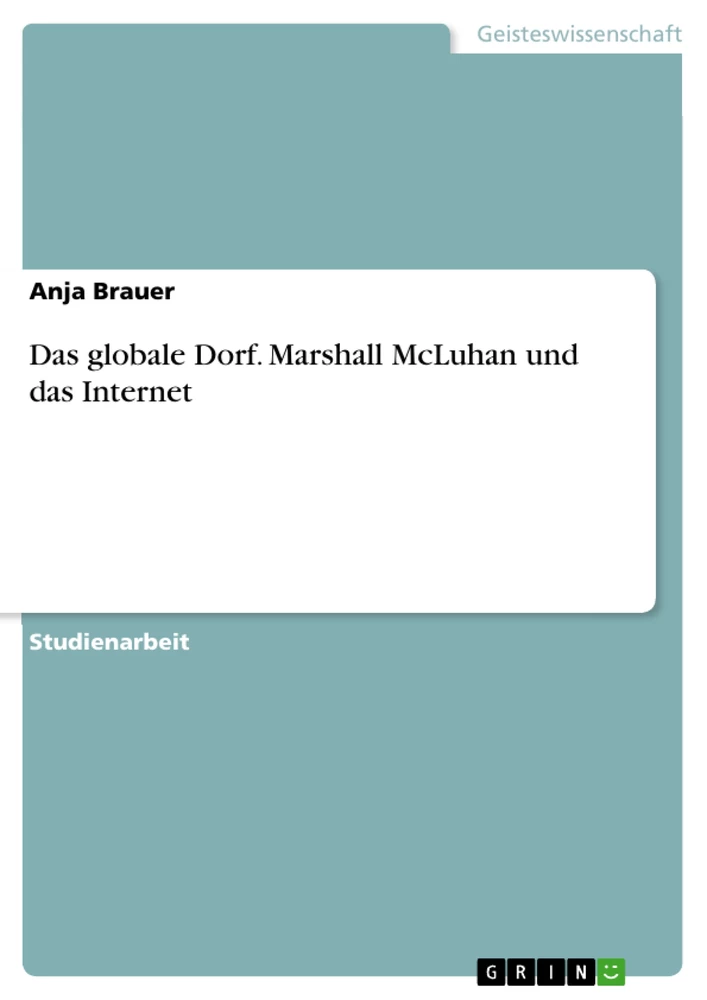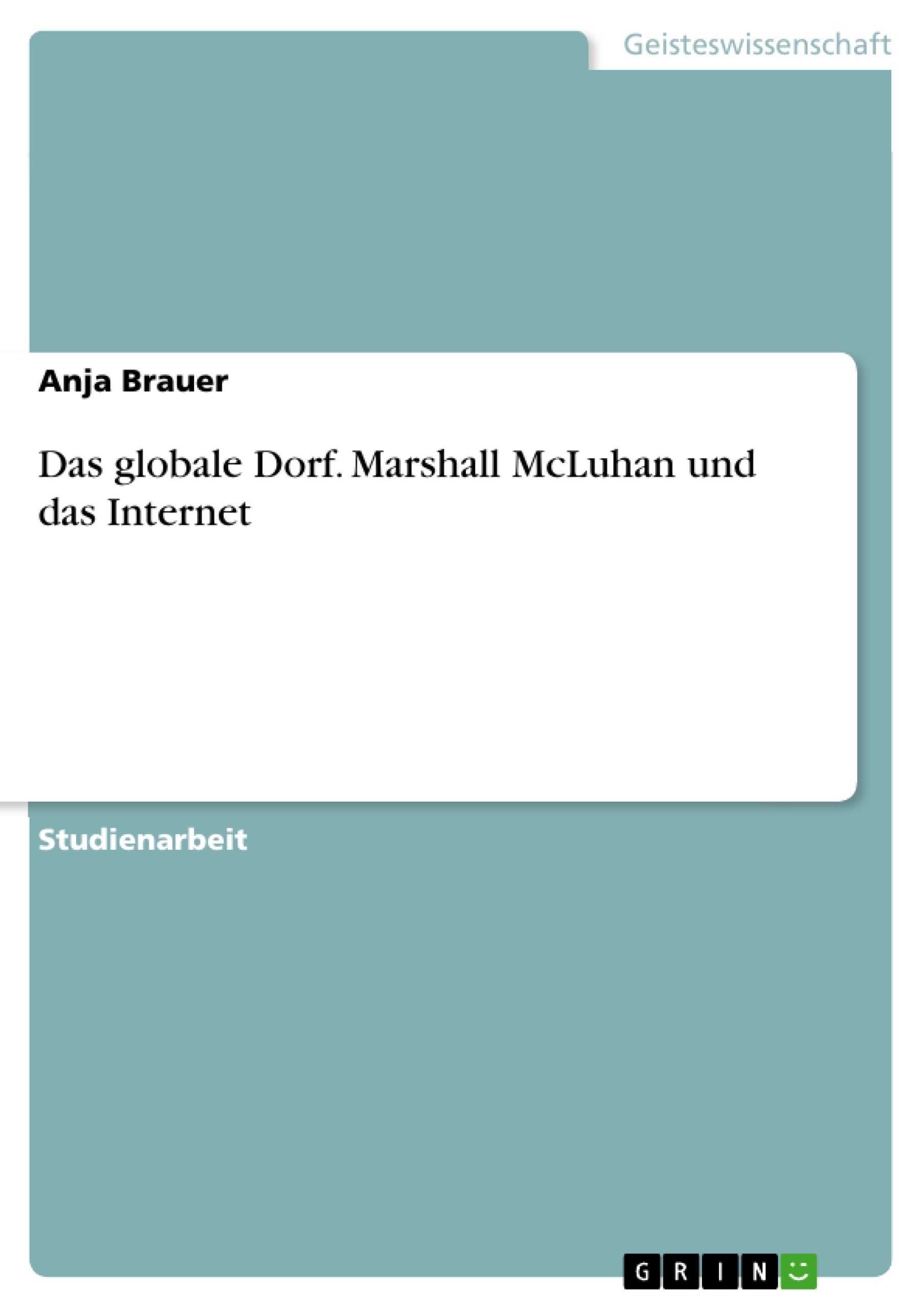Einer der prominentesten Vertreter der Analyse des Schriftkulturwandels durch die Entwicklung der elektronischen Medien ist der kanadische Literaturwissenschaftler und Medientheoretiker Herbert Marshall McLuhan (1911-1980). Seine beiden Hauptwerke „Die Gutenberg-Galaxis“ 5 und „Understanding Media“ aus den 1960er Jahren sind die Grundlage für seine wichtigsten Thesen, die bis heute die Medien- und Kommunikationswissenschaften beschäftigen. Gegenstand dieser Hausarbeit wird es sein, zu untersuchen inwieweit die drei Fundamentalthesen, die sich in McLuhans Werk herauskristallisiert haben und seine Gesamtwerk durchziehen, auf die heutige Nutzung und den Entwicklungsstand des Internets, gerade in Anbetracht der Veränderung von Schrift und Leseverhalten, anwenden lassen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Medium als Körperausweitung
3. Die Gutenberg-Galaxis und das globale Dorf
4. Das Medium als Botschaft
5. Resümee
6. Bibliographie
6.1. Primärtext
6.2. Sekundärliteratur