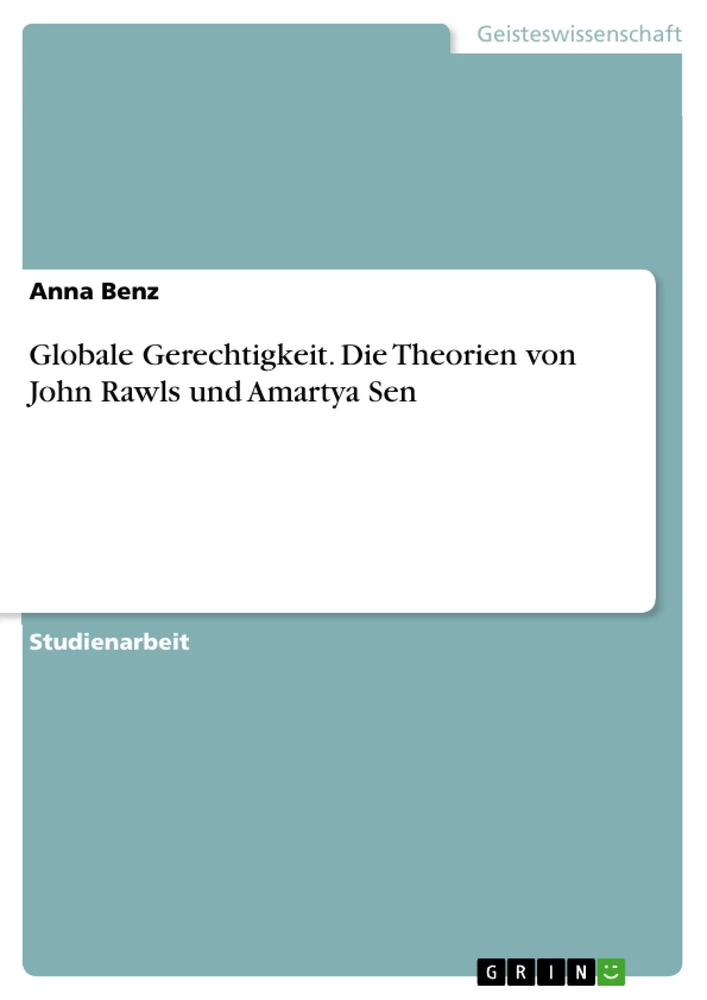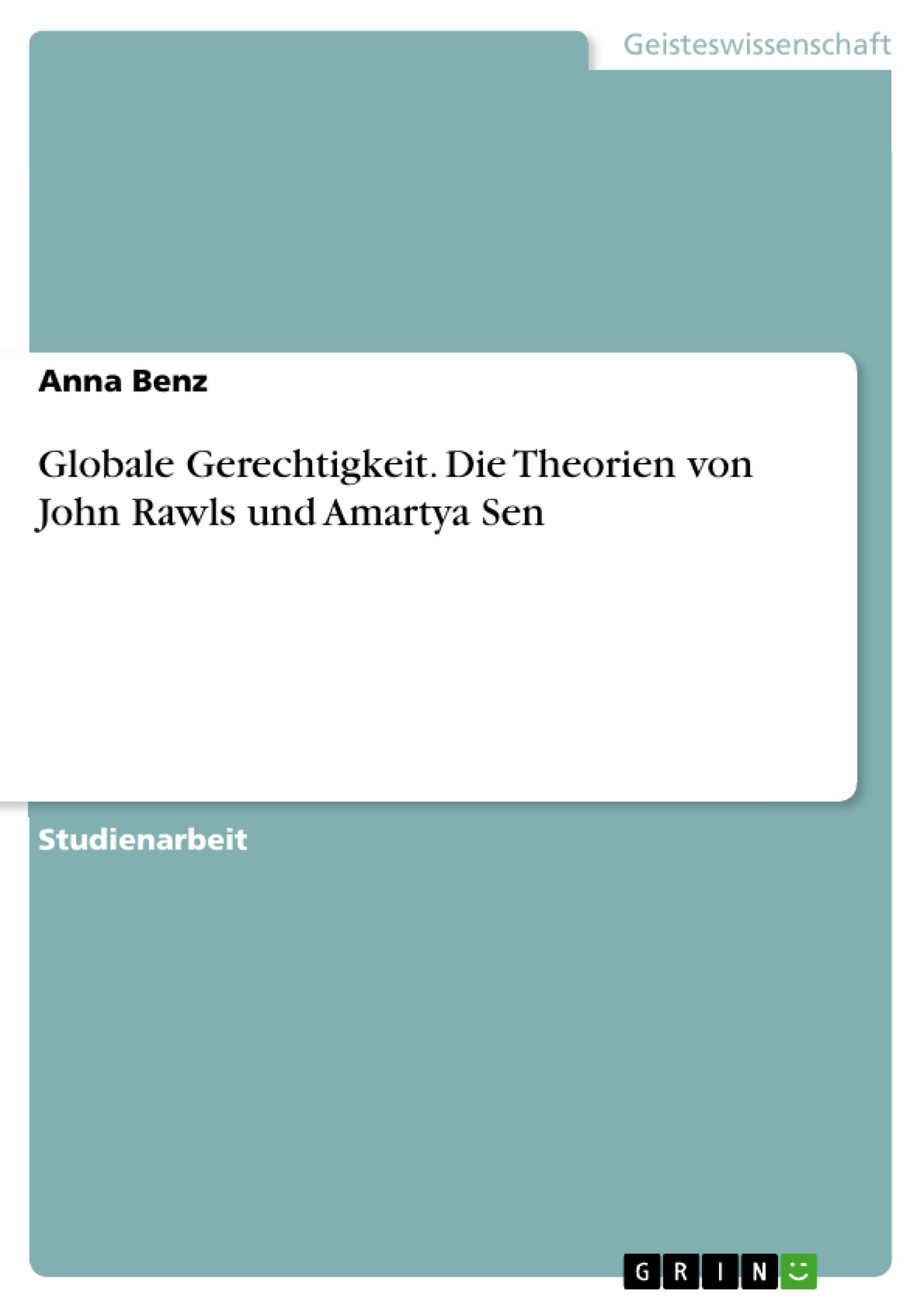Mehr als ein Drittel der Menschheit ist von Armut betroffen. Dabei sterben jedes Jahr sechs Millionen Kinder vor ihrem fünften Geburtstag an Mangelernährung. Alle 30 Sekunden stirbt ein afrikanisches Kind an Malaria. Jeden Tag gehen mehr als 800 Millionen Menschen hungrig zu Bett. Alle 3,6 Sekunden verhungert ein Mensch. Mehr als 2,6 Milliarden Menschen fehlt es an grundlegenden sanitären Einrichtungen, und mehr als eine Milliarde Menschen holen ihr Trinkwasser nach wie vor aus verunreinigten Quellen. Mehr als eine Milliarde Menschen auf der Welt müssen von weniger als einem Dollar pro Tag leben. Die Armut in den Entwicklungsländern geht jedoch weit über die Einkommensarmut hinaus.
Aufgrund der schwerwiegenden Armut, die auf der Welt allgegenwärtig ist, beschäftigten sich einige Philosophen mit der Lösungsfindung, indem sie verschiedene Theorien entwarfen. Dabei geht es um die Gerechtigkeit in moralphilosophischer Hinsicht. Im Zentrum des philosophischen Geschehens steht die Gerechtigkeit zwischen den Nationen und ihren Institutionen. Im Folgenden geht es um die Interaktion der Nationen untereinander und um die Institutionen, die keinem Nationalstaat allein unterstehen. Welche Regeln und Normen sind für die Konzerne und ökonomischen Subjekte zu definieren? Es soll gezeigt werden, inwiefern Gerechtigkeit global gelten kann und welche Standards dafür nötig sind. Welche Rolle sollen außerdem Nationalstaaten und Institutionen spielen?
Zur Einführung werden die grundlegendsten Begriffe erklärt und gedeutet. Im zweiten Teil wird das Verständnis und die Theorie John Rawls ausgeführt und anschließend mit dem globalen Gerechtigkeitsbegriffs Amartya Sens in Verbindung gebracht. Um am Ende noch einen Überblick über das Verständnis von Thomas Pogge zu bekommen, wird seine Ansicht über die Menschenrechte kurz erläutert.
Mit der Theorie der Globalen Gerechtigkeit befasste sich John Rawls und Amartya Sen, welche bedeutende Theorien lieferten. Das Werk „Philosophie der Gerechtigkeit“ von Nico Scarano und Christoph Horn bietet ein zahlreiches Sammelwerk an Theorien und philosophischen Grundzügen. An dieser Stelle könnten noch etliche literarische Werke genannt werden, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, denn es gilt eine genaue Auffassung der Ideen und Theorien zu beschreiben und zu verstehen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffsdeutung
2.1. Globalisierung
2.2. Gerechtigkeit
3. John Rawls - Theorie der Gerechtigkeit
3.1. Gerechtigkeit als Fairness
3.2. Urzustand
3.3. Ordnung der Gesellschaft
3.4. Das Recht der Völker
4. Amartya Sen
4.1. Idee der Gerechtigkeit
4.2. Globale Gerechtigkeit. Jenseits internationaler Gleichberechtigung
5. Thomas Pogge - Weltarmut und Menschenrechte
6. Fazit
Literaturverzeichnis