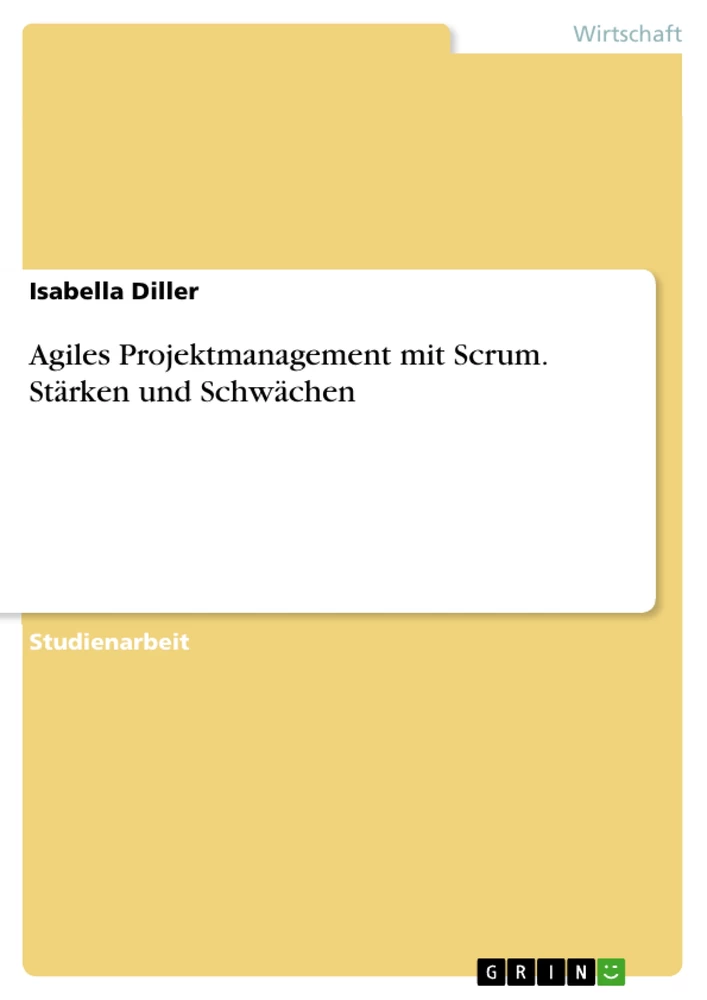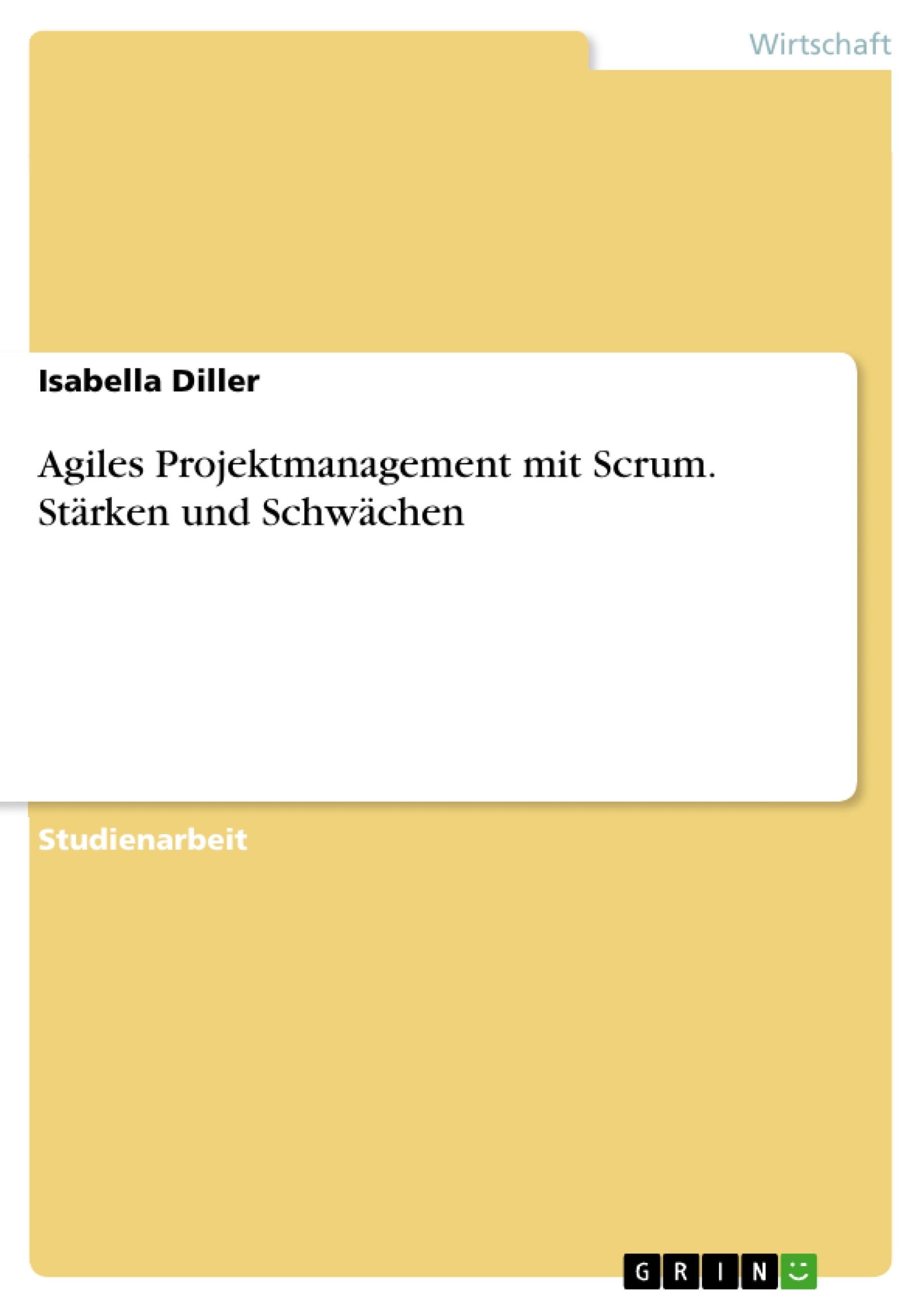"SAP stoppt Milliardenprojekt" lautet die Überschrift in einem Bericht des Handelsblatts im Oktober 2013. Immer häufiger stößt man in der Presse auf missglückte Großprojekte.
Meist liegen die Ursachen in der Komplexität der Projekte begraben. Vor allem in IT Projekten geschieht es häufig, dass die Faktoren Zeit, Qualität und Budget überschritten werden. Der Mangel an Informationen und Know-how fordert gewisse Prozesse in einem Unternehmen, sodass die gezielte Umsetzung eines Projekts gewährleistet werden kann. Das Projektmanagement dient der Planung und Umsetzung.
Aufgrund der Notwendigkeit einer Anpassung des Projektmanagements im IT Sektor, haben sich bereits zahlreiche Methoden eingefunden und etabliert. Darunter zählt auch die Methodik "Scrum".
In der folgenden Arbeit möchte ich diese Methodik vorstellen und anhand von einer SWOT Analyse die Stärken und Schwächen von Scrum untersuchen, sowie die Chancen und Risiken, die sich aus dem Umfeld ergeben, darstellen. Hierbei beziehe ich mich auf die essenziellen Bereiche beim Projektmanagement: das Team und der Projektablauf.
Es soll nicht eine Anleitung zur Verwendung von Scrum dargestellt werden, jedoch sind zunächst Grobdefinitionen wichtig, um die Schritte dieser Methode analytisch betrachten zu können.
Anhand meiner Analyse möchte ich der Frage nachgehen, ob Scrum sich für IT Unternehmen längerfristig als strategisch positive Projektmanagement Methode eignet.
Am Ende werde ich meine Ergebnisse zusammenfassend bewerten und im Anschluss einen Ausblick für zukünftiges Projektmanagement mit Scrum geben.
Im anschließenden Kapitel wird vorab ein kurzer Überblick über das Projektmanagement im Allgemeinen sowie eine Gegenüberstellung des klassischen und agilen Projektmanagements
geliefert.
Inhaltsverzeichnis
1. EINLEITUNG
2. PROJEKTMANAGEMENT
2.1 KLASSISCHES PROJEKTMANAGEMENT
2.2 AGILES PROJEKTMANAGEMENT
2.3 KLASSISCHES PROJEKTMANAGEMENT VS. AGILES PROJEKTMANAGEMENT
3. SCRUM
3.1 DAS PROJEKTTEAM
3.1.1 STÄRKEN DES PROJEKTTEAMS
3.1.2 SCHWÄCHEN DES PROJEKTTEAMS
3.1.3 CHANCEN DES PROJEKTTEAMS
3.1.4 RISIKEN DES PROJEKTTEAMS
3.2 DER PROJEKTABLAUF
3.2.1 STÄRKEN DES PROJEKTABLAUFS
3.2.2 SCHWÄCHEN DES PROJEKTABLAUFS
3.2.3 CHANCEN DES PROJEKTABLAUFS
3.2.4 RISIKEN DES PROJEKTABLAUFS
4. ZUSAMMENFASSUNG
5. AUSBLICK
6. LITERATURVERZEICHNIS
7. INTERNETQUELLEN
8. ABBILDUNGSVERZEICHNIS