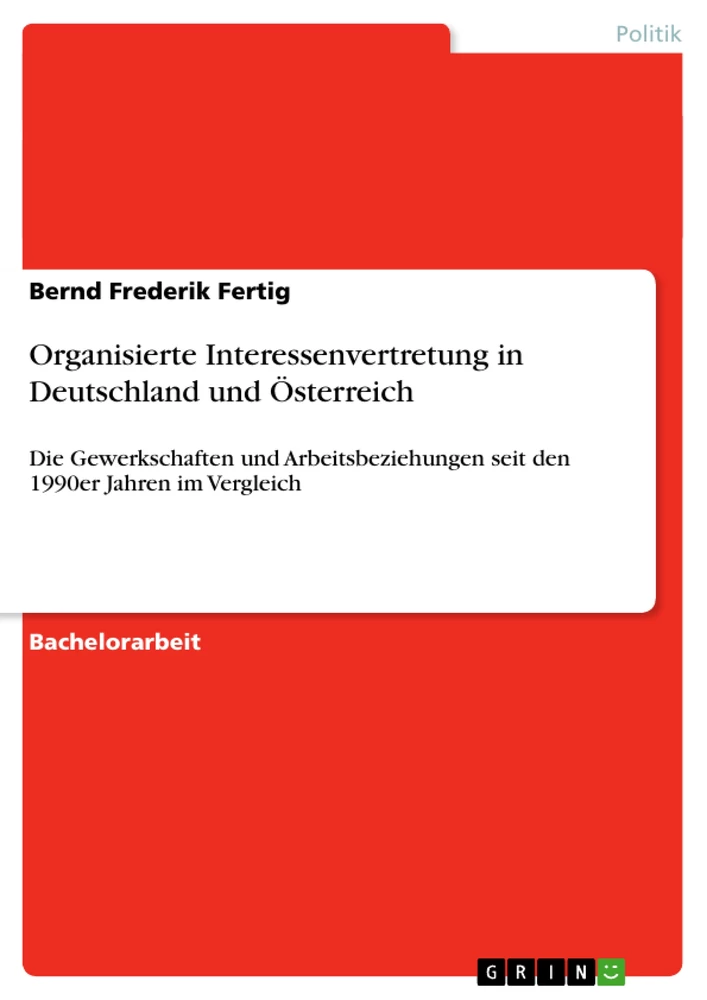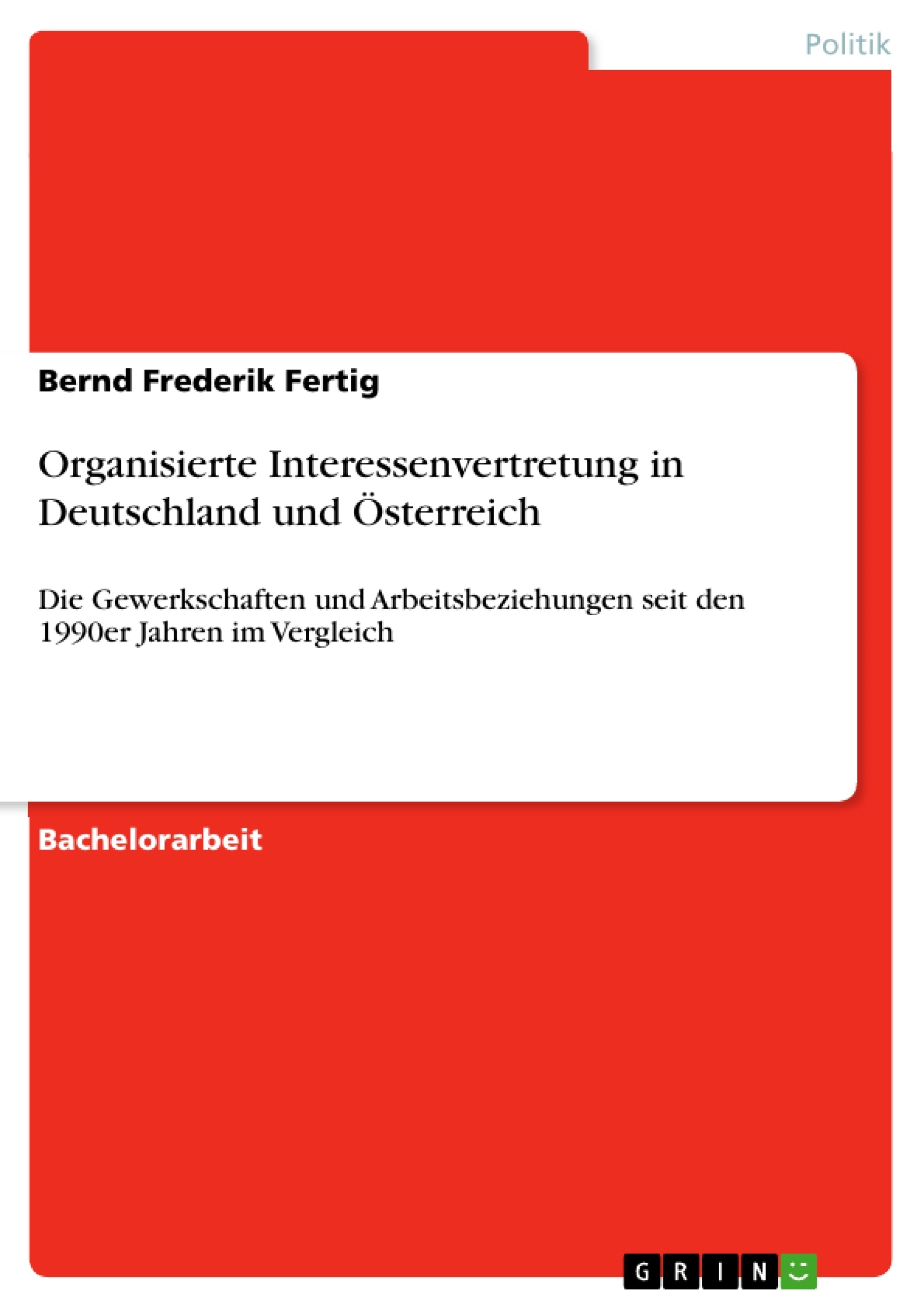Deutschland und Österreich als zwei Nachbarländer scheinen zunächst eine große Ähnlichkeit bezüglich der politischen und sozialen Institutionen aufzuweisen. Doch gerade im Bereich der Arbeitsbeziehungen lohnt sich ein genauer Blick im Rahmen eines Vergleichs der beiden Nachbarn. Wie sind die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmer organisiert? Welche Rolle und in welcher Form spielen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände?
In der vorliegenden Arbeit sollen insbesondere die Gewerkschaften und ihre Rolle beleuchtet werden. Dazu wird zunächst der Korporatismus als Konzept erörtert und daraufhin auf die beiden Fälle eingegangen. Die unterschiedlichen Akteure der Arbeitsbeziehungen werden erörtert und die gewerkschaftlichen Strukturen der Länder in Form des DGB und des ÖGB sowie der parallel existierenden Organisationen beschrieben. Zudem wird auf die vielen Eigenheiten und Sonderfälle sowie wichtige korporatistische Arrangements eingegangen. Schließlich wird ein Vergleich gezogen, um zu zeigen, wo die wesentlichen Unterschiede in den beiden Staaten liegen und welche Auswirkungen das haben könnte. Zuletzt soll noch ein Ausblick auf die Zukunft der Arbeitsbeziehungen gegeben werden, denn im Rahmen neoliberaler Reformen und globalistischer Ideen ist das Korporatistische Konzept einem steten Wandel unterworfen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Systeme der Interessenvertretung
2.1 Pluralismus
2.2 Formen des Korporatismus
2.2.1 (staatlich-autoritärer) Korporatismus
2.2.2 Neokorporatismus
3. Deutschland
3.1 Allgemeine Akteure der Wirtschafts- und Arbeitsbeziehungen
3.1.1 Unternehmerverbände
3.1.2 Gewerkschaften
3.2 Der Deutsche Gewerkschaftsbund
3.2.1 Aufbau und Strukturen
3.2.2 Entwicklung nach der Deutschen Einheit
3.3 Phänomene der deutschen Arbeitsbeziehungen
3.3.1 Wichtige korporatistische Muster
3.3.2 Tarifautonomie
3.3.3 Arbeitskampf und Lohnverhandlungen
4. Österreich
4.1 Allgemeine Akteure der Wirtschafts- und Arbeitsbeziehungen
4.1.1 Arbeitgebervertretung
4.1.2 Arbeitnehmervertretung
4.2 Der Österreichische Gewerkschaftsbund
4.2.1 Aufbau und Strukturen
4.2.2 Entwicklung seit den 1990er Jahren
4.3 Phänomene der österreichischen Arbeitsbeziehungen
4.3.1 Sozialpartnerschaft und Paritätische Kommission
4.3.2 Kollektivverträge
4.3.3 Arbeitskampf und Lohnverhandlungen
5. Einordnung der Befunde und Fazit
Verzeichnis verwendeter Abkürzungen
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Dass die Verbändeforschung ein kompliziertes und insbesondere ein methodisch sowie empirisch wenig untermauertes Feld der Politikwissenschaft ist, machte der bekannte deutsche Fachvertreter Ulrich von Alemann bereits im Jahr 1993 deutlich. Dennoch scheint es besonders wichtig, die organisierten Interessen, die von Vereinen und Verbänden vertreten und artikuliert werden, auf ihre Strukturen und Rahmenbedingungen näher zu untersuchen, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten im internationalen Vergleich der Interessenvertretung feststellen zu können.1
Interessenverbände sind in den westlichen Demokratien überall sehr umfangreiche Akteure, die oftmals über die bloße Artikulation von Mitgliederinteressen hinaus politisch und gesellschaftlich aktiv werden. Diese Tatsache macht es nahezu unmöglich, die gesamte Arbeit und das Wirkungsfeld von Verbänden und verbandlicher Tätigkeit zu vergleichen oder auch nur umfassend zu beschreiben, was die spezifische Untersuchung wesentlich erschwert. Um hier dennoch eine spezifische Betrachtung zu unternehmen ist die Untersuchung auf einen einzelnen, sehr speziellen Bereich der Interessenvertretung beschränkt, nämlich den der Arbeitsbeziehungen. Genauer mit dem Schwerpunkt auf der gewerkschaftlichen Interessenvertretungen, wobei hier die wichtigsten Phänomene und Akteure der zu untersuchenden Fälle Beachtung finden werden. Gewerkschaften blicken nicht nur auf eine Tradition zurück, die untrennbar von der liberalen Interessenartikulation verbunden ist, sie sind im Bereich der Arbeitsbeziehungen auch einer der Hauptakteure in westlichen Demokratien.
Die beiden Fälle Deutschland und Österreich scheinen zunächst eine schwache Basis für einen Vergleich zu sein. Beide Länder sind moderne Dienstleistungsgesellschaften in Mitteleuropa mit eng verknüpfter Geschichte und ähnlichen Traditionen. Das spiegelt sich bis heute (nicht nur in der Namensgebung) wieder, etwa in der bundesstaatlichen Ordnung oder dem ähnlichen Parteiensystem. Sowohl Österreich als auch Deutschland weisen gewisse Neokorporatistische Muster auf, die jedoch mitunter sehr unterschiedlich ausgeprägt sind und vor allem auch in sehr verschiedenen Größenordnungen auftreten. Dabei ist die gesellschaftliche Partizipation in Verbänden und Vereinen, wie für koordinierte Marktwirtschaften - wozu beide Länder zählen - üblich, sowohl in Deutschland als auch in Österreich relativ hoch.2 Doch gerade die Tatsache, dass hier zwei Länder auf den ersten Blick sehr ähnliche Muster aufweisen, macht den Vergleich zu einer spannenden Analyse der vielen Details der beiden Verbändesysteme, denn hinter all den Gemeinsamkeiten verbergen sich zahlreiche, teils tiefgreifende Unterschiede.3
Insbesondere die institutionellen Unterschiede der beiden Systeme und die Charakteristik der Akteure, aber auch deren unmittelbare Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Staat sowie die Praxis der Arbeitsbeziehungen soll Kern der folgenden Ausarbeitung sein.
Um eine sinnvolle Untersuchung zu ermöglichen bietet es sich an, zeitlich mit der deutschen Wiedervereinigung in die Betrachtung einzusteigen. Für die Landschaft der organisierten Interessen in Deutschland war der Anschluss des Gebietes und der Bewohner der ehemaligen DDR ein einschneidendes Ereignis, schließlich trafen hier zwei gänzlich anders strukturierte Systeme zusammen und mussten fortan unter einem Dach weiter arbeiten. Die Verbandsentwicklung der Bundesrepublik wurde in vielerlei Hinsicht durch die deutsche Einheit verändert. Doch auch für Österreichs Gewerkschaften - und darüber hinaus für die gesamten Arbeitsbeziehungen des Landes
- sind die 1990er Jahre Zeiten der Veränderung gewesen. Strukturelle Wandlungen und eine Internationalisierung, symbolisch an dem EU-Beitritt festzumachen, waren prägend, allerdings auch eine Neuausrichtung der politischen Rahmenbedingungen. All diese Gründe sprechen dafür, dass die spezifische Entwicklung der vergangenen zwanzig Jahre einen ausgesprochen interessanten Betrachtungszeitraum darstellen. Um eine sinnvolle und nachvollziehbare Untersuchung anzustellen sollen hier zu Beginn unterschiedliche Muster und Theorien der Verbändeforschung erörtert werden. In der Folge werden die beiden Fälle detailliert nachvollzogen, insbesondere hinsichtlich der Akteure der Arbeitsbeziehungen und der wichtigsten Phänomene des Feldes, insbesondere in Bezug auf deren Bedeutung und Entwicklung im Betrachtungszeitraum. Schließlich ist es Ziel, Unterschiede zu erkennen, die sich unter der scheinbaren Ähnlichkeit der Systeme verbergen und einen Ausblick zu geben.
2. Systeme der Interessenvertretung
Bevor nun im Folgenden die Verbandsstrukturen und die Formen der organisierten Interessenvertretung in Deutschland und Österreich näher untersucht werden, ist es unerlässlich, zunächst einen Überblick über grundlegende Modelle und Systeme der Interessenvertretung, also die verschiedenen Theorien der Interessenvermittlung, zu schaffen. Die jeweiligen Ansätze unterscheiden sich hier vor allem im Hinblick auf die Rolle, welche die Verbände und Interessengruppen im jeweiligen Prozess der Interessenartikulation und -durchsetzung spielen.
Dabei sei vorweg gesagt, dass die verschiedenen Formen durchaus keine absoluten Gegensätze darstellen, sondern sich theoretisch und praktisch mitunter gegenseitig ergänzen.
2.1 Pluralismus
Um Pluralismus in Bezug auf die organisierte Interessenvertretung zu definieren, bedarf es zunächst einer begrifflichen Klärung. Nimmt man hierzu die philosophische Betrachtung von Pluralismus zur Hand, so bekommt man ein wahrnehmbares Weltbild mit einer Wirklichkeit aus „vielen einzelnen Fakten, Dingen, Ideen (...), die in sehr unterschiedlicher Weise zueinander in Beziehung stehen bzw. gesetzt werden können“4 beschrieben.
Daran lässt sich die politikwissenschaftliche Definition nahtlos anschließen, bedeutet Pluralismus bzw. ein pluralistisches System hier doch zu aller erst einmal eine soziale Wirklichkeit, in der eine Vielzahl unterschiedlichster Interessen nebeneinander existieren und miteinander in Konkurrenz stehen. Diese Interessen organisieren sich in Form von Verbänden, die bemüht sind, Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Alle Belange, die in der Gesellschaft vorhanden sind, sollen also durch eine Interessengruppe vertreten werden.5 Die pluralistische Idee stammt insbesondere aus der amerikanischen Politikwissenschaft, prägend waren an dieser Stelle die beiden Politikwissenschaftler Arthur F. Bentley und David B. Truman.6
Eine besonders wichtige Voraussetzung im Pluralismus ist die Idee, dass sämtliche Interessengruppen „selbständig und autonom ihre Ziele innerhalb des politischen Systems“7 verfolgen, das heißt, sie sind unabhängig von Staat und Regierung. Grundlage ist dabei stets die Annahme, dass sämtliche Interessen die gleichen Möglichkeiten haben, es also keine unterschiedlichen Einflussmöglichkeiten für verschieden große oder verschieden gut organisierte Gruppen gibt. Auch die Bedeutsamkeit der Interessen soll keine Rolle in Bezug auf den Einfluss spielen.8 In der Theorie ist eine Übermacht eines einzelnen Interesses deshalb nicht möglich, da sich stets eine Gegenmacht herausbildet, wodurch sich alle Verbände in ihrer Macht gegenseitig begrenzen.9 Gerade auch deshalb muss die Gründung von Verbänden in pluralistischen Systemen stets frei sein,10 festgehalten ist dieser Grundsatz etwa auch im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Art. 9 GG schützt ganz ausdrücklich die Freiheit, „Vereine und Gesellschaften zu bilden“11, insbesondere zum Zwecke der Vertretung von Interessen, wie aus Art. 9 Abs. 3 hervor geht.
Gesetzlicher Schutz für pluralistische Strukturen, wie im oben genannten Beispiel des Grundgesetzes, dienen dem Schutz der „Verfahrensregeln (…) und dass übermächtige Interessen nicht den Wettbewerb der Interessen dominieren.“12 Die Idee des Pluralismus wendet sich also ab von der Vorstellung, der Staat stünde den Bürgern gegenüber, wie sie in älteren Staatstheorien, etwa dem „preußisch-deutschen Staatsdenken“13 üblich war. Im Pluralismus, so die Erkenntnis, entsteht der Staat und staatliches Handeln also explizit aus der Gesellschaft heraus, die über die Interessenartikulation politische Entscheidungen beeinflussen kann.
In den 1960er Jahren brachte in Deutschland vor allem Ernst Fraenkel die Idee des Neopluralismus auf. Diese Theorie beschreibt einen Pluralismus, der nicht länger davon ausgeht, dass mächtige Interessengruppen „sich den auf Gemeinwohl bedachten Staat zur Beute machen könnten“14, allerdings auch erkennt, dass kein Wettstreit zweier gegenläufiger Interessen vorliegt, der letztendlich zum Gemeinwohl führt. Stattdessen beschreibt Fraenkel ein Kräfteparallelogramm, also ein Ziehen in unterschiedliche Richtungen, wodurch die ideale (mittlere) Lösung gefunden wird. Hier tritt die Politik auf den Plan, die jenes Gemeinwohl, aus dem Streit um Durchsetzung verschiedener Kräfte herausgebildet, erkennen und politisch umsetzen soll. Der Staat ist hierbei also für die Regelsetzung des Wettstreits um Durchsetzung der verbandsspezifischen Interessen zuständig.15 Dazu ist in Fraenkels Konzept eine Symbiose zwischen den politischen Parteien und den Verbänden unabdingbar.16
Kritik am Konzept der pluralistischen Gesellschaft kommt vor allem deshalb, weil empirische Studien eine Asymmetrie in der Interessendurchsetzung feststellen. Damit ist gemeint, dass einige Interessen bessere Durchsetzungsmöglichkeiten besitzen als andere. Dazu werden vor allem Interessen gezählt, die kaum verbandlich organisiert sind oder sich organisieren lassen und deswegen bereits von Grund auf schlechtere Chancen haben, Gehör zu finden, aber auch neu auftretende Interessen haben es schwerer, sich in einem etablierten System durchzusetzen. Darüber hinaus ist fraglich, ob ein tatsächliches Gleichgewicht zwischen den Interessengruppen besteht, da einige Interessen deutlich konfliktfähiger oder auch einfach finanzstärker sind, als andere.17 Beispielhaft für letzteres ist etwa die „Überlegenheit der Unternehmensverbände gegenüber den Gewerkschaften“, die damit auch „über mehr Macht verfügen“18.
2.2 Formen des Korporatismus
Neben der Idee des Pluralismus in der organisieren Interessenvertretung existieren aber noch weitere Ansätze, nämlich korporatistische.
Der Begriff Korporatismus stammt vom spätlateinischen Wort incorporare ab, was so viel bedeutet wie verkörpern oder einverleiben.19 Im hier betrachteten Zusammenhang ist unter Inkorporieren am ehesten ein Einbinden zu verstehen, nämlich das gezielte Beteiligen von Interessenverbänden in die politische Entscheidungsfindung.20 Als einer der wichtigsten Theoretiker, der sich mit dem Korporatismus als Konzept befasst und dieses geprägt hat, zählt zweifelsohne der amerikanische Politikwissenschaftler Philippe
C. Schmitter.
Da jedoch hinsichtlich dieser Einbeziehung unterschiedliche Möglichkeiten bestehen, soll der Korporatismus hier sinnvollerweise differenziert betrachtet werden, nämlich in seiner klassischen, staatlich-autoritären Form sowie in der Erscheinung als Neokorporatismus.
2.2.1 (staatlich-autoritärer) Korporatismus
Der Korporatismus in Bezug auf die Interessenvermittlungstheorie ist eine Idee, die ihre Herkunft nicht zuletzt in autoritären Regimen hat. Insbesondere in Mussolinis Italien wurde dieses System unter der Bezeichnung stato corporativo umgesetzt.21 Es handelt sich bei diesem autoritären Korporatismus um eine staatlich erzwungene Institutionalisierung der Interessenvertretung, bei der zwar eine Repräsentation der Interessen möglich ist, diese aber zeitgleich von der Regierung begrenzt werden können.22
Da diese extreme Form der Inkorporation von Verbänden in staatliches Handeln aber in der weiteren Untersuchung keine bedeutsame Rolle spielen wird, ist es nicht erforderlich, das Konzept detaillierter auszuführen. Wesentliche wichtiger - und deshalb hier gesondert behandelt - ist eine Theorie, die unter dem Begriff Neokorporatismus bekannt geworden ist.
2.2.2 Neokorporatismus
Wie oben bereits erwähnt, stehen sich die hier vorgestellten verschiedenen Konzepte nicht unbedingt strikt gegenläufig gegenüber sondern beschreiben lediglich andere Ansatzweisen. Sichtbar ist das vor allem im Falle des Neokorporatismus, der in der Praxis häufig als spezielle Ausprägung innerhalb grundsätzlich (neo)pluralistischer Systeme zu sehen ist. Schließlich ist in neokorporatistischen Systemen der Interessenvermittlung durchaus eine große Bandbreite an Verbänden vorhanden, diese können sich auch frei gründen und sind in ihrer Arbeit prinzipiell unabhängig. Allerdings geht der Neokorporatismus von Anfang an davon aus, dass bestimmte Verbände und Interessengruppen eine bessere Möglichkeit zur Einflussnahme haben, als andere.23
Unter den Theoretikern wird vielfach angenommen, dass ein neokorporatistisches Modell, das als solches in der Praxis auftritt, nicht existiert. Stattdessen existieren politische Systeme, die „mehr oder weniger ausgeprägte korporatistische Strukturen“24 aufweisen. Häufig ist auch deshalb eher die Rede von korporatistischen Ansätzen bzw. Konzepten, die in einzelnen Systemen unterschiedlich stark und in drei verschiedenen Dimensionen, nämlich politischen, sozialen und ökonomischen, auftreten.25
Anstelle grundsätzlich von „dem Neokorporatismus“ zu sprechen wird, um der Praxis in der Theorie gerecht zu werden, oftmals zwischen Makro-, Meso-, und Mikrokorporatismus unterschieden.26 Während makrokorporatistische Muster vor allem ganze Volkswirtschaften betreffen, beschränken sich mesokorporatistische Erscheinungen auf einzelne Wirtschaftsfelder. Der Mikrokorporatismus beschreibt dagegen die inkorporierte Interessenvertretung auf der untersten Ebene, etwa das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in einzelnen Unternehmen.27
Im Unterschied zum Pluralismus in seiner Reinform stellt das Konzept des Neokorporatismus keineswegs die, wie Bernhard Weßels es nennt, Einbahnstraße der Staat-Verbände-Beziehung dar.28 Neokorporatistische Ansätze gehen davon aus, dass Verbände auf der einen Seite die Interessen und Ansprüche ihrer Mitglieder ausarbeiten und vertreten, aber im Gegenzug ist es auch Aufgabe der inkorporierten Interessenverbände, Verhandlungsergebnisse und Kompromisse in den eigenen Reihen durchzusetzen. Die Verbände agieren im Neokorporatismus also insbesondere als Mittler zwischen den Interessen bzw. Forderungen der Mitglieder und dem Staat (im Falle des Makrokorporatismus) oder dem entsprechenden Gegenüber auf der Meso-/Mikroebene.29
Damit ist der Interessenverband in neokorporatistischen Strukturen auch ein Akteur, der eine Integrationsfunktion übernimmt und den Staat damit in seiner Aufgabenerfüllung unterstützt. Winter und Willems bezeichnen Interessenverbände in diesem Zusammenhang auch als „intermediäre Organisationen“30 zwischen Politik und Gesellschaft. Im Gegenzug dazu erhalten Verbandsvertreter Zugang zu politischen Entscheidungen, bis hin zu Einflussmöglichkeiten auf verschiedene Phasen des Gesetzgebungsverfahrens.31 Gepaart mit verbandsspezifischen (Partikular)interessen fließt durch diese Inkorporation auch Fachwissen in den legislativen Prozess ein. Hier wird durch korporatistische Modelle institutionalisiert, was in der pluralistisch-liberalen Theorie in Form des klassischen Lobbyismus stattfindet.
3. Deutschland
Für die weitere Untersuchung der Interessenvertretung insbesondere der Gewerkschaften soll hier nur zunächst das deutsche Verbändesystem, speziell die Arbeitsbeziehungen, erläutert werden. Dazu wird zunächst auf die unterschiedlichen Akteure eingegangen, wobei hier sinnvollerweise der Schwerpunkt bei den deutschen Gewerkschaften liegen wird. Insbesondere der Deutsche Gewerkschaftsbund und eine Auswahl dort organisierter Fachgewerkschaften soll darauf hin genauer betrachtet und auf die Rolle in den Arbeitsbeziehungen untersucht werden. Ebenfalls wird eine Einordnung des deutschen Systems von Verbänden und Staat erfolgen sowie in diesem Zusammenhang eine Reihe von korporatistischen Mustern in der Bundesrepublik vorgestellt.
3.1 Allgemeine Akteure der Wirtschafts- und Arbeitsbeziehungen
In Deutschland finden sich zahllose Interessenverbände und Lobbygruppen, die bemüht sind, die Interessen ihrer Mitglieder in den politischen Prozess einzubringen oder sich im Sinne des vermeintlichen Gemeinwohls zu engagieren, wie es bei zahlreichen Umweltschutz- oder Wohlfahrtsverbänden der Fall ist. Insgesamt kann von ca. 4.000 Verbänden in der Bundesrepublik ausgegangen werden, also einer Anzahl und Vielfalt, die unmöglich in ihrer Gesamtheit erfasst werden können.32 Für die Betrachtung der Arbeitsbeziehungen genügt es, das Feld von Interessenvertretungen aus dem Bereich der Ökonomie näher zu beleuchten. Dazu zählen die rund 1.000 Verbände, welche sich im Jahr 1994 in der vom Deutschen Bundestag geführten Lobbyliste registriert hatten.33 Für die Arbeitsbeziehungen eine wesentliche Rolle spielen dabei in Deutschland allerdings die Gewerkschaften als wichtigste Vertreter der Arbeitnehmer und die Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände als Organisationen der Kapitalseite. Auf diese soll im Folgenden eingegangen werden, um später Besonderheiten herausstellen zu können. Die beiden anderen Akteure der traditionellen groß en vier in Deutschland, die Kirchen und Bauernvereinigungen, können hier vor allem wegen ihres relativ geringen Einflusses auf die Arbeitsbeziehungen, außen vor gelassen werden.34
3.1.1 Unternehmerverbände
Unternehmerverbände vertreten im System der organisierten Interessen in der Bundesrepublik Deutschland die Belange der Wirtschaft, also der Arbeitgeberseite. Allerdings sind die Unternehmerverbände keineswegs einheitliche Organisationen, welche sich den umfangreichen Interessen im Ganzen annehmen, vielmehr findet man in Deutschland eine starke Ausdifferenzierung der Arbeitsbereiche vor. Auffällig ist hier zunächst die Organisationsform der 8035 regionalen Industrie- und Handelskammern (IHK), welche als öffentlich-rechtlich gestützte Einrichtungen36 eindeutig den umfassendsten Charakter unter den Unternehmerverbänden aufweisen. Sämtliche Unternehmen der Wirtschaft, freie Berufsgruppen, aber auch Betriebe aus Handwerk und Landwirtschaft sind zwangsläufig Mitglied der jeweiligen regionalen Kammer. Überregional organisieren sich die Industrie- und Handelskammern in 16 Landeskammern, die entsprechende den deutschen Bundesländern zugeordnet sind. Diese Zusammenschlüsse auf Landesebene nehmen zusammen mit den regionalen Kammern zahlreiche Aufgaben in Feldern wie der Berufsausbildung und lokaler Interessenvertretung wahr. Die einzelnen IHKs sind - im Gegensatz zu den Landesorganisationen - im DIHK, dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag, der bis zum Jahr 2001 den Namen Deutscher Industrie- und Handelstag (DIHT)37 trug, zusammengefasst. 38 In seinem Selbstverständnis ist der DIHK die Vertretungsinstanz aller selbstständigen IHKs auf Bundesebene, aber auch in der Öffentlichkeit und in gerichtlichen Fragen. Die Hauptorgane der DIHK sind die Vollversammlung aller Mitgliedskammern als höchster Instanz, einem Präsidenten sowie einer Vorstandschaft.39 Besondere Wichtigkeit kommt den Industrie- und Handelskammern nicht zuletzt auch deshalb zu, da sie öffentlich-rechtliche Aufgaben übertragen bekommen haben und wahrnehmen, also mit „partiell staatlichen Funktionen“40 ausgestattet sind. Dazu zählen neben der Überwachung der Berufsausbildung aber auch das Abliefern von Stellungnahmen zur wirtschaftlichen Situation in der entsprechenden Region gegenüber den staatlichen Stellen.41 Vor allem stellen die IHKs in der Praxis allerdings eine wichtige Vertretung der kleinen und mittelständischen Unternehmen dar.42
Neben den Kammern und den für die unmittelbaren Arbeitsbeziehungen meist weniger relevanten Statusverbänden finden sich zumindest zwei weitere wichtige Verbandstypen auf der Seite der Wirtschaft. Die Mitgliedschaft in diesen erfolgt, im Unterschied zu den Kammern, freiwillig.
Wirtschaftspolitische Anliegen der Unternehmen werden in Deutschland von sogenannten Wirtschaftsverbänden bzw. deren Spitzenorganisationen vertreten. Hier wäre, neben weiteren kleinen, vor allem der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zu nennen, die Dachorganisation der Wirtschaftsverbände, der industrielle und wirtschaftliche Interessen seiner Mitgliedsorganisationen -100.000 Unternehmen, verteilt auf 3843 Branchenverbänden aus 15 Landesvertretungen - gegenüber der Politik sowie der Öffentlichkeit vertritt. Die verbandsinterne Struktur des BDI beinhaltet eine Versammlung aller organisierten Mitgliedsverbände, diese hat das Haushalts- sowie das Wahlrecht für die (Vize-)Präsidenten. Die eigentliche Macht im Verband liegt allerdings nicht bei der Vorstandschaft aus Mitgliedsvertretern und Präsidium sondern, so beschreibt es Reutter, „bei Präsidenten, Vizepräsidenten, hauptamtlicher Geschäftsführung und Präsidium“44, jedoch wird der Wirtschaftsverband häufig von Großunternehmen dominiert.45
Um neben den politische Interessen der Unternehmer auch die Positionen gegenüber Gewerkschaften und Arbeitnehmern sowie in der Sozialpolitik zu vertreten, organisieren sich die Arbeitgeber im Spitzenverband der deutschen Arbeitgeberverbände, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverb ä nde (BDA). Im Unterschied zu den Wirtschaftsverbänden vertreten die Arbeitgeberverbände also die Interessen auf dem Arbeitsmarkt, eine eher ungewöhnliche Trennung innerhalb der OECD-Staaten.46 Der Bundesvereinigung gehören im Jahr 2012 52 Bundesfachspitzenverbände - also Fachvereinigungen aus diversen Branchen von Industrie über Handel, Verkehr bis zur Landwirtschaft - an, zudem 14 Landesvereinigungen von Arbeitgeber- bzw. Unternehmensverbänden.47
[...]
1 Von Alemann 1993:
2 Weßels 2007: S. 89 f.
3 Abromeit/Stoiber 2006: S. 137
4 Schubert/Klein: Das Politiklexikon, Pluralismus; http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/18012/pluralismus
5 Rieger 2008: S. 407 - 413
6 Kaiser 2006: S. 34
7 Schubert/Klein: Das Politiklexikon; Stichwort: Pluralismus; http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/18012/pluralismus
8 Hofmann/Dose/Wolf 2007: S.129 f.
9 Schubert/Klein: Das Politiklexikon; Stichwort: Pluralismus; http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/18012/pluralismus
10 Hofmann/Dose/Wolf 2007: S.130
11 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Art. 9 (1)
12 Hofmann/Dose/Wolf 2007: S.130 f.
13 Leibholz 1974: S. 98
14 Weßels 2000: http://www.bpb.de/apuz/25543/die-entwicklung-des-deutschen-korporatismus?p=all
15 Hofmann/Dose/Wolf 2007: S. 130 f. & Weßels 2000: http://www.bpb.de/apuz/25543/die-entwicklung- des-deutschen-korporatismus?p=all
16 Kaiser 2006: S. 34
17 Hofmann/Dose/Wolf 2007: S.131 & Kaiser 2006: S. 26 ff.
18 Kaiser 2006: S. 28
19 Duden: Stichwort „inkorporieren“: http://www.duden.de/rechtschreibung/inkorporieren
20 Hofmann/Dose/Wolf 2007: S. 131 f.
21 Von Alemann 2000: http://www.bpb.de/apuz/25539/vom-korporatismus-zum-lobbyismus?p=all
22 Linz 2007: S. 33
23 Hofmann/Dose/Wolf 2007: S. 132
24 Kaiser 2006: S. 36
25 Kaiser 2006: S. 36 f.
26 Von Alemann 2000: http://www.bpb.de/apuz/25539/vom-korporatismus-zum-lobbyismus?p=all
27 Andersen/Woyke 2003: Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland; Stichwort: Neokorporatismus; http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/handwoerterbuch-politisches- system/40335/neokorporatismus?p=all
28 Weßels 2000: http://www.bpb.de/apuz/25543/die-entwicklung-des-deutschen-korporatismus?p=all
29 Andersen/Woyke 2003: Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland; Stichwort: Neokorporatismus; http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/handwoerterbuch-politisches- system/40335/neokorporatismus?p=all
30 Winter/Willems 2007: S. 13
31 Kaiser 2006: S. 29-30
32 Reutter 2012: S. 139
33 Reutter 2003: S. 83
34 Schmidt 2008: S. 113 - 123
35 Abweichend von Reutter (2012) existieren derzeit in Deutschland 80 unabh ä ngige IHKs, welche sich auf 16 Landesorganisationen aufteilen. Die ergibt sich aus aktuellen Angaben auf der Internetseite des DIHK, abrufbar unter: http://www.dihk.de/wir-ueber-uns/wer-wir-sind/ihk
36 Schmidt 2008: S. 62
37 Schmidt 2008: S. 113
38 Reutter 2012: S. 141
39 DIHK: Wer wir sind. DIHK http://www.dihk.de/wir-ueber-uns/wer-wir-sind/dihk
40 Andersen/Woyke 2003: Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland; Stichwort: Unternehmerverbände; http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/handwoerterbuch- politisches-system/40393/unternehmerverbaende?p=all
41 Schmidt 2008: S. 62
42 Reutter 2012: S. 141
43 Abweichend von Reutter (2012) vertritt der BDI die Interessen von 38 Branchenverbänden, nachzulesen unter: http://www.bdi.eu/Mandat.htm
44 Reutter: S. 140
45 Reutter: S. 140 f.
46 Schroeder 2007: S. 197
47 BDA: Unsere Mitglieder http://www.bda- online.de/www/arbeitgeber.nsf/id/13C4948D0DD34D96C1256DE70069F2E1