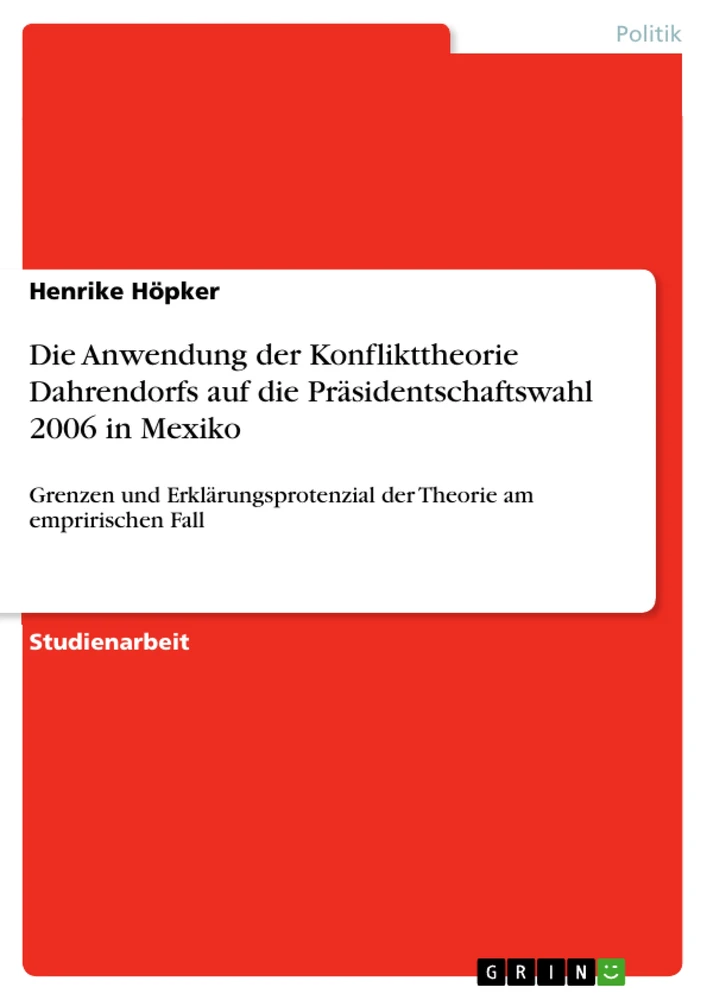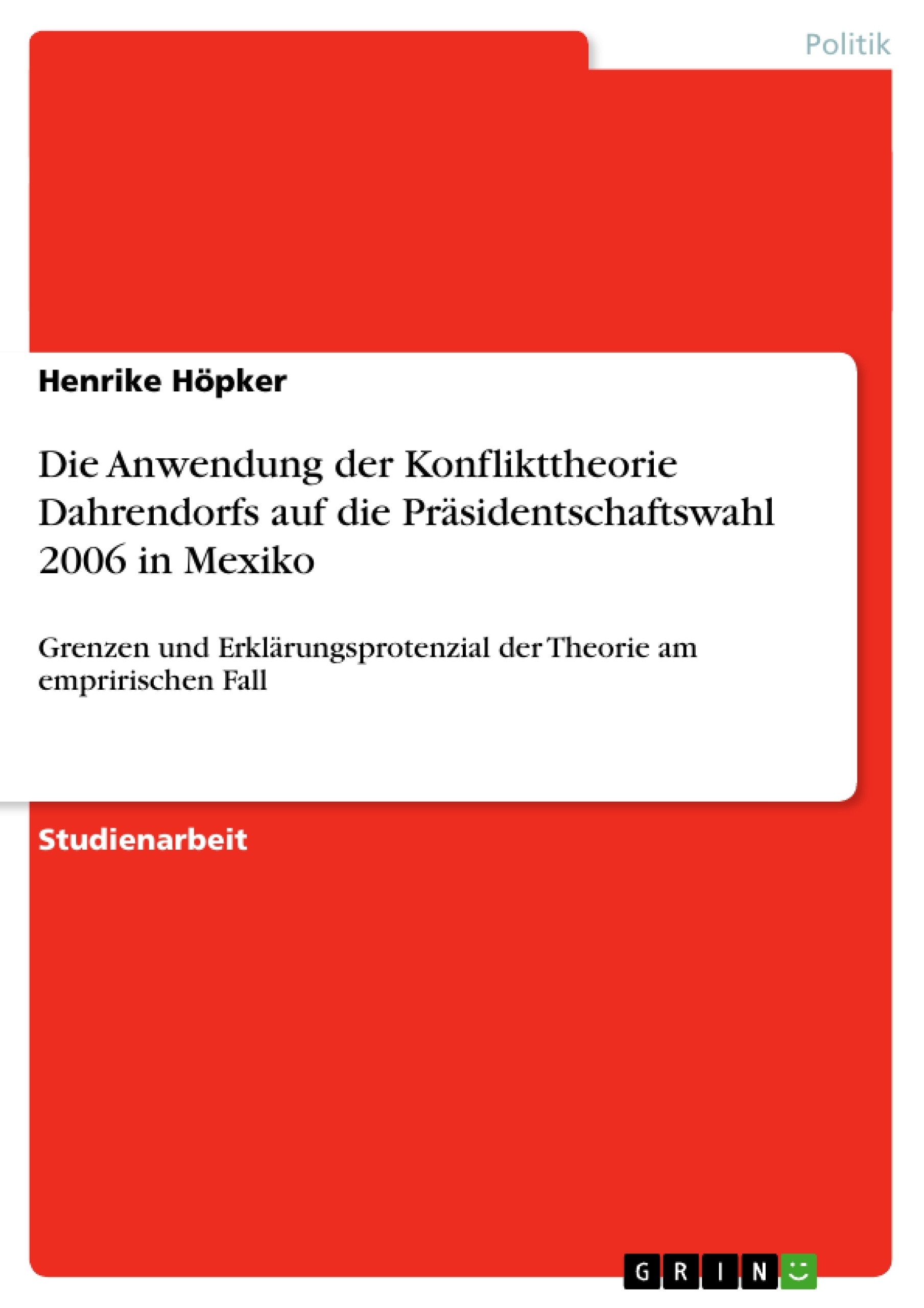Mexiko wurde über 70 Jahre lang von einer Partei regiert, bis dann im Jahr 2000, pünktlich zum Millenniumswechsel, ein Machtwechsel stattfand. Knapp gewann die PAN die Wahl und ein Regierungswechsel vollzog sich zum ersten Mal in Mexikos 2000 jähriger Geschichte friedlich. Doch wie sich zeigen sollte, war die Frage danach, wohin sich das Land entwickeln sollte, damit noch nicht endgültig gelöst. In Mexiko wird der Präsident alle sechs Jahre gewählt und kann nicht wiedergewählt werden, was jede Wahl aufs Neue interessant macht. Im Jahre 2006 dann äußerte sich die Wahl in erstaunlicher Intensität. Während 2000 die Entscheidung der Wähler hauptsächlich für oder gegen die alte Regierung war, so stellte sich die Auswahl 2006 weitaus komplexer da als zuvor. Dies lag zum einen da dran, dass die ehemalige Regierungspartei sich im Vorfeld erholt hatte und damit potenziell noch immer eine Alternative bot. Allerdings, wie zu zeigen sein wird, verspielte der Kandidat der PRI bereits in der Vorwahl seine Chancen auf den Wahlsieg. 2006 stand es um Mexiko wirtschaftlich gesehen weit besser als je zuvor: 2005 betrug die Inflation gerade mal 3,3 %, den geringsten Wert seit 1969 und die Ratingagentur Standart and Poor gab dem Land den geringsten Risikowert in seiner Geschichte. Dies wurde der Regierungspartei PAN zugerechnet, was sich positiv für diese auswirkte. Dagegen hatte die dritte Partei PRD einen beliebten und charismatischen Kandidaten aufgestellt, der vor allem in der Hauptstadt durch seine erfolgreiche Amtszeit als Bürgermeister äußerst beliebt war. Die Wahl blieb bis zum allerletzten Moment spannend und endete mit folgendem Ergebnis: Felipe Calderón Hinojosa von der Regierungspartei PAN gewann mit 0,58% gegen den Oppositionsführer Andrés Manuel Lopéz Obrador von der PRD.Dies führte zu wochenlangen massiven Protesten, der PAN wurde Wahlbetrug vorgeworfen. Im Folgenden soll eine Analyse der Wahlvorgänge erfolgen. Hierfür wird zunächst ein Blick auf die Vorgeschichte des Landes geworfen, beginnend bei der mexikanischen Revolution. Dies ist notwendig, da die Ereignisse des Jahres 2006 nur im Zusammenhang mit der stark verzögerten Demokratisierung des Landes richtig einzuordnen sind. Anschließend werden die Ereignisse der Wahl 2006 genauer betrachtet und danach wird versucht, die Ereignisse mit dem Instrument der Konflikttheorie Dahrendorfs zu erfassen.
Inhalt
Einleitung
1.Mexiko und die Wahlen des Jahres 2006
1.1 Die Vorgeschichte
1.2 Der Konflikt um die Wahl des Jahres 2006
1.3 Der Wahlkampf
1.4 Die Proteste gegen die Wahl
2. Die Konflikttheorie von Ralf Dahrendorf
2.1 Grundlagen der Theorie
2.2 Konflikt als Klassenkampf
2.4 Die Konkretisierung der Theorie
2.5 Das Konzept der Lebenschancen
Fazit
Anhang
Literaturverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abbildung 1: Wahlen vom 2. Juli 2000
Tabelle 1: Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2000
Abbildung 2: Häufigkeit der angesprochenen Themen in Reden zum Wahlkampf
Abbildung 3: “Themenbesitz der einzelnen Kandidaten im Zeitverlauf der Wahlkampagne”
Abbildung 4: Wählerwahrnehmung der Parteien auf einer 5-Punkte-Skala
Abbildung 5: Wahlkoalitionen 2006: Wahrscheinlichkeit des Wahlverhaltens nach rechts-links Selbsteinordnung und Klassen Indikatioren
Abbildung 6: Karte der Präsidentschaftswahl 2006 in Mexiko, Ergebnisse nach Bundesländern
Abbildung 7: Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2006 in Prozent
Tabelle 2 Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2006 in Prozent
Tabelle 3: Schema nach Dahrendorf (1979)
Einleitung
Mexiko wurde über 70 Jahre lang von einer Partei regiert, bis dann im Jahr 2000, pünktlich zum Millenniumswechsel, ein Machtwechsel stattfand. Knapp gewann die PAN die Wahl und ein Regierungswechsel vollzog sich zum ersten Mal in Mexikos 2000 jähriger Geschichte friedlich. Doch wie sich zeigen sollte, war die Frage danach, wohin sich das Land entwickeln sollte, damit noch nicht endgültig gelöst. In Mexiko wird der Präsident alle sechs Jahre gewählt und kann nicht wiedergewählt werden, was jede Wahl aufs Neue interessant macht. Im Jahre 2006 dann äußerte sich die Wahl in erstaunlicher Intensität. Während 2000 die Entscheidung der Wähler hauptsächlich für oder gegen die alte Regierung war, so stellte sich die Auswahl 2006 weitaus komplexer da als zuvor. Dies lag zum einen da dran, dass die ehemalige Regierungspartei sich im Vorfeld erholt hatte und damit potenziell noch immer eine Alternative bot. Allerdings, wie zu zeigen sein wird, verspielte der Kandidat der PRI bereits in der Vorwahl seine Chancen auf den Wahlsieg. 2006 stand es um Mexiko wirtschaftlich gesehen weit besser als je zuvor: 2005 betrug die Inflation gerade mal 3,3 %, den geringsten Wert seit 1969 und die Ratingagentur Standart and Poor gab dem Land den geringsten Risikowert in seiner Geschichte.[1] Dies wurde der Regierungspartei PAN zugerechnet, was sich positiv für diese auswirkte. Dagegen hatte die dritte Partei PRD einen beliebten und charismatischen Kandidaten aufgestellt, der vor allem in der Hauptstadt durch seine erfolgreiche Amtszeit als Bürgermeister äußerst beliebt war.
Die Wahl blieb bis zum allerletzten Moment spannend und endete mit folgendem Ergebnis: Felipe Calderón Hinojosa von der Regierungspartei PAN gewann mit 0,58% gegen den Oppositionsführer Andrés Manuel Lopéz Obrador von der PRD. Dies führte zu wochenlangen massiven Protesten, der PAN wurde Wahlbetrug vorgeworfen.
Im Folgenden soll eine Analyse der Wahlvorgänge erfolgen. Hierfür wird zunächst ein Blick auf die Vorgeschichte des Landes geworfen, beginnend bei der mexikanischen Revolution. Dies ist notwendig, da die Ereignisse des Jahres 2006 nur im Zusammenhang mit der stark verzögerten Demokratisierung des Landes richtig einzuordnen sind. Anschließend werden die Ereignisse der Wahl 2006 genauer betrachtet und danach wird versucht, die Ereignisse mit dem Instrument der Konflikttheorie Dahrendorfs zu erfassen. Die Analyse des empirischen Falles ist in die Erklärung der Theorie integriert, was eine konkretere Betrachtung erlaubt. Es werden die meisten wichtigsten Details der Theorie Dahrendorfs erläutert werden, doch werden einige Aspekte, welche keine Relevanz für den vorliegenden empirischen Fall haben, ausgeblendet, damit der Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht gesprengt wird.
Der empirische Fall der Wahlen 2006 wird breiter erläutert werden und am Anfang stehen, was das Risiko eindämmen soll, dass die Empirie von vorne herein in die Theorie „gezwängt“ wird. Aus diesem Grund wird versucht möglichst verschiedene Aspekte mit aufzunehmen. Dennoch kann die vorliegende Arbeit natürlich nicht die Wirklichkeit in seiner ganzen Komplexität abbilden, sondern ihrem Umfang entsprechend nur ausgesuchte Elemente eingehend untersuchen.
1.Mexiko und die Wahlen des Jahres 2006
1.1 Die Vorgeschichte
Die Diktatur von Profirio Días[2] wurde von der sogenannten mexikanischen Revolution beendet. Entgegen dem, was der Begriff vortäuscht, handelte es sich bei dieser Revolution nicht etwa um eine einheitliche Bewegung, sondern um verschiedene Einzelbewegungen, deren einziges gemeinsames Ziel es war die Diktatur zu beenden. Besonders bekannt für die regionalen Bewegungen sind im Norden die División del Norte unter Franciso Villa und im Süden und Zentrum das Ejèrcito Libertador del Sur angeführt von Emiliano Zapata.[3] Die Verfassung, welche Mexiko sich im Folgenden 1917 gab, galt allgemein als äußerst fortschrittlich und beinhaltete neben Errungenschaften wie dem Wahlrecht, Rechtssicherheit, bürgerlichen Freiheitsrechten und Eigentumsgarantie, auch Elemente wie die Landreform, das Streikrecht und sozial-staatliche Rechte wie eine Sozialversicherung und ein staatliches Gesundheits- und Bildungwesen.[4] Doch trotz der fortschrittlichen Verfassung bildete sich in Mexiko ein als autoritär[5] zu bezeichnender Staat heraus, welcher sich einen Anschein von demokratischer Legitimation durch die formal institutionellen Strukturen[6] und die Berufung auf ihr revolutionäres Erbe[7] gab. Die Regierungspartei Partido Revolucionario Institutional (PRI)[8] regierte das Land entsprechend von 1917 bis 1979, als die PRI ihre absolute Mehrheit bei den Kongresswahlen verliert, beziehungsweise bis 2000, als sie die Präsidentschaft an die Partido Acción National (PAN) mit dem Kandidaten Vicente Fox Quesada verliert. Merkel schreibt über das mexikanische System folgendes:
„Fraglos ist gleichwohl, dass es sich bei der gewählten Herrschaft des Partido Revolucionario Institutional (PRI) um ein Unikum handelt (Mols/Tobler 1979): Nach der Konsolidierung des Regimes in den 1930er Jahren wurde im Sechsjahresrytmus (sexenio) ein neuer Präsident gewählt. Dieses Präsidialregime stellt eine zivile Autokratie dar, die zwar die gesellschaftliche Organisation und Partizipation von oben her organisierte, aber auch für eine relativ bereite Verankerung in der Gesellschaft verfügte und wenig von einzelnen Führungspersonen abhängig war (Lauth/ Horn 1995; Faust 2001).“[9]
Dies kann auch als eine Erklärung angesehen werden, warum das mexikanische System über einen derart langen Zeitraum stabil war. Wann die „stark verzögerte Transition“[10] in Mexiko begann ist strittig. Angegebene Punkte sind unter anderem die Studentenproteste 1968. Bei diesen forderten Studenten politische Partizipationsmöglichkeiten jenseits der PRI. Die Proteste wurden aber von dem noch starken Staat niedergeschlagen: Bei dem „Massaker von Tlatelolco“ am 2. Oktober 1968 wurden hunderte Demonstranten vom Militär erschossen.[11] Doch, so Schütz:
„Das repressive Vorgehen der Regierung gegen die studentische Bewegung konnte jedoch den Protest von breiten Bevölkerungsschichten der mexikanischen Gesellschaft nicht ersticken. Im Gegenteil, die brutale Unterdrückung der studentischen Proteste brachte erstmalig das irreparable Legitimationsdefizit des Herrschaftssystems der PRI der gesamten Öffentlichkeit in Bewusstsein. Die Studentenbewegung war der symbolische Anfang des Endes eines sozialen Modells, jedoch war sie nicht die einzige Protestbewegung dieser Zeit; breite Teile der Zivilgesellschaft begannen, die politischen Entwicklungen des Landes zu kritisieren.“[12]
Als ein anderer Punkt des Beginns der Transition wird die Wahlreform von 1977 in der Literatur genannt.[13] Diese beinhaltete, dass Parteien als gemeinnützige Organisationen anerkannt wurden. Dadurch erhielten sie das einklagbare Recht an Wahlen teilzunehmen.[14] Ziel der Reform, so Merkel, sei es gewesen, die linken Parteien zu integrieren, ohne eine Gefahr für die Hegemonie der PRI darzustellen.[15]
Ein weiterer Meilenstein in der Demokratisierung Mexikos, der auch insbesondere für die Analyse der Wahlen 2006 von besonders hoher Relevanz ist, sind die Präsidentschaftswahlen von 1988. Bei diesen trat der ausgetretenen PRI-Politiker Cauhtémoc Cárdenas mit anderen ehemaligen Mitgliedern der Partei und verschiedenen linken Parteien und sozialen Bewegungen unter der Partei Frente Democrático Nacional (FDN) an.[16] Cardenas betrieb einen sehr aufwendigen Wahlkampf und reiste unter anderem auch zu den großen Migrantengruppen in den USA, obwohl diese nach damaligen Recht überhaupt keine Möglichkeit hatten zu wählen.[17] Dadurch erhielt er große Unterstützung. Doch als er am Wahltag bei der ersten Hochrechnung vor dem PRI Kandiaten (Salinas de Gortari) lag, kam es zu einem angeblichen Zusammenbruch des Computersystems der Wahlbehörde. Nachdem der angebliche Fehler behoben wurde, stand der PRI-Kandidat als offizieller Gewinner fest.[18]
Dies legt natürlich einen Wahlbetrug nahe und wurde in der mexikanischen Bevölkerung auch von vielen als solcher aufgefasst. Nach der Niederlage gründete Cárdenas die Partido de la Revolución Democrática (PRD),[19] was Lopez Obrador zum einem Nachfolger von Cárdenas macht. Relevant ist in dem Zusammenhang, dass sich die Stärke der PRD zu der Zeit auch stark auf Cárdenas Popularität bei den Exil-Mexikanern in den USA gründete. Deren Macht kam zwar nur indirekt zum Tragen, zum einen durch die zunehmend größeren finanziellen Rücküberweisungen, zum anderen, vor allem in ländlichen Gebieten, dadurch, dass die Migranten durch das Cargo-System politischen Einfluss ausübten.[20]
Ein weiterer Grund dafür, dass die PRI letztendlich ihre Macht verlor, mag auch in der neoliberalen Umgestaltung der Wirtschaft des Landes zu finden sein. Denn nachdem Mexiko 1982 zahlungsunfähig war, diktierte der IWF ein Sturanpassungsprogramm, welches „die Liberalisierung der Preise und der Marktregularien, die Öffnung des Binnenmarktes für Importe, die drastische Reduzierung des öffentlichen Sektors, die Minimierung des regulierenden Einflusses des Staates in der Wirtschaft und die Beseitigung seiner Rolle als Unternehmer“[21] beinhaltete. Dies wurde dann fortgesetzt und zementiert mit dem Abschluss des North American Free Trade Agreements (NAFTA) 1994 mit den USA und Kanada.[22]
Der gesellschaftliche Unmut über diese Entwicklung zu neoliberalem Umbau kann als ein mitverantwortlicher Aspekt für die Popularität Cárdenas gesehen werden.
Nicht zuletzt darf man bei der Betrachtung der Entwicklung Mexikos das Auftauchen der zapatistischen Rebellen im Januar 1994 Jahre nicht außer Acht lassen: Sorgte dies noch 1994 für die Wahl des PRI-Kandidaten Zedillo[23], so führte die Unfähigkeit der Regierung die Gewalt einzudämmen dann aber auch mit zur Abwahl der Partei.[24] Die Wahl im Jahre 2000 spitzte sich auf eine Wahl für oder gegen die Regierung zu, was dazu führte, dass auch Wähler, die eigentlich nicht mit der PAN sympathisierten, für diese stimmten.[25] Die Wahl wurde zwischen Francisco Labastida (PRI) und Vicente Fox (PAN) entschieden. Cárdenas, der mittlerweile zum dritten Male antrat, blieb weit zurück und galt auch während des Wahlkampfes weitgehend als chancenlos.
Die Ergebnisse sind in der Abbildung 1 im Anhang dargestellt, Tabelle 1 zeigt die entsprechenden Daten.
Wie aus den Ergebnissen auch zu erkennen ist, ging die Wahl um den Präsidenten weitaus deutlicher aus, als die um das Abgeordnetenhaus aus: Bei letzterem besteht gerade mal ein knapper Vorsprung von 1,32%, während Fox doch deutlich mit 6,42% vor Labatista liegt.
Es scheint als wäre bei der Wahl letztendlich auch eine Systemfrage geklärt worden, worauf auch die Ereignisse rund um die Wahl des Jahres 2006 hindeuten, wie später noch erläutert wird. Die Sorgen die der Wandel für die Mexikaner mit sich bringt zeigen sich nicht zuletzt an folgender Anekdote: Bei seiner Siegesfeier verkündete Vicente Fox „Die Politik ist für die Gewinner, die Verlierer bleiben außen vor“, woraufhin ihm die Menge seiner Anhängerschaft mit den Worten antwortete „No nos falles, Vicente!“ –„Entäusch uns nicht, Vicente !“[26]
1.2 Der Konflikt um die Wahl des Jahres 2006
“Por primera vez, el resultado es tan incierto que el único pronóstico fiable señala que el nuevo presidente no saldrá de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el referente de la política mexicana durante 70 años”[27]
So äußerte sich die spanische Zeitung El País über den den Wahlkampf des Jahres 2006. Doch nicht nur im Hinblick auf die eigentliche Wahl, war es ein Kampf der „ersten Male“ für Mexiko. Schon die Auswahl der Kandidaten zeigte an, dass die dieses Mal alles anders sein würde:
„The 2006 election presented numerous firsts in Mexican presidential candidate selection. It was the first election in which the Industrial Revolutionary Party (PRI) lacked the firm hand and watchful eye of its own sitting president to guide the process. For the party of the Democratic Revolution (PRD), it was the first election where the party ran a different candidate than its principal founder, Cuautémoc Cárdenas, as well as the first presidential race in which the party appeared likely to win. Finally, 2006 was the first time in which a relatively unknown National Action Party (PAN) contender with limited electoral experience defeated better-known rivals for his party’s nomination and ultimately captured presidency.”[28]
Ein genauerer Blick auf die einzelnen Kandidaten ist an dieser Stelle lohnenswert: 1. Felipé Calderon für die PRI. Calderon hatte verhältnismäßig wenig Wahlkampferfahrung und erschien zunächst eher als die unwahrscheinlichste Wahl für einen Kandidaten zur Präsidentschaftswahl. Er setzte sich in der Präsidentschaftskandiadtenwahl überraschend gegen Alberto Cárdenas Jiménez und Santiago Creel durch. Die beiden andere Kandidaten waren bei weitem wahrscheinlichere Alternativen als Calderon, da beide die Unterstützung des vorherigen Präsidenten Vicente Fox hatten. Insbesondere Creel, der nicht nur durch seine Position als Regierungssekräter[29] äußerst sichtbar war, sondern auch indirekte Unterstützung von Fox signalisiert bekommen hatte, galt lange als Favorit.[30] Dennoch gelang es Calderón, sich gegen die auf den ersten Blick aussichtsreicheren Kandidaten durchzusetzen. Die Auswahl des Kandidaten für die PAN findet in drei Wahlgängen statt,[31] wobei zu beachten ist, dass die Mitgliederanzahl der PAN verhältnismäßig gering ist. So hatte die PAN 2006 gerade mal eine Million Mitglieder, die zur Wahl des Kandidaten berechtiget waren.[32] Dies soll erwähnt werden, da es bedeutet, dass die Wahl des Kandidaten nicht etwa wie in den USA darüber erfolgt, wer national am besten ankommt. Während der drei Wahlgänge steigerte sich Calderón von knapp 46% im ersten Wahlgang, auf 50% im zweiten Wahlgang, zu ca. 58% im letzten Wahlgang.[33] Zum Teil ist der Erfolg mit der Unterstützung Foxes für die anderen Kandidaten zu sehen: Nicht jeder in der Partei hegte nur positive Gefühle gegenüber Fox und seiner Präsidentschaft.[34] Calderón gelang es sich zu einer Art Rebellen zu stilisieren und betitelte sich selbst als „Ungehorsamer Sohn“.[35] So trat Calderón zum Beispiel von seinem Posten als Energieminister im Juni 2004 zurück, nachdem Fox seine Kandidatur öffentlich als „unklug und unangemessen“ bezeichnet hatte.[36] Auch die beiden anderen Kandidaten bemühten sich, Calderón zu demontieren: So stellte Creel nach der zweiten Runde am 2. Oktober 2005 die Ergebnisse aus dem Staat Yucatan infrage. In der dritten Runde am 23. Oktober 2005, behauptete Jimenez Cárdenas außerdem, dass Mitglieder aus Jalisco unter Druck gesetzt wurden, um für Calderón zu stimmen.[37] Dies sollten nur die ersten von vielen Anschuldigungen und Skandalen in diesem Wahlkampf sein. Trotz der Animositäten schaffte es aber die PAN dann doch eine einigermaßen geschlossene Front zu zeigen, als Creel seine Niederlage eingesteht und Calderon seine Unterstützung zusagt.[38]
2. Der großen Verlierer der Wahl 2006 waren Roberto Madrazo und die PRI. Traditionell wurde der Präsidentschaftskandidat der Partei von dem vorhergehenden Präsidenten bestimmt, die Wahl des Kandidaten war lediglich eine Formalität. Und da die Partei über 70 Jahre lang die Alleinherrschaft innehatte, bedeutete dies auch, dass der Bestimmte Präsident werden würde.[39] Das erste Mal mit dieser Tradition gebrochen wurde 1994, als der ausgewählte Kandidat Luis Donaldo Colosio erschossen wurde und Ernesto Zedillo, sein Kampagnenchef, die Position übernahm. Zedillo stellte nicht nur die Weichen dafür, dass andere Parteien als die PRI gewählt werden konnten,[40] er überließ die Wahl seines Nachfolgers auch der eigenen Partei.[41]
Nach der Niederlage bei der Wahl des Jahres 2000, schaffte es die Partei es zunächst sich erstaunlich gut zu erholen. Sie gewannen erheblich bei den Kongresswahlen 2003 und schafften es 2004 und 2005 etliche politische Ämter zu erringen. 2005 gewannen PRI-Kandidaten drei von fünf Gouverneurswahlen.[42]
Dagegen waren aber die Probleme bei internen Entscheidungen der Partei schon 2002 zu Tage getreten. In diesem Jahr wurde die Nachfolge der Parteipräsidentschaft beschlossen. Roberto Madrazo trat in dieser Wahl gegen Beatriz Paredes an.[43] Da sich die Partei intern nicht auf einen der beiden Bewerber einigen konnte, öffneten sie die Wahlen landesweit, auch für Nicht-Mitglieder. Drei Millionen Mexikaner beteiligten sich an der Wahl, welche Madrazo knapp gewann. Doch kurz darauf wurden Unregelmäßigkeiten in fast drei Dutzend Wahllokalen bekannt. 10 000 Stimmen wurden für ungültig erklärt, dennoch gewann Madrazo.[44]
Die Wahl erzeugte damit nicht das gewünschte saubere Bild einer geschlossenen Partei.
Madrazo startete mit einer erheblichen Anzahl von Feinden in die Vorauswahl zum Präsidenschaftskandidaten. Als die Wahl näher rückte, schlossen sich diese zu einem Bündnis zusammen, welches sie hintergründiger, wie bezeichnender Weise Todos Unidos Con México (Alle gemeinsam für Mexiko), mit dem Kürzel TUCOM, benannten. Nicht aus Versehen wurde das Kürzel allgemein als Todos Unidos Contra Madrazo (Alle gemeinsam gegen Madrazo) gelesen.[45]
Problematisch für Madrazo war darüber hinaus, dass er um zur Präsidentschaftswahl antreten zu können von seinem Posten als Parteivorsitzender zurücktreten musste. Dies hätte aber automatisch seine einstige Verbündete und nach einer Intrige verbitterte Feindin Elba Esther Gordillo nachrücken lassen. Madrazo verhinderte dies aber schlussendlich, indem er gegen die Regeln verstieß und einen Parteivorsitzenden bestimmte.[46]
TUCOM stellte den Gouverneur des Staates Mexiko Arthuro Montiel als Gegenkandidaten zu Madrazo auf. Montiel schien zunächst aussichtsreich, doch zog er sich in letzter Minute zurück als finanzielle Skandale über Montiel bekannt wurden. Montiel zog daraufhin seine Kandidatur zurück. Da die Bestimmungen der PRI keine Nominierungen mehr zu ließ und alle Kandidaten gegen Madrazo sich hinter Montiel gestellt hatten, bis auf den einen quasi aussichtslosen Kandidaten, wurde Madrazo der Präsidentschaftskandidat der PRI.[47]
Wie Shirk feststellt : „In the general election, the impact of PRI`s candidate selection process was perhaps even more significant than in either of the two political parties. It is hard to imagine a more divisive primary.” [48]
Entsprechend findet sich hier bereits eine Erklärung für die hohe Niederlage der Partei in der Wahl: Nicht nur wurde Madrazo bereits in der Vorauswahl negative behaftet, das Bündnis TUCOM behielt ihm durch den Wahlkampf hindurch auch die Unterstützung vor.[49]
[...]
[1] Lawson, Chappell H. (2009): Introduction. The Mexican 2006 election in context. In: Jorge I. Domínguez, Chappell H. Lawson und Alejandro Moreno (Hg.): Consolidating Mexico's democracy. The 2006 presidential campaign in comparative perspective. Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press, S. 1–28.
, S. 11. Standart and Poor gab Mexiko 2005 die Risikobewertung 114; zum Vergeleich bei Foxes Amtsantritt betrug der Wert 411.
[2] Von 1867-1911.
[3] Vgl. Schütze, Stefanie (2009): Klientelistische Strukturen und der Kampf um "Tierra y Libertad". Soziale Bewegungen in Mexiko. In: Mittag, Jürgen; Ismar, Georg (Hg.): ¿"El pueblo unido". Soziale Bewegungen und politischer Protest in der Geschichte Lateinamerikas. 1. Aufl. Münster: Verl. Westfälisches Dampfboot, S. 37–56, S. 37-38. In der Literatur wird an einigen Stellen diskutiert, ob es sich bei der mexikanischen Revolution tatsächlich um eine „echte“ Revolution handelt, aufgrund der starken Vereinzelung und des regionalen Charakters der Bewegungen. Diese Frage soll hier aber nicht weiter behandelt werden, da sie für die Thematik der Hausarbeit nicht weiter relevant erscheint.
[4] Vgl. Ebd, S. 40-41.
[5] Ebd. S.41.
[6] Vgl. Ebd. S. 41.
[7] Vgl. Ebd., S. 39.
[8] Dt. Partei der institutionellen Revolution. Auch der Name verweist auf den Legitimitätsanspruch, welchen die Partei erhebt.
[9] Merkel, Wolfgang (2010): Systemtransformation. Eine Einführung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung. 2., überarb. und erw. Aufl. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss. (Lehrbuch), S. 213.
[10] Ebd. S. 220
[11] Schütze, Stefanie (2009): Klientelistische Strukturen und der Kampf um "Tierra y Libertad". a.a.O. S. 43.
[12] Ebd. S. 43. Vgl. auch Merkel, Wolfgang (2010): Systemtransformation, a.a.O., S. 220.
[13] Bei Ebd., S.220.
[14] Schütze, Stefanie (2009): Klientelistische Strukturen und der Kampf um "Tierra y Libertad". a.a.O. S. 44.
[15] Merkel, Wolfgang (2010): Systemtransformation. Eine Einführung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung. a.a.O, S. 221.
[16] Schütze, Stefanie (2009): Klientelistische Strukturen und der Kampf um "Tierra y Libertad". S. 47.
[17] Ebd. a.a.O. S. 52.
[18] Ebd. a.a.O., S. 47.
[19] Schütze, Stefanie (2009): Klientelistische Strukturen und der Kampf um "Tierra y Libertad". a.a.O. S. 47.
[20] Ebd.. S. 52-53. Unter dem Cargo-system ist ein quasi-feudales System, welches in ruralen Gebieten zum Teil noch heute im Einsatz ist. Es besteht darin, dass von allen Männern der Gemeinschaft erwartet wird, verschiedene religiöse wie ziviele Ämter zu übernehmen. Diese Ämter werden zumeist für ein Jahr übernommen und sind unbezahlt. Zu den wichtigsten Aufgaben dabei gehören, dass Sponsoring von religiösen Festen. Die Männer durchlaufen die verschiedenen „Cargos“ (Ämter), um dann im Alter ihren Platz als älteste Einzunehmen, welche wichtige Entscheidungen des Dorfes treffen und bestimmen, wer welches Amt übernimmt. Vgl. Friedlander, Judith (1981): The Secularization of the Cargo System: An Example from Postrevolutionary Central Mexico. In: Latin American Research Review 12 (2), S. 132–143. Online verfügbar unter http://www.jstor.org/stable/2503128, zuletzt geprüft am 04.03.2012, S. 132. Aufgrund dessen, dass viele der Verpflichtungen finanzieller Natur sind, können diese Aufgaben auch von den Migranten erfüllt werden, was diesen Einfluss sichert, s. Hierzu auch Schütze, Stefanie (2009): Klientelistische Strukturen und der Kampf um "Tierra y Libertad", a.a.O. S. 53.
[21] Ebd. S.44.
[22] Ebd, S. 46.
[23] Maihold, Günther (2000 ): Mexiko 2000 - Das Ende einer Ära. Folgt auf den Regierungsswechsel auch ein stabiler politischer Wandel? Institut für Iberoamerika-Kunde Hamburg. Hamburg (Brennpunkt Lateinamerika, 13), S.131. Online verfügbar unter http://www.giga-hamburg.de/dl/download.php?d=/content/ilas/archiv/brennpunkt_la/bpk0013.pdf, zuletzt geprüft am 5.03.12. Diesmal mal allem Anschein nach ohne Wahlbetrug.
[24] Ebd. S. 131. Siehe außerdem
[25] Lawson, Chappell H. (2009): Introduction. The Mexican 2006 election in context, a.a.O. S. 4.
[26] Maihold, Günter (2000): Mexiko 2000, a.a.O, S.152
[27].- “Zum ersten Mal ist das Ergebnis so unsicher, dass die einzige verlässliche Prognose signalisiert, dass der der neue Präsident nicht aus den Reihen der Partido Revolucionario Institutional (PRI) stammt, welche der Maßstab der mexikanischen Politik 70 Jahre lang war.” Relea, Francesc (2006): Un país, dos visiones antagónicas. In: El País, 11.06.2006. Online verfügbar unter http://elpais.com/diario/2006/06/11/internacional/1149976801_850215.html, zuletzt geprüft am 05.03.2012. (Übersetzung sinngemäß HH)
[28] Shirk, David A. (2009): Choosing Mexico's 2006 Presidential Candidates. In: Jorge I. Domínguez, Chappell H. Lawson und Alejandro Moreno (Hg.): Consolidating Mexico's democracy. The 2006 presidential campaign in comparative perspective. Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press, S. 129–151, S. 129.
[29] Secretario de Gobernación; vgl. Mit einem dt. Innenminister.
[30] Vgl. Shirk, David A. (2009): Choosing Mexico's 2006 Presidential Candidates, a.a.O. S. 134.
[31] Ebd. S. 136.
[32] Ebd. S. 135.
[33] Ebd. S. 137.
[34] Ebd. S. 136.
[35] „Desobiedient son“ hatte eine Doppelbedeutung, da Calderóns Vater, einst eine wichtige Figur in der PAN, aus dieser ausgetreten war. Sein Sohn blieb dennoch in der Partei, war also ein „ungehorsamer Sohn“. Gleichzeitig konnte er damit auf Fox anspielen. Vgl. Ebd. S. 138.
[36] Vgl. Ruiz, José Luis (2004): "La descalificacíon fue injusta". In: El Universal, 01.06.2004. Online verfügbar unter http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=111534&tabla=nacion, zuletzt geprüft am 06.03.2012.
[37] Vgl. Shirk, David A. (2009): Choosing Mexico's 2006 Presidential Candidates, a.a.O, S. 136-137.
[38] Arvizu, Juan (2005): Creel pide a su equipo que respalde a Felipe. In: El Universal, 24.10.2005. Online verfügbar unter http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=131164&tabla=nacion, zuletzt geprüft am 06.03.2010.
[39] Shirk, David A. (2009): Choosing Mexico's 2006 Presidential Candidates, a.a.O. ;S. 139.
[40] Zedillo unterschrieb 1996 einen Zusatz zur Verfassung, welcher anderen Parteien eine Chance bei Wahlen einräumte. Vgl. Lawson, Chappell H. (2009): Introduction. The Mexican 2006 election in context, a.a.O. S. 3.
[41] Shirk, David A. (2009): Choosing Mexico's 2006 Presidential Candidates, a.a.O. S. 139.
[42] Ebd. S. 140
[43] Ebd. S. 140.
[44] Ebd. S: 141.
[45] Ebd. S. 142.
[46] Ebd. S. 143.
[47] Shirk, David A. (2009): Choosing Mexico's 2006 Presidential Candidates, a.a.O. S. 143.
[48] Ebd. S. 143.
[49] Ebd. S. 144.