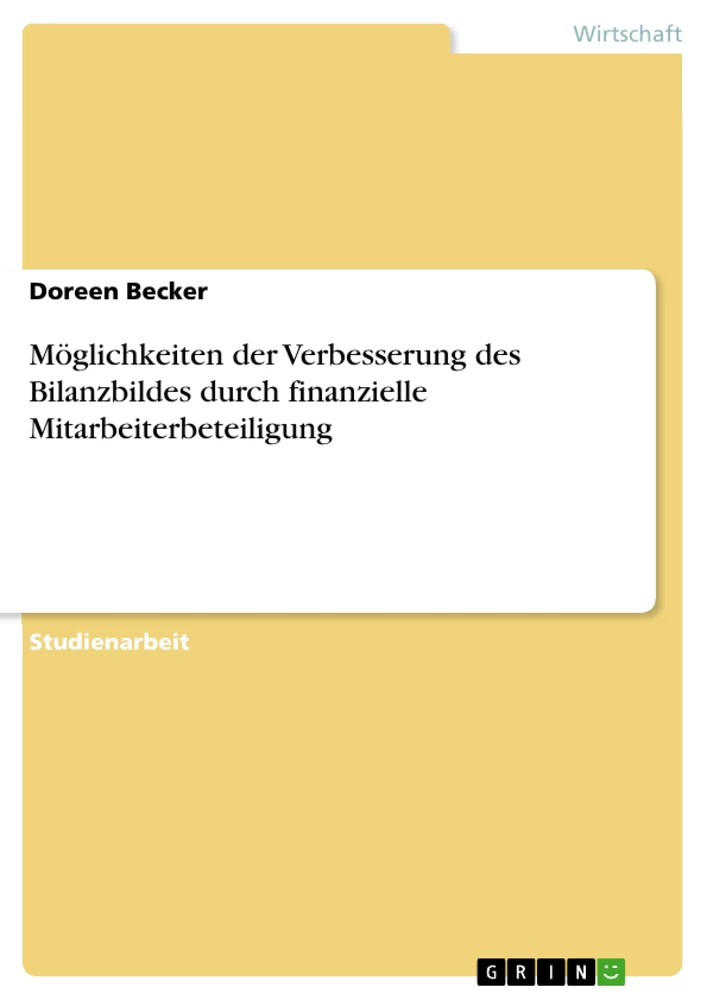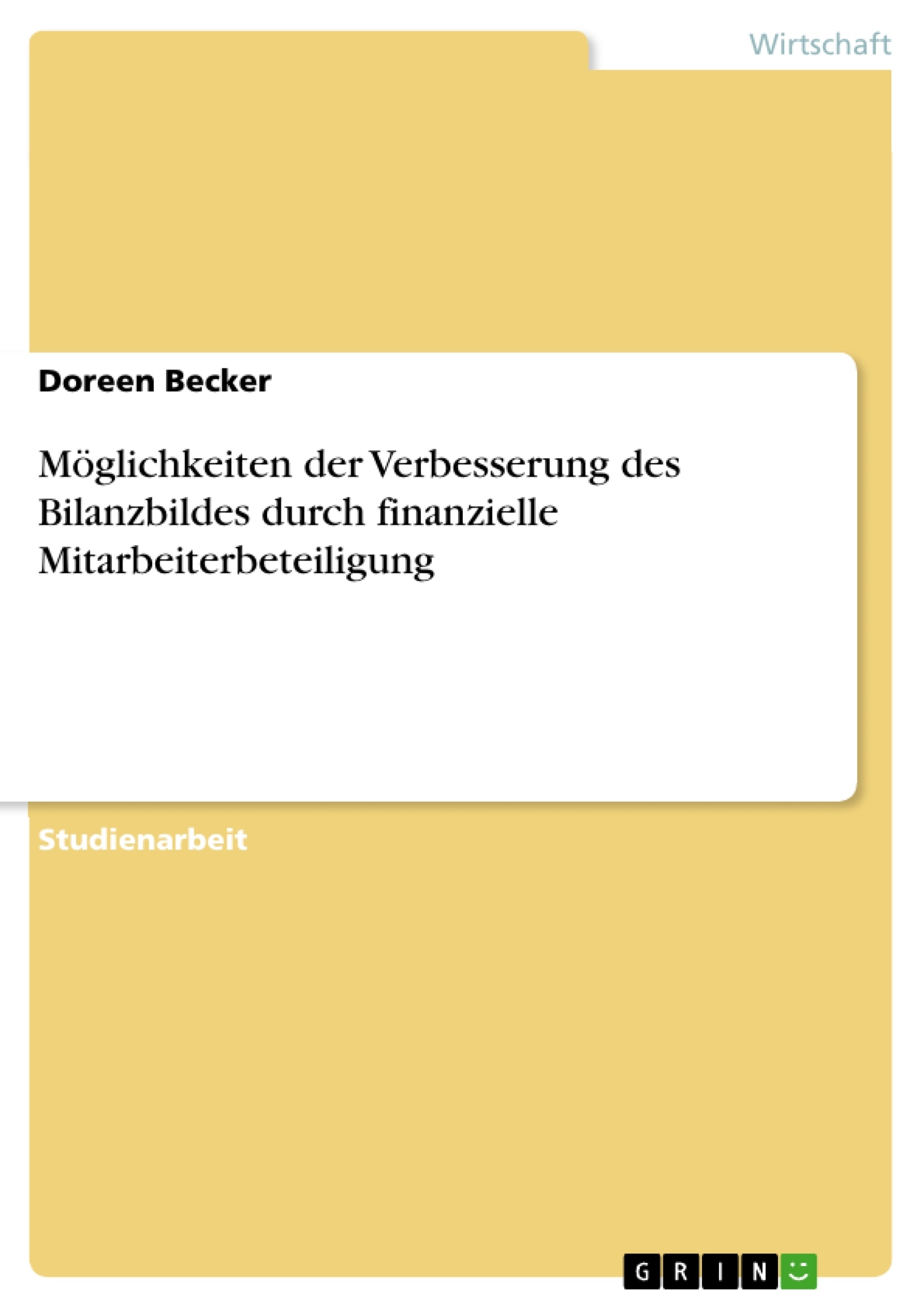Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung beschäftigen sich Unternehmen mit Themen der Bilanzpolitik, also der aktiven Gestaltung von Bilanzen zur Verbesserung des Bilanzbildes. Auch bei der Unternehmensfinanzierung kommt man an Überlegungen zu den Auswirkungen auf das Bilanzbild nicht mehr vorbei, da dies auch von den Banken im Rahmen von Basel III immer stärker eingefordert wird. Mehr und mehr Unternehmen machen sich inzwischen über alternative Finanzierungsquellen Gedanken. Relativ selten wird dabei das finanzielle Potenzial durch die eigenen Mitarbeiter im Vergleich dazu hervorgehoben. Die Diskussionen rund um die Mitarbeiterbeteiligung konzentrieren sich meist immer noch auf Aspekte der Motivation und Leistungssteigerung. Diese Arbeit soll sich deshalb den finanziellen Möglichkeiten aus dem Kreis der eigenen Mitarbeiter widmen, welche zur Verbesserung der Bilanzrelationen und damit einer aktiven bilanzpolitischen Gestaltung beitragen können. Dabei spielen die Position des Eigenkapitals und eigenkapitalähnliche Finanzierungsinstrumente eine besonders wichtige Rolle. Nach einem kurzen Überblick über die grundsätzlichen Möglichkeiten der finanziellen Mitarbeiterbeteiligung werden sowohl rechtsformgebundene als auch rechtsformunabhängige Beteiligungsformen kritisch untersucht.
Die Arbeit konzentriert sich auf die Gegebenheiten und Gestaltungsspielräume bei mittelständische Unternehmen. Nachdem diese ihren Einzelabschluss weiterhin nach HGB aufzustellen haben, wird bei den Aspekten der Bilanzierung ausschließlich die Rechnungslegung nach dem HGB betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Problemstellung
1.2. Ziele der Arbeit und Vorgehensweise
2. Begriffsbestimmungen
3. Grundsätzliche Überlegungen
3.1. Mitarbeiterbeteiligung aus Sicht des Unternehmens und der Mitarbeiter
3.2. Möglichkeiten der Bilanzbildverbesserung und ihre Motive
3.3. Bedeutung von Mezzanine-Kapital
4. Möglichkeiten der finanziellen Mitarbeiterbeteiligung
4.1. Direkte Beteiligungen
4.2. Mitarbeiter als stille Gesellschafter
4.3. Genussrechte
4.4. Mitarbeiter als Aktionär
5. Zusammenfassung und Fazit
Literatur- und Quellenverzeichnis