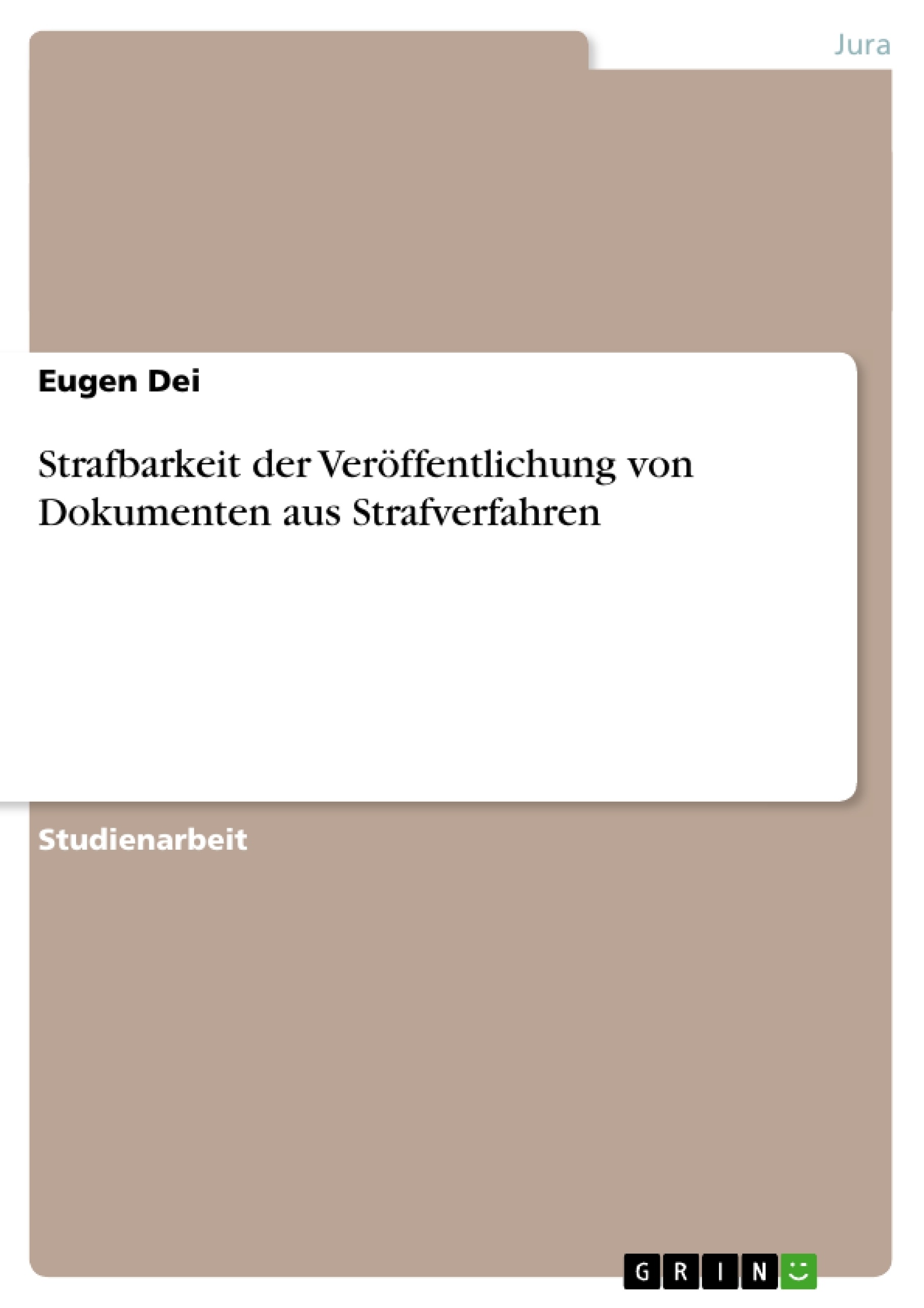Im Mai 2013 hat die Staatsanwaltschaft Hamburg vor dem Amtsgericht Hamburg einen Antrag auf die Löschung von Links und Dokumenten gestellt, die verbotene Informationen über Gerichtsverhandlungen beinhalten sollten. Die fünf Dokumente, die die Staatsanwaltschaft löschen wollte, waren: Einstellungsverfügung StA Augsburg, Beschluss der Strafvollstreckungskammer, Gutachten und Wiederaufnahmeantrag der StA Regensburg. Diese Dokumente stammten aus dem Verfahren Gustl Mollath, die im Wortlaut auf der Internetseite von Herrn RA Strate veröffentlicht worden sind. Im Juni 2013 hat das Amtsgericht Hamburg diesen Antrag zurückgewiesen.
Diese Arbeit soll der Frage nachgehen, inwieweit sich Prozessbeteiligte strafbar machen (oder auch nicht), wenn sie Informationen aus laufenden Verfahren an die Öffentlichkeit weitergeben.
Strafbarkeit der Veröffentlichung von Dokumenten aus Strafverfahren
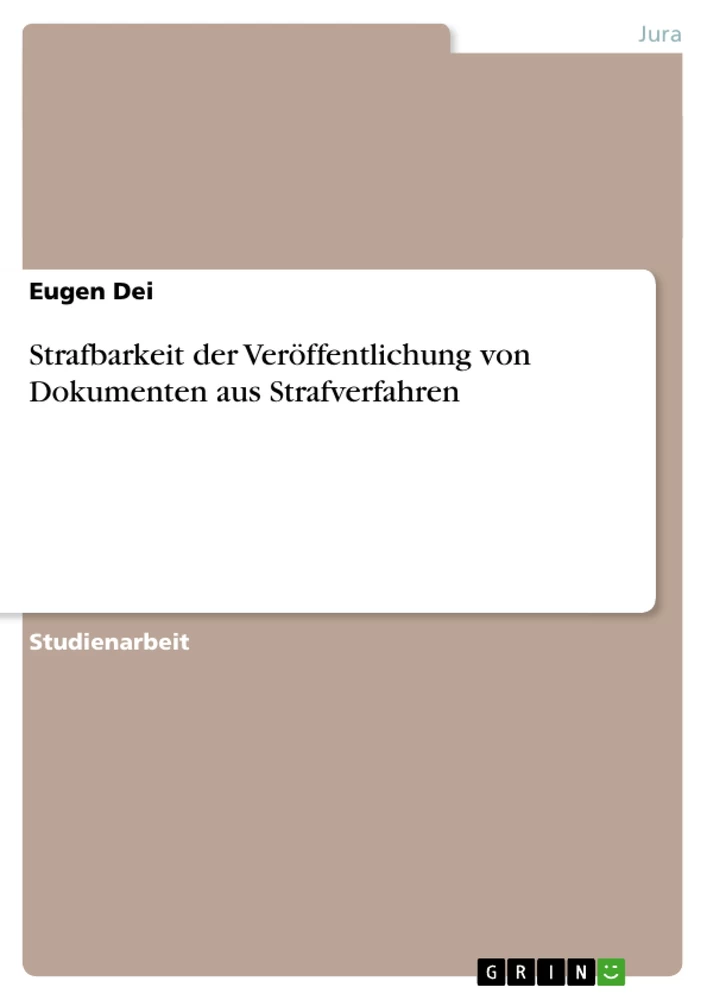
Seminararbeit , 2014 , 9 Seiten
Autor:in: Eugen Dei (Autor:in)
Leseprobe & Details Blick ins Buch