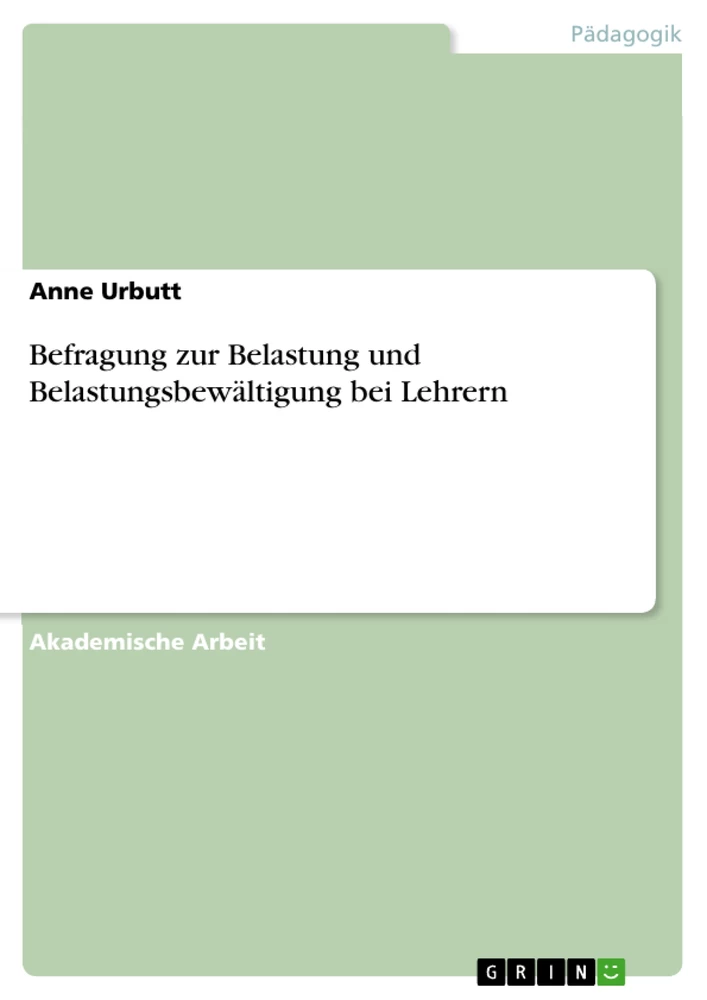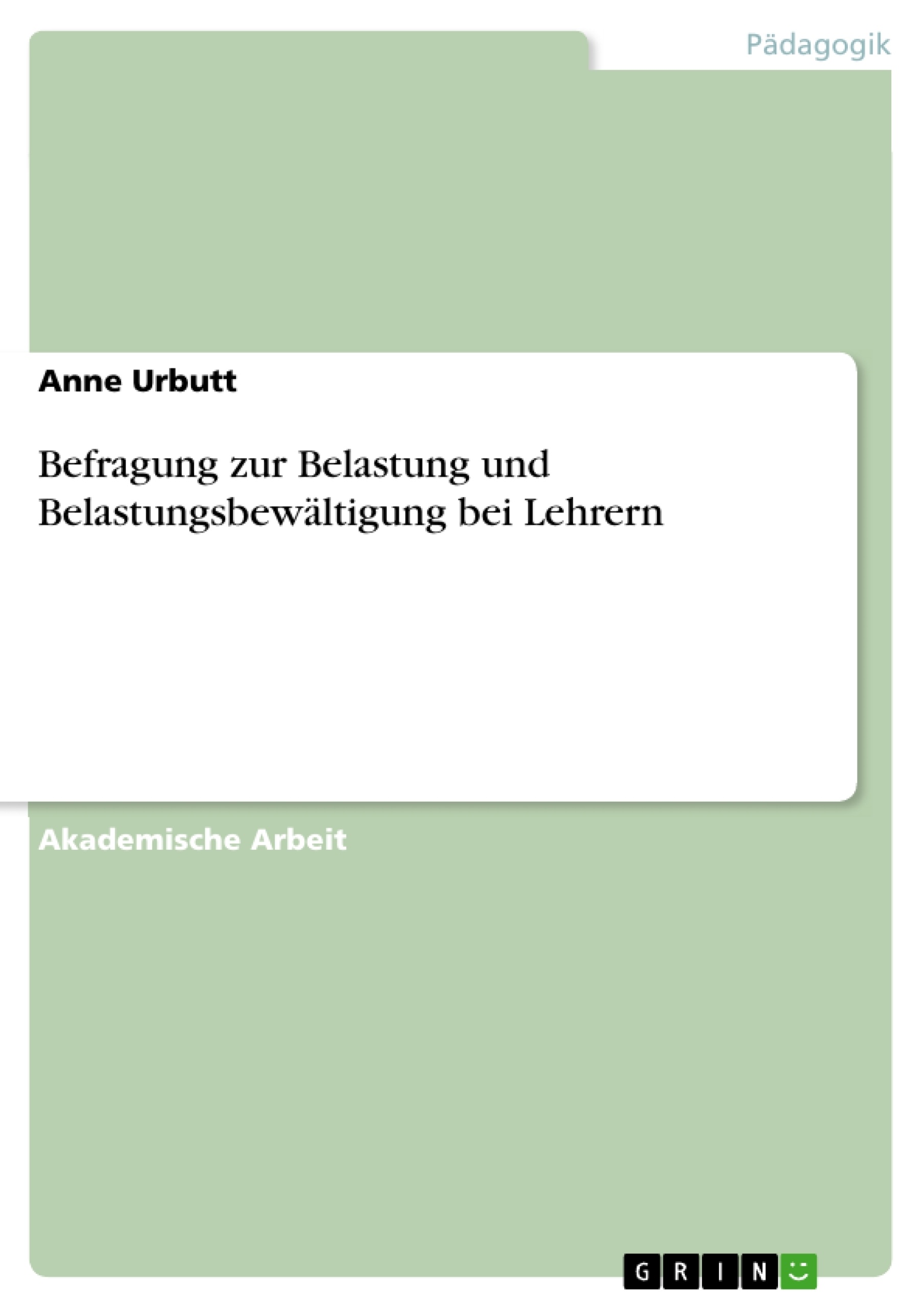Es gibt es eine Fülle von Studien zur Belastung im Lehrerberuf, die sehr schwer überschaubar ist, nicht nur wegen der Masse, sondern auch aufgrund der unterschiedlichen Forschungsansätze. Teilweise sind recht unterschiedliche Ergebnisse zu finden, auch wenn meist ähnliche Tendenzen, z.B. bei der Ermittlung der Belastungsmomente, zu erkennen sind. Aus diesen Gründen kam mir die Idee, zusätzlich zu den bestehenden Studien selbst eine Umfrage über Belastungen im Lehrerberuf und ihre Bewältigung in den Schulen meines Wohnortes durchzuführen. Da die Umfrage nicht zu lang ausfallen sollte, weil sie lediglich eine Ergänzung zu den vorhergehenden Ausführungen darstellen soll, kann hier kaum, wie im vorgestellten Rahmenmodell der Belastung und Beanspruchung beschrieben, auf die subjektive Belastung, also auf Persönlichkeitsmerkmale, die zum Belastungsempfinden führen, eingegangen werden, sondern es können hauptsächlich die objektiven Belastungsfaktoren, die sich aus der Tätigkeit ergeben, ermittelt werden, entsprechend dem reizorientierten Ansatz. Um die subjektive Belastung aber nicht ganz zu vernachlässigen, sind auch drei mögliche Belastungsfaktoren nach dem Belastungsgrad zu bewerten, die eher den subjektiven Belastungsfaktoren zuzuordnen sind: „das Gefühl mit der Arbeit nie fertig zu sein“, „Belastung durch zu hohe Ansprüche an sich selber“ und „das Gefühl mangelnder Kompetenz“. Die Belastungsverarbeitungskompetenz, die mit den darauf folgenden Fragen des Fragebogens ermittelt wird, soll außerdem mit dem Belastungsempfinden in Zusammenhang gebracht werden, da diese an der Widerspiegelung der objektiven Belastungsfaktoren beteiligt ist und somit auch Aufschluss über die subjektive Belastung geben kann.
Die Durchführung und Auswertung der Umfrage sowie die Reflexion der Ergebnisse sollen Inhalte dieses Kapitels sein.
Die einzelnen Fragestellungen des Fragebogens ergeben sich aus der vorausgegangenen Bearbeitung des Themas und orientieren sich an der von mir verwendeten Literatur.
Im folgenden sollen zuerst die Fragestellungen, die durch die Auswertung beantwortet werden und dann mit den bisher dargestellten Ergebnissen zur Belastung und Belastungsbewältigung im Lehrberuf verglichen werden sollen, vorgestellt werden. Folgend sollen einige Anmerkungen zum Fragebogen selbst und zu der Durchführung der Umfrage gemacht werden.
Aus dem Inhalt:
- Fragebogen,
- Durchführung der Befragung,
- Auswertung,
- kritische Batrschtung
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Fragestellungen zur Belastung und Belastungsbewältigung
3 Der Fragebogen
4 Die Durchführung der Befragung
5 Auswertung der Daten
5.1 Personendaten
5.2 Belastungssituation
5.3 Belastungsbewältigung
6 Kritische Betrachtung der Befragung
7 Literaturverzeichnis (inkl. weiterführender Literatur)
Anhang