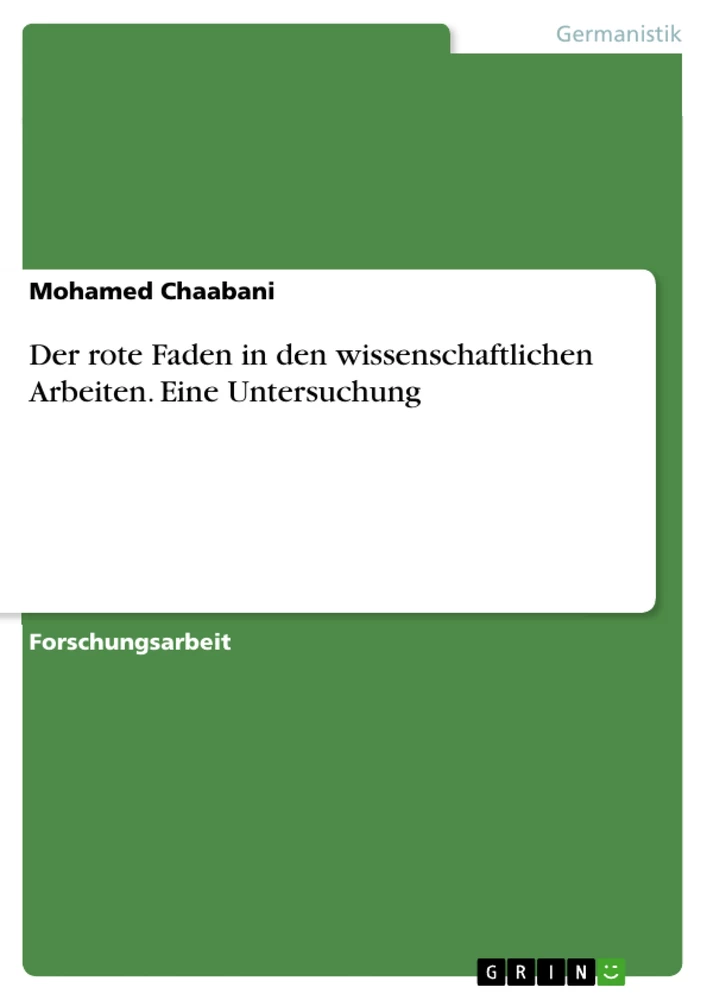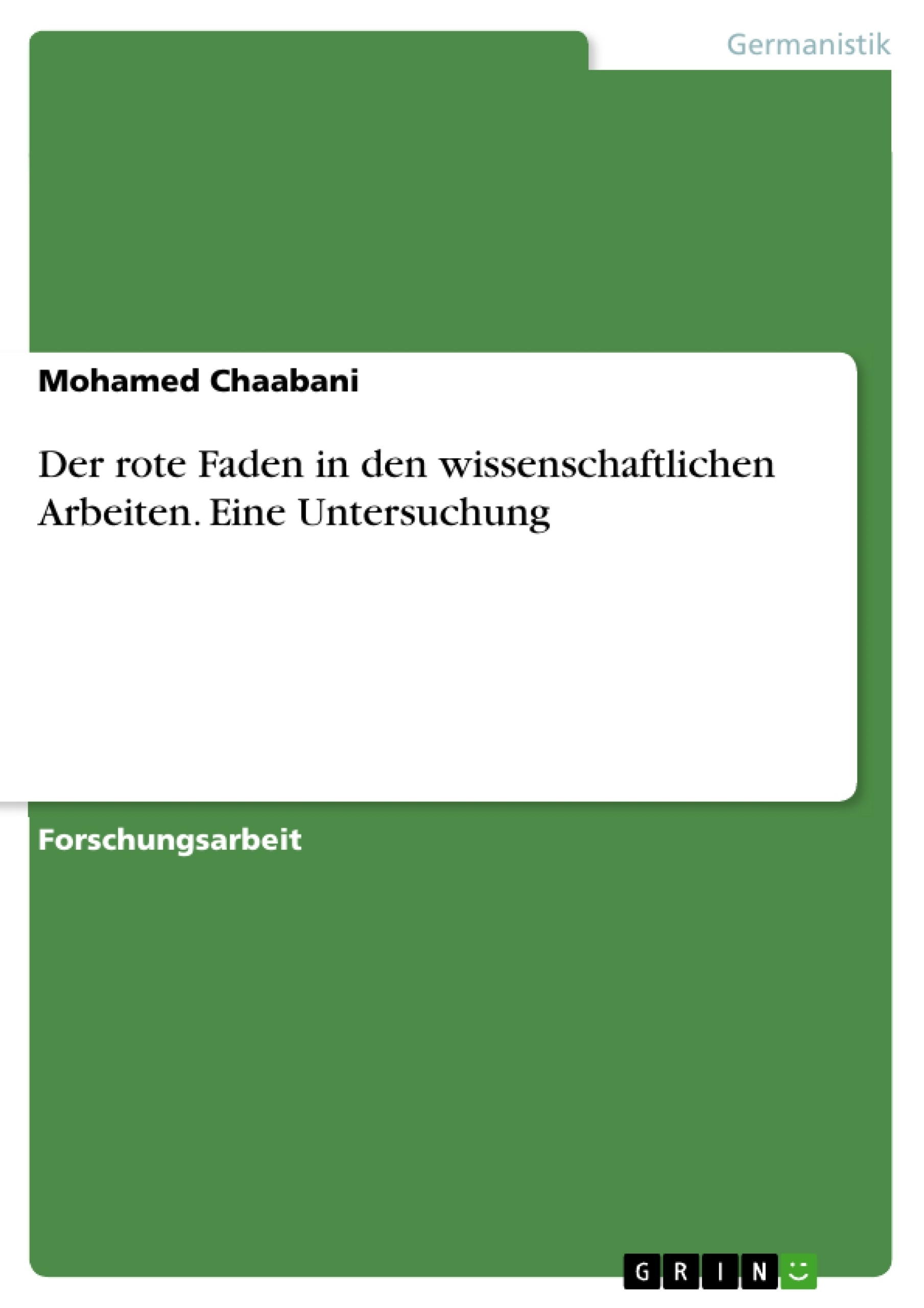Die vorliegende Forschungsarbeit thematisiert den roten Faden in den wissenschaftlichen Arbeiten. Hauptanliegen der Arbeit ist es, Schwächen und Stärken der Studierenden hinsichtlich des roten Fadens beim Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten zu untersuchen. Für diesen Zweck wurden Abschlussarbeiten, die von Germanistikstudenten verfasst wurden, einer näheren Analyse unterzogen. Die Ergebnisse sollen einen Beitrag zur Förderung vom wissenschaftlichen Schreiben bei den Studierenden leisten.
Inhalt
Der rote Faden in den wissenschaftlichen Arbeiten
Sprachliche Mittel zur Realisierung des roten Fadens
Die Gliederungen als Realisierung des roten Fadens
Techniken zur Herstellung eines roten Fadens
Analyse von Abschlussarbeiten
Methodisch-didaktische Konsequenzen
Literatur