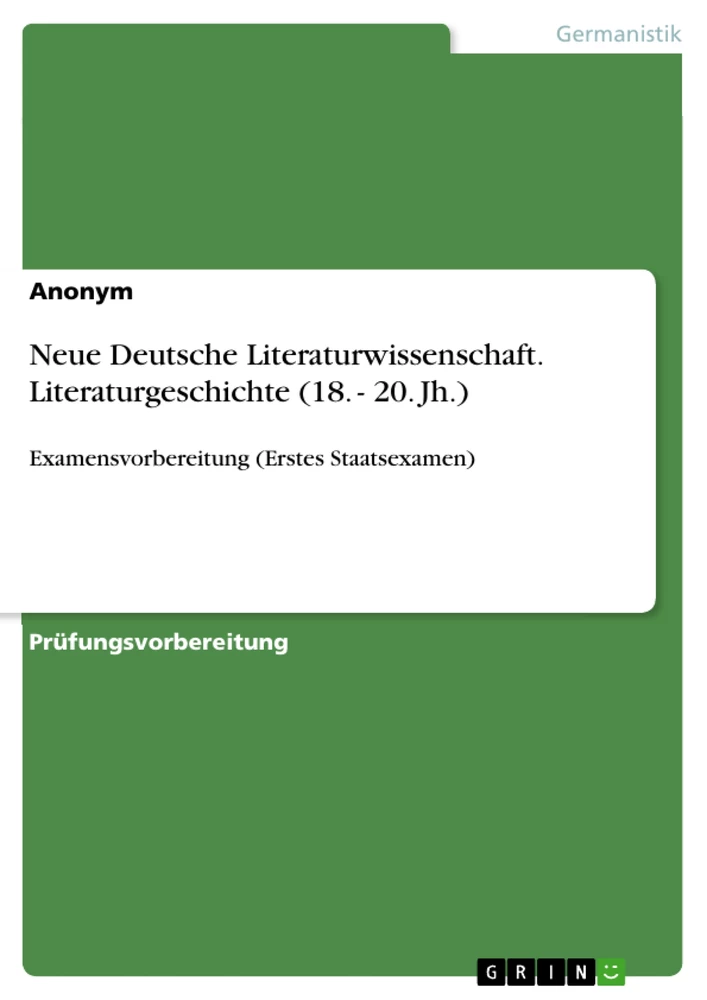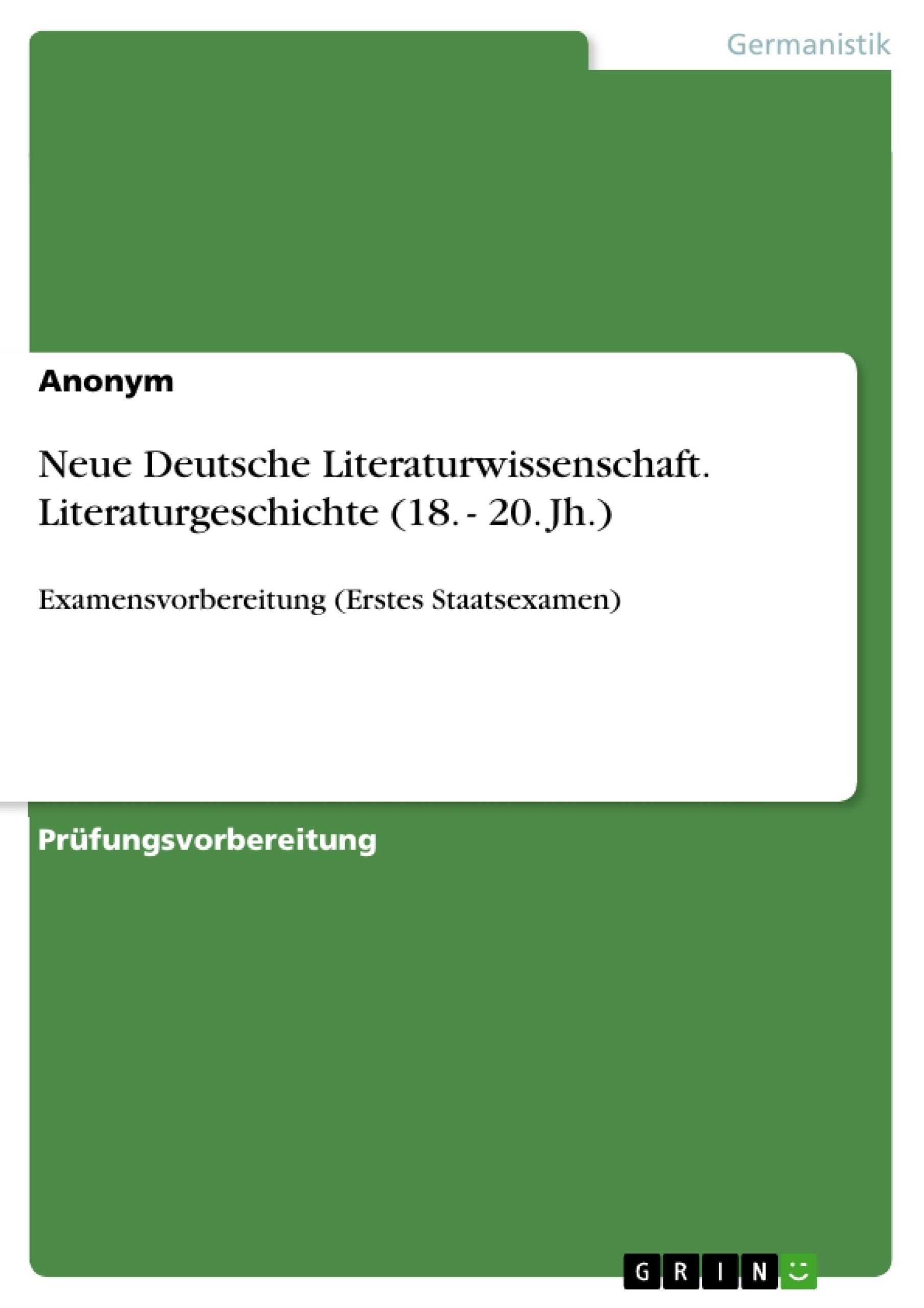Überblick über die notwendigen Inhalte für das Erste Staatsexamen (nicht vertieft) in Neue Deutsche Literaturwissenschaft:
Relevante Examensthemen 2007-2011, Aufklärung, Sturm und Drang, Kunstepoche, Romantik als Lebens- und Schreibform, Restaurationszeit, Poetischer/Bürgerlicher Realismus und Gründerzeit, Naturalisten als erste Generation der literarischen Moderne, Gegenströmungen zum Naturalismus: Krise und Aufbruchsstimmung, Literatur in der Weimarer Republik, Literatur im „Dritten Reich“, Deutsche Literatur des Exils, Deutsche Literatur nach 1945.
Inhaltsverzeichnis
0. Einleitendes
1. Relevante Examensthemen (2007-2011)
1.1. 2007
1.1.1. Frühjahr
1.1.2. Herbst
1.2. 2008
1.2.1. Frühjahr
1.3. 2009
1.3.1. Frühjahr
1.3.2. Herbst
1.4. 2010
1.4.1. Frühjahr
1.4.2. Herbst
1.5. 2011
1.5.1. Frühjahr
2. Aufklärung (1680/1720 - 1785/95)
2.1. Was ist politisch und gesellschaftlich neu?
2.2. Die Öffentlichkeit verändert sich, Der freie Schriftsteller meldet sich zu Wort
2.3. Die aufklärerischen Literaturtheorien von GOTTSCHED über LESSING bis zum Sturm und Drang
2.4. Subjektivität und Gesellschaftskritik in der Lyrik
2.5. Rationalismus und Empfindsamkeit. Zur Dialektik der Aufklärungsbewegung
3. Sturm und Drang (1765/67/70-1784/85)
3.1. Prometheus als Lichtgestalt
3.2. Wegbereiter des Sturm und Drang
3.3. Der junge GOETHE - Straßburger (1710/71)- und Frankfurter (1771-1775) Jahre
3.4. Der Kreis um den jungen GOETHE
3.5. Der Göttinger Hain/Göttinger Hainbund (1772-1774)
3.6. „In tyrannos!“ - Schubart und Schiller
4. Kunstepoche (-1832)
4.1. Zwischen Revolution und Restauration
4.2. Reaktionen auf die französische Revolution
4.3. Weimarer Klassik (1786-1805)
4.3.1. Einleitendes
4.3.2. Evolution statt Revolution oder: das Erbe der Aufklärung
4.3.3. Goethe
4.3.4. Schiller
4.4. Romantik als Lebens- und Schreibform (1790/93 - 1830/50)
4.4.1. Einleitendes
4.4.2. Gemeinsamkeiten der verschiedenen Schulen
4.4.3. Die Jenaer Schule - Die ältere Romantik
4.4.4. Die andere Seite der Romantik - Die schwarze Romantik - Die Schauerromantik
4.4.5. Heidelberger Romantik - Die jüngere Romantik - Die Hochromantik - Die Spätromantik
4.4.6. Schreibende Frauen in der Romantik
4.4.7. Schwäbische Romantik
4.5. Die Mainzer Republik und die Literaturpraxis der deutschen Jakobiner
4.6. Im Umkreis von Klassik, Romantik und Jakobinismus: Einzelgänger HÖLDERLIN - JEAN PAUL - KLEIST
4.7. Klassikverehrung und Klassikwirkung im 19. und 20. Jahrhundert
5. Restaurationszeit (1815-1848)
5.1. Allgemeines
5.2. Politische, soziale und wirtschaftliche Situation
5.3. Neue Gesellschaftslehren
5.4. Biedermeier
5.5. Das Junge Deutschland oder Die Jungdeutschen
5.6. Literatur des Vormärz
5.7. Literaturmarkt, Berufsschriftstellertum und Zensur
5.8. Wozu ist Literatur jetzt nützlich?
5.9. Das Programm der politischen Poesie
5.10. Rückblick auf eine Epoche: Neue Schreibweisen in Prosa, Lyrik und Drama
5.11. 1848 und das Zerbrechen der aufklärerischen Perspektive
6. Poetischer/Bürgerlicher Realismus und Gründerzeit (1848/50-1890)
6.1. Die widersprüchliche Situation und Versuche, sie darzustellen
6.2. Nationale und liberale Erziehung statt allgemeiner geistiger Freiheit
6.3. Hat die Reichsgründung 1871 neue Wege eröffnet?
6.4. Volksliteratur und Dorfgeschichte
6.5. „Haltungen“ als literarische Antwort auf die gesellschaftliche Entwicklung
6.6. Politisch engagierte Schriftstellerinnen und Schriftsteller zwischen 1848 und 1890
6.7. Die Lyrik in der Epoche des Realismus
7. Die Naturalisten als erste Generation der literarischen Moderne (1880-1900)
8. Gegenströmungen zum Naturalismus - „Die Unrettbarkeit des Ich“: Krise und Aufbruchsstimmung
8.1. Symbolismus
8.1.1. Einflüsse der französischen Symbolisten
8.1.2. Deutsche Vertreter des Symbolismus
8.2. Impressionismus
8.3. Expressionismus (1910-1920) - Das expressionistische Jahrzehnt
8.4. Dadaismus
9. Literatur in der Weimarer Republik
9.1. Nach der Niederlage des Ersten Weltkriegs
9.2. Literatur als Ware
9.3. Ansätze zu einer proletarisch-revolutionären Literatur
9.4. Die Neue Frau
9.5. Neue Sachlichkeit in den 1920er Jahren
9.6. Zwischen Artistik und Engagement - Die Lyrik
10. Literatur im „Dritten Reich“
10.1. Die nationalsozialistische Machtübernahme
10.2. Die „Ästhetisierung der Politik“ oder faschistische Politik als „Gesamtkunstwerk“
10.3. Die Literatur der „Inneren Emigration“
10.4. Schreiben in der Illegalität
11. Die deutsche Literatur des Exils
11.1. Der Exodus
11.2. Kampf um die „Einheitsfront“ der Exilautoren
11.3. Kontroversen um ein neues Selbst- und Literaturverständnis der Exilautoren - Expressionismus- und Realismusdebatte
11.4. Antifaschistische Literaturpraxis
12. Deutsche Literatur nach 1945
12.1. „Als der Krieg zu Ende war“
12.2. Alliierte Kulturpolitik
12.3. Politisch-kulturelle Publizistik
12.4. Aporien des lyrischen Kahlschlags