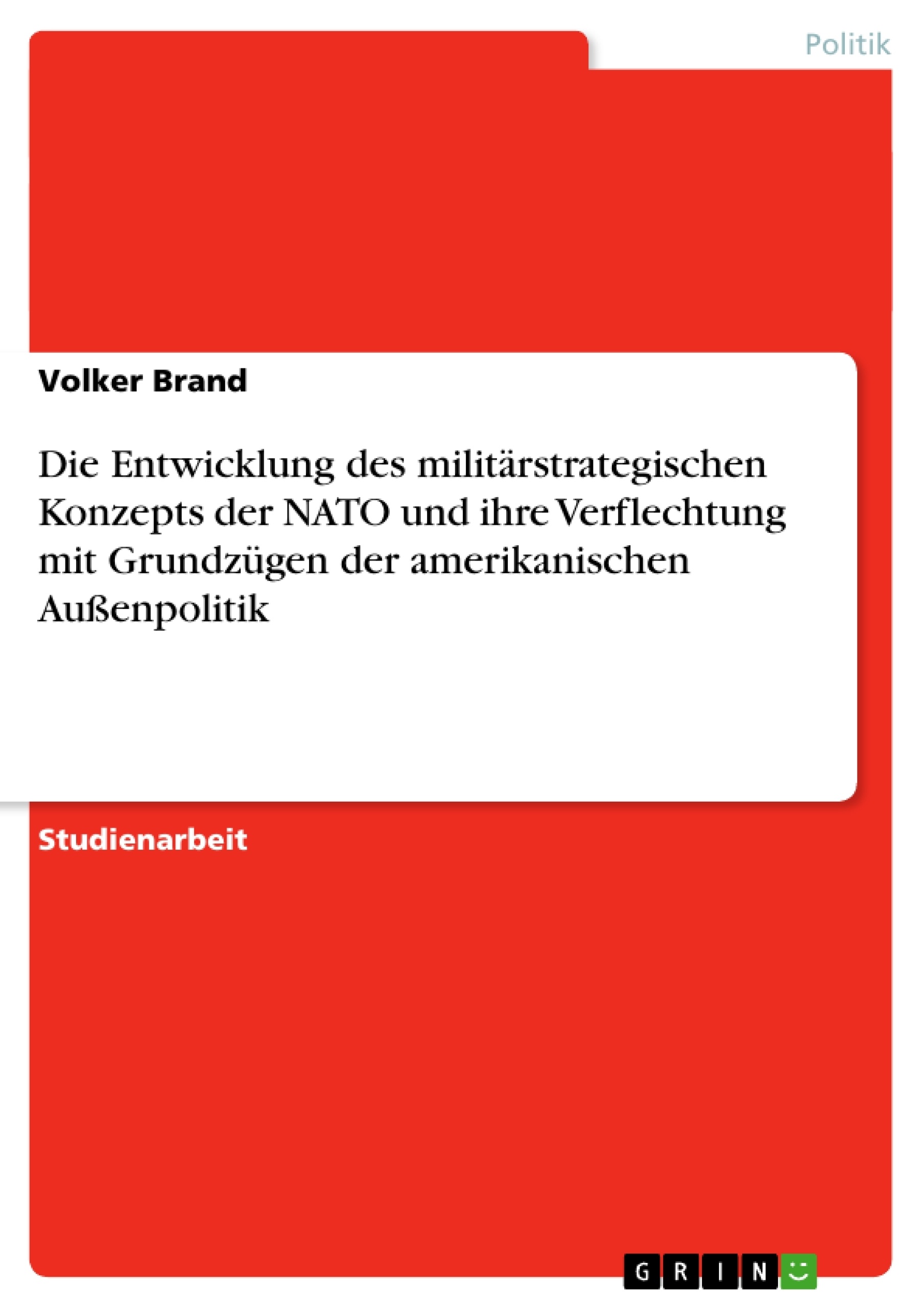Kritisch-kursive Abhandlung der militärstrategischen Doktrin der NATO bis zu den 80er Jahren.
Die strategische Konzeption der NATO stand von Beginn an auf der Grundlage der Ost-West-Polarisierung. Von daher war das strategische Denken stets geprägt von Feindbildern. Dem potentiellen Gegner im Osten wurden die schlimmsten Absichten unterstellt zumindest von den ‚Falken‘ im Bündnis und das stets im Sinne des worst-case-Denkens. Dabei spielte das Prinzip der Abschreckung seit der Gründung der NATO eine fundamentale Rolle. So sollte der Gegner durch Androhung kaum mehr kalkulierbarer Verluste von einem Angriff abgehalten werden.
Für den Fall eines Versagens der Abschreckung zielten alle militärischen Konzepte immer schon darauf ab, den Gegner so weit östlich wie möglich aufzuhalten.
[...] Zweifellos stellt die Nixon-Doktrin eine realistische Antwort auf die veränderte geopolitische Situation zu Beginn der 70er Jahre dar.
Die Entwicklung des militärstrategischen Konzepts der NATO und ihre Verflechtung mit Grundzügen der amerikanischen Außenpolitik
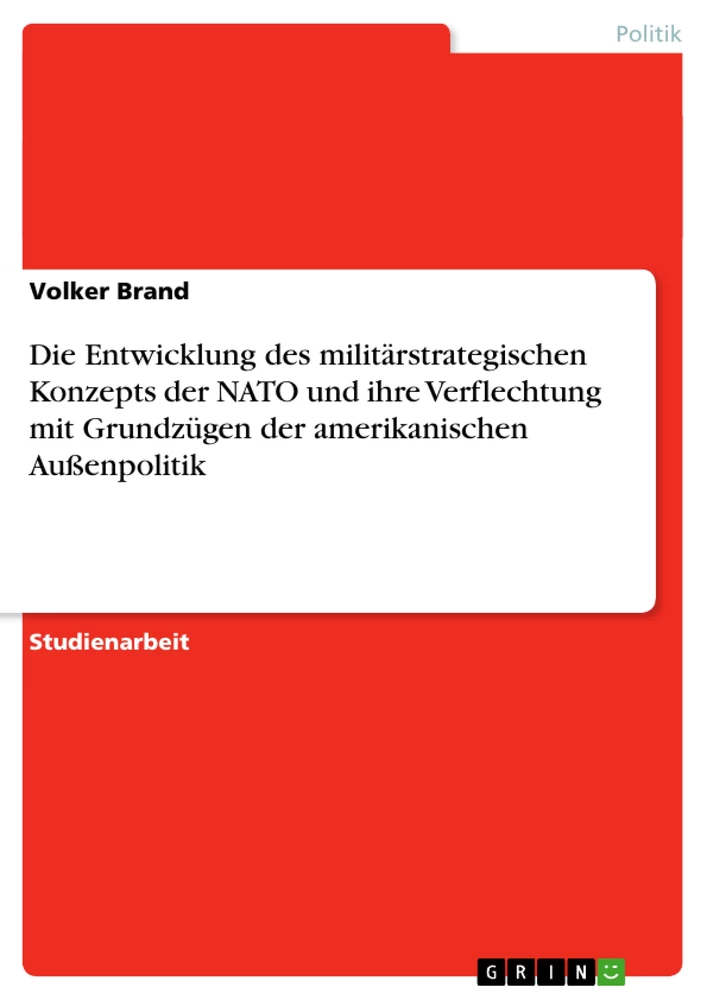
Seminararbeit , 1987 , 10 Seiten
Autor:in: Dr. Volker Brand (Autor:in)
Leseprobe & Details Blick ins Buch