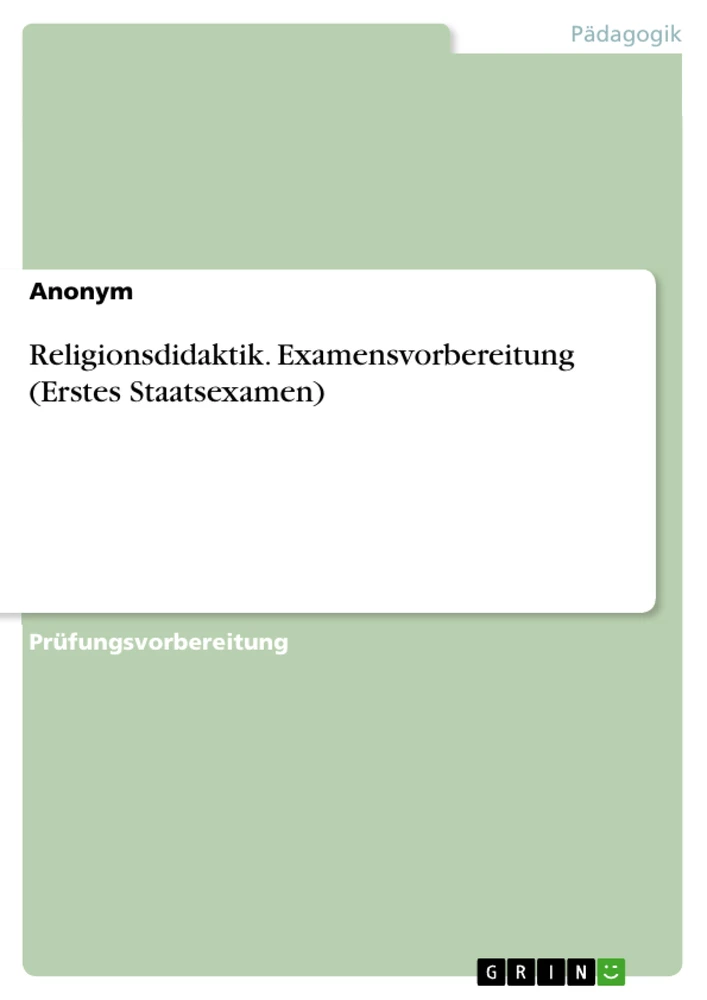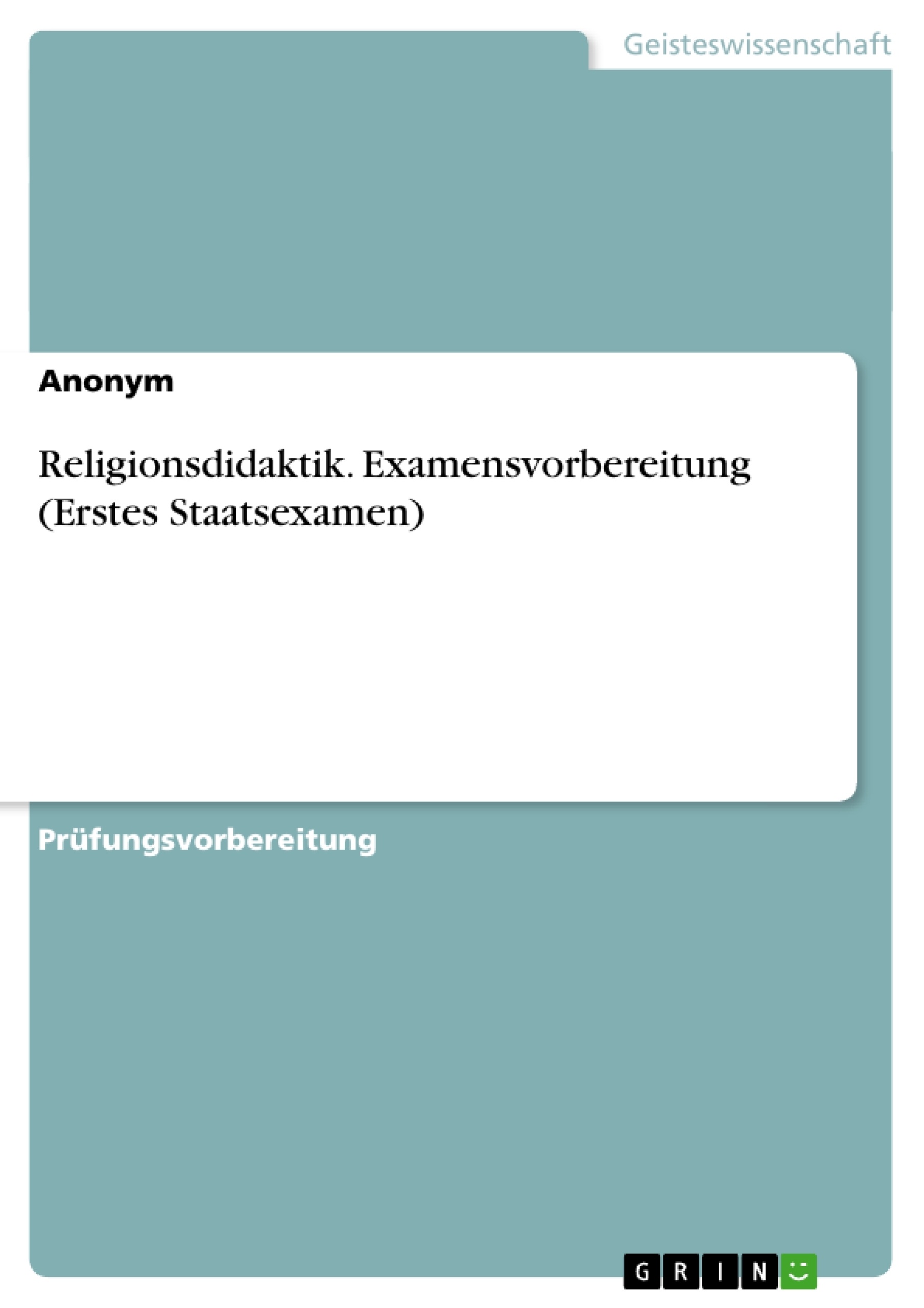Überblick über ausgewählte Inhalte der Religionsdidaktik für das Erste Staatsexamen (Lehramt)
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitendes
2. Examensaufgaben
2.1. Aufgaben
2.2. Auswertung
3. Religion als Unterrichtsfach der Realschule
3.1. Schulprofil Realschule (Lehrplanebene 1)
3.1.1. Ziel und Anspruch der sechsstufigen Realschule
3.1.2. Bildungs- und Erziehungsschwerpunkte an der sechsstufigen Realschule
3.1.3. Unterricht und Schulleben und Stundentafel Religion (ev.)
3.2. Fächerübergreifende Bildungs- und Erziehungsaufgaben (Lehrplanebene 2)
3.3. Pädagogische Leitthemen (Lehrplanebene 3)
3.4. Fächerprofil Religion (Lehrplanebene 3)
3.5. Lehrplan Religion (Lehrplanebene 3)
3.5.1. Jahrgangsstufe
3.5.2. Jahrgangsstufe
3.5.3. Jahrgangsstufe
3.5.4. Jahrgangsstufe
3.5.5. Jahrgangsstufe
3.5.6. Jahrgangsstufe
4. Was ist Religion?
4.1. Etymologisch, kulturhistorisch und Definitionen
4.2. Religionssoziologisch - Die Funktion von Religion für die Gesellschaft und den Einzelnen
4.3. Religionspsychologisch - Ein kritisches Verhältnis zur Religion
4.4. Offenbarungstheologisch
5. Rahmenbedingungen und Realisierungen des heutigen Religionsunterrichts
5.1. Begründungen des Religionsunterrichts
5.2. Ethik
5.3. Lebensgestaltung - Ethik - Religionskunde (LER): Der Sonderfall Brandenburg
5.4. Religionskunde - „Religion und Kultur“ im Kanton Zürich
5.5. Exkurs I: Islamische Unterweisung
5.6. Exkurs II: Die Grundsätze der Religionsgemeinschaften, Denkschrift und Bischofswort
5.7. Exkurs III: Herausforderungen und Desiderate
6. Religiöse Erziehung, Sozialisation und Bildung
6.1. Religiöse Bildung als Aufgabe der Schule - Religion braucht Bildung und Bildung braucht Religion
6.2. RU als Hilfe zur Identitätsbildung nach ZIEBERTZ - Die Stärkung des Ich
6.3. Religiöse Erziehung
6.4. Religiöse Sozialisation
7. Modelle des RU
8. Bibeldidaktik-Warum heute noch Bibel?
8.1. Bibel und biblisches Lernen heute: Eine Problemanzeige - Ein Akzeptanzproblem
8.2. Begründungsfiguren für biblisches Lernen
8.3. Bibeldidaktische Konzepte für unterrichtliche Schulstufen
8.4. Rezeptionsorientierte Bibeldidaktik
8.5. Bibeldidaktik im Horizont (post-)moderner literaturwissenschaftlicher Strömungen
8.5.1. (Post-)moderne literaturwissenschaftliche Ansätze
8.5.2. Ulrich Kropac: Postmoderne Bibeldidaktik
8.5.3. Lernwege
8.6. Exkurs: Die historisch-kritische Methode und ihre Arbeitsschritte (ADAM und LACHMANN)
8.7. Beispiel: Altes Testament
8.7.1. Einleitendes
8.7.2. Beispiel: Hiob an den vier Grundschritten nach ADAM/LACHMANN
8.7.3. Beispiel: Erzeltern
8.7.4. Beispiel: Neues Testament (Wunder)
9. Interkulturelles und interreligiöses Lernen
9.1. Einleitendes
9.2. Begriffsklärung
9.3. Veränderte Einstellung der Kirchen zu den Religionen
9.4. Religionen und ihre Beziehung zueinander - Religionstheologische Modelle
9.5. Interkulturelle und interreligiöse Kompetenzen
9.6. Interkulturelles und interreligiöses Lernen in Erziehungs- und Bildungsarbeit
9.7. Schritte in der Unterrichtspraxis nach LEIMGRUBER/ZIEBERTZ (2010)
9.8. Mögliche Ziele des Religionsunterrichts nach LÄHNEMANN (1997)
9.9. Eine besondere Beziehung: Judentum - Christentum
9.9.1. Grundlagen der Begegnung
9.9.2. Der jüdisch-christliche Dialog als Ort und Weg der Verständigung
9.9.3. Orientierung über Differenz und Gemeinsamkeit
9.9.4. Das Judentum als Thema des christlichen Religionsunterrichts
10. Religionsdidaktische Prinzipien
10.1. Hinführung
10.2. Ästhetisches Lernen (HILGER)
10.3. Erinnerungsgeleitetes Lernen (LEIMGRUBER)
10.3.1. Problemanzeige
10.3.2. Begriffsklärungen
10.3.3. Anthropologische Aspekte erinnernden Lernens
10.3.4. Erinnerung und Gedächtnis in den abrahamitischen Religionen
10.3.5. Anamnetische Zugänge im Religionsunterricht
10.4. Biographisches Lernen (ZIEBERTZ)
10.4.1. Problemstellung
10.4.2. Kontexte und Konturen der neuzeitlichen Biografie
10.4.3. Biografisches Lernen im Feld zweier Kraftströme
10.4.4. Biografisches Lernen als transitorisches Lernen
10.4.5. Biografisches Lernen als religionsdidaktische Aufgabe
10.5. Ethisches Lernen (ZIEBERTZ)
10.5.1. Definitionen und Begriffsannäherungen
10.5.2. Begründung ethischen Lernens im Unterricht
10.5.3. Problem und Fragestellung
10.5.4. Pluralität von Werten und Normen: Problem und Herausforderung
10.5.5. Vier Modelle ethischer Bildung nach VAN DER VEN
10.5.6. Urteilskompetenz im Horizont der christlichen Überlieferung
10.5.7. Ethische Urteilsbildung: Elemente, Kriterien und Perspektiven
10.5.8. Ethisches Lernen: Methoden und Formen
10.5.9. Gewalt/ Aggression
10.5.9.1. Lebensweltlich
10.5.9.2. Theologisch
10.5.9.3. Didaktisch
1. Einleitendes
- Dies ist eine Zusammenfassung für Religionsdidaktik (Realschule). Hierfür wurden folgende Bücher ver- wendet:
- Bald, Hans/ Kappe, Bärbel/ Potoradi, Martin: Mosaiksteine 5. Evangelisches Religionsbuch für Realschulen. München 2004.
- Bald, Hans/ Kappe, Bärbel/ Potoradi, Martin: Mosaiksteine 5. Lehrerhandbuch. 2. Auflage. Mün- chen 2006.
- Baldermann, Ingo: Einführung in die biblische Didaktik. 4. Auflage. Darmstadt 2011.
- Boschki, Rainer: Einführung in die Religionspädagogik. Darmstadt 2008.
- Gottfried, Adam/ Lachmann, Rainer: Religionspädagogisches Kompendium. Göttingen 2003.
- Hilger, Georg/ Leimgruber, Stephan u.a.: Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf. Neuausgabe. München 2010.
- Kollmann, Bernd: Neutestamentliche Wundergeschichten. 2. Durchgesehene und ergänzte Auflage. Stuttgart 2007.
- Kunstmann, Joachim: Religionspädagogik. 2. überarbeitete Auflage. Tübingen 2010.
- Lachmann, Rainer/ Adam, Gottfried/ Reents, Christine. Elementare Bibeltexte. Exegetisch - systematisch - didaktisch. 3. Auflage. Göttingen 2008.
- Lachmann, Rainer/ Adam, Gottfried/ Rothgangel, Martin: Ethische Schlüsselprobleme. Lebensweltlich - theologisch - didaktisch. Göttingen 2006.
- Rothgangel, Martin/ Schröder, Bernd: Evangelischer Religionsunterricht in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland. Empirische Daten - Kontexte - Entwicklungen. Leipzig 2009. Stegemann, Wolfgang: Jesus und seine Zeit. Stuttgart 2010.
- http://adss.library.uu.nl/publish/articles/000034/bookpart.pdf (Zugriff am 21.11.2011)
- http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=e852dbd039d10265ebf642d3f4 f0f4c4 (Zugriff am 16.11.2011)
- http://www.isb.bayern.de/isb/index.asp?MNav=0&QNav=4&TNav=0&INav=0&Fach=&LpSta=6& STyp=5 (Zugriff am 21.11.2011)
2. Examensaufgaben
2.1. Aufgaben
HERBST 2011 Thema Nr. 1
Die Frage, was „guter Religionsunterricht“ sei, kann unterschiedlich beantwortet werden.
Beschreiben Sie kurz die aktuelle Diskussion! Reflektieren Sie religionsdidaktische Kriterien für guten Religionsunterricht vor dem Hintergrund von Unterrichtsbeispielen aus der Realschule! Welche Perspektiven ergeben sich daraus.
Thema Nr. 2
Kirchraumpädagogik im Evangelischen Religionsunterricht der Realschule Erörtern Sie Anliegen und Inhalte der Kirchraumpädagogik!
Zeigen Sie an den konstitutiven Elementen eines evangelischen Kirchengebäudes auf, wie Schüler der Realschule Religion erschlossen werden kann!
Bündeln Sie Ihre Überlegungen in der Verlaufsbeschreibung für eine Unterrichtseinheit!
Thema Nr. 3
Neuere Untersuchungen zum Religionsunterricht zeigen, dass für Jugendliche Konfessionszugehörigkeit ein untergeordnetes Persönlichkeitsmerkmal ist.
Ist dies Grund genug, für einen ökumenischen Religionsunterricht in der Realschule zu plädieren?
FRÜHJAHR 2011
Thema Nr. 1
Konfessioneller Religionsunterricht - Ethikunterricht - L-E-R
Darstellung, Analyse und Problematik der neueren Diskussion unter theologischen und pädagogischen Aspekten
Thema Nr. 2
Elementarisierung als religionsdidaktische Aufgabe
Stellen Sie - z. B. anhand des Modells von K. E. Nipkow und Fr. Schweitzer - dar, was "Elementarisierung" aus religionspädagogischer Perspektive meint!
Erläutern Sie die zentralen Schritte der Elementarisierung anhand eines biblischen Beispiels!
Erörtern Sie Stärken, setzen Sie sich aber auch mit Grenzen des Elementarisierungskonzepts auseinander und berücksichtigen Sie dabei die Unterrichtspraxis!
Thema Nr. 3
Audiovisuelle Medien im Religionsunterricht der Realschule
Skizzieren Sie in Grundzügen wichtige didaktische Prinzipien bei der Verwendung von AV-Medien im Religionsunterricht!
Erläutern Sie an einem ausgewählten Thema des Realschullehrplans Evangelische Religionslehre, wie hier bestimmte Medien didaktisch reflektiert zur Förderung von Lernprozessen eingesetzt werden können!
Wie sinnvoll und hilfreich ist der Einsatz von AV-Medien im Religionsunterricht? Stellen Sie diese Frage in den Kontext der aktuellen Diskussion um religionsdidaktische Konzepte!
HERBST 2010
Thema Nr. 1
Erläutern Sie, wie und mit welchen Inhalten der Religionsunterricht zu den allgemeinen Bildungsaufgaben der Realschule beiträgt!
Thema Nr. 2
Werteerziehung im Religionsunterricht der Realschule
Stellen Sie Prinzipien einer Werteerziehung/-bildung dar und untersuchen Sie, in welchen The- menfeldern des Religionsunterrichts an der Realschule Wertebildung besonders eingebracht werden kann!
Thema Nr. 3
Empirische Forschung und Religionspädagogik
Stellen Sie allgemein dar, von welchen Fragestellungen die empirische Forschung in der Religionspädagogik ausgeht und erläutern Sie anhand eines Beispiels, mit welchen Mitteln gearbeitet wird und zu welchen Ergebnissen man kommt! Diskutieren Sie anschließend die Bedeutung der empirischen Forschung für die Didaktik des Religionsunterrichts an der Realschule!
FRÜHJAHR 2010
Thema Nr. 1
Ethik-Unterricht für alle Schüler - eine sinnvolle Alternative zum konfessionellen Religionsunterricht? Welche Modelle eines solchen Unterrichts werden aktuell diskutiert? Nehmen Sie dazu unter theologischen und pädagogischen Gesichtspunkten Stellung!
Thema Nr. 2
Ethische Themen im evangelischen Religionsunterricht in der Realschule. Entfalten Sie das Bedingungsfeld sowie daraus abzuleitende Prinzipien der Unterrichtsgestaltung anhand eines frei gewählten Beispiels aus dem Lehrplan.
Thema Nr. 3
Erzählen im Religionsunterricht
Skizzieren Sie Grundzüge einer Erzähltheorie für den Religionsunterricht!
Erläutern Sie, wie Sie bei der Behandlung des Themas „Paulus - Gottes Geist verändert Menschen“ (Jahrgangsstufe 7) eine Erzählung einbauen können. Entfalten Sie dazu ein zu diesem Thema passendes Erzählgerüst.
Nehmen Sie Stellung zu Ansätzen einer „narrativen Theologie“!
HERBST 2009
Thema Nr. 1
"Der performative Religionsunterricht - alter Wein in neuen Schläuchen?" Stellen Sie diese neuere Konzeption dar und gehen Sie dabei auf die Frage nach dem bleibenden Ertrag und den Grenzen dieser Form von Religionsunterricht ein!
Thema Nr. 2
Das Evangelische Gesangbuch im Religionsunterricht der Realschule. Entfalten Sie an mehreren Beispielen, wie das Evangelische Gesangbuch seinen didaktischen Ort im Religionsunterricht ver- schiedener Jahrgangsstufen finden kann! Reflektieren Sie kritisch Möglichkeiten und Grenzen!
Thema Nr. 3
Im Lehrplan der 9. Jahrgangsstufe der Realschule findet sich der Themenbereich "Judentum: Achtung vor dem Verwandten und doch Anderen". Zeigen Sie Schwierigkeiten und Möglichkeiten der Behandlung des Judentums im Religionsunterricht der Realschule auf! Gehen Sie dabei auch auf die Aspekte "verwandt" und "anders" ein!
FRÜHJAHR 2009
Thema Nr. 1
Der RU in der Verantwortung von Kirche und Schule. Erläutern Sie, in welchem Bedingungsfeld sich der RU in Deutschland gemäß den Bestimmungen von Art. 7 Abs. 2 und 3 GG bewegt und welche Herausforderungen in der neu erfahrenen religiösen und weltanschaulichen Pluralität damit gegeben sind!
Thema Nr. 2
Die Lebenswelt der Schüler als didaktische Größe im RU der Realschule: theologische, pädagogische und didaktische Überlegungen.
Thema Nr. 3
Wie lassen sich Glaubenserfahrungen der Bibel sinnvoll in den heutigen RU einbauen?
HERBST 2008
Thema Nr. 1
Die Symboldidaktik im Kontext jugendlicher Religiosität.
Stellen Sie dieses religionsdidaktische Konzept dar und zeigen Sie auf, wie die Symboldidaktik in besonderer Weise auf die Religiosität heutiger Schülerinnen und Schüler eingehen kann.
Thema Nr. 2
Wundergeschichten im Religionsunterricht der Realschule - theologische und fachdidaktische Re- flexionen
Thema Nr. 3
Neuere Medien als Herausforderung und Chance des Evangelischen Religionsunterricht an der Realschule
FRÜHJAHR 2008 Thema Nr. 1
Konfessioneller RU in Zeiten religiöser Pluralität? Theologische, pädagogische und didaktische Überlegungen zu einem brisanten Problem.
Thema Nr. 2
Didaktische Perspektiven einer Beschäftigung mit Martin Luther im RU der Realschule.
Thema Nr. 3
Das Thema Islam im RU der Realschule. Erläutern Sie die wichtigsten soziokulturellen Bedingungen für dieses Thema und fertigen Sie eine fachdidaktische Analyse an!
HERBST 2007
Thema Nr. 1
Werteerziehung ist eine Forderung, die an die Schule insgesamt gestellt wird. Welchen spezifischen Beitrag soll und kann der RU dabei leisten?
Thema Nr. 2
Wählen Sie eine der nichtchristlichen "Weltreligionen" und erörtern Sie aus fachwissenschaftli-
cher, fachdidaktischer und methodischer Perspektive Möglichkeiten und Grenzen, diese im evang. RU der Realschule zu erschließen!
Thema Nr. 3
Grenzen und Möglichkeiten eines fächerübergreifenden RUs an der Realschule.
FRÜHJAHR 2007
Thema Nr. 1
"Die Begegnung mit dem biblisch-christlichen Glauben schenkt Heranwachsenden Impulse zur
Entfaltung ihrer Persönlichkeit, indem sie Hoffnungshorizonte eröffnet und christliche Wertmaßstäbe vermittelt." (Fachprofil für Evang. Religionslehre an der Realschule). Reflektieren Sie diese Aussage unter religionspädagogischen Aspekten und zeigen Sie didaktisch verantwortete Perspektiven für die konkrete Gestaltung des RU an der Realschule!
Thema Nr. 2
Kirchengeschichtliche Themen im Evang. RU der Realschule. Konzeptionen der Kirchenge-
schichtsdidaktik und Möglichkeiten der unterrichtlichen Vermittlung von Kirchengeschichte.
Thema Nr. 3
Zeigen Sie aus fachwissenschaftlicher, fachdidaktischer und methodischer Sicht auf, wie man das Thema "Tod und Leben" in der Realschule behandeln kann!
HERBST 2006
Thema Nr. 1
Für die EKD-Denkschrift "Identität und Verständigung" (1994) ist "die angemessene Gestalt des konfessionellen Religionsunterrichts für die Zukunft die Form eines 'konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts'". Stellen sie diese Form des Religionsunterrichts in ihren Grundzügen dar und äußern Sie in Auseinandersetzung mit anderen Konzeptionen und Typen schulischen Religionsunterrichts Ihre eigne Meinung zu dem EKD-Votum!
Thema Nr. 2
Sexualerziehung im Religionsunterricht der Realschule. Diskutieren Sie das Für und Wider einer Sexualerziehung im Religionsunterricht der Realschule! Nennen Sie dafür theologische Pro- und Contraargumente und führen Sie einige exemplarisch ausgewählte Themenfelder auf!
Thema Nr. 3
Gewalt ist eine alltägliche Erfahrung vieler Schülerinnen und Schüler. Welchen spezifischen Bei- trag kann der Religionsunterricht an der Realschule im Rahmen der unterrichtlichen Behandlung dieses Themas wie unter Umständen auch bei der konkreten Bewältigung des Problems leisten?
FRÜHJAHR 2006
Thema Nr. 1
Die Leitlinien für den evang. RU in Bayern (2004). Stellen Sie die wesentlichen Aspekte dar und zeigen Sie auf, inwiefern und inwieweit sich darin die konzeptionelle Debatte des 20. Jahrhunderts in der Religionspädagogik widerspiegelt!
Thema Nr. 2
Fernöstliche Religionen im Religionsunterricht der Realschule. Schwierigkeiten und Möglichkeiten ihrer Behandlung
Thema Nr. 3
Projektunterricht und Evang. Religionslehre. Zeigen Sie auf, welche neuen Möglichkeiten der Projektunterricht bietet, konkretisieren Sie dies an einem Beispiel aus dem Lehrplan für den Evang. RU und diskutieren Sie auch die Grenzen eines solchen Modells!
HERBST 2005
Thema Nr. 1
"Aus gutem Grund" (Michael Wermke) ist der RU Bestandteil des schulischen Fächerkanons! Dis- kutieren Sie diese Behauptung aus bildungstheoretisch-anthropologischer, kirchlich- theologischer und gesellschaftspolitischer Perspektive! Berücksichtigen Sie dabei auch die Dis- kussion um die Konfessionalität bzw. Überkonfessionalität religiöser Erziehung am Lernort Schu- le!
Thema Nr. 2
Zeigen Sie, welche theologischen und didaktischen Schwerpunkte die Konzeption des hermeneu- tischen und des thematisch-problemorientierten RUs bei der Behandlung des Themas Schöpfung setzte, und zeigen Sie, worauf wir thematisch unter heutigen Bedingungen religionsdidaktisch be- sonders achten!
Thema Nr. 3
Die so genannten neuen Medien und der RU. Zeigen Sie auf, welche Chancen und Probleme der Einsatz der neuen Medien im und für den RU an der Realschule mit sich bringt!
FRÜHJAHR 2005
Thema Nr. 1
Hat konfessioneller RU noch einen Sinn? Erörtern Sie diese Frage vor dem Hintergrund der in
verschiedenen deutschen Bundesländern diskutierten und praktizierten Modelle und nehmen Sie begründet Stellung!
Thema Nr. 2
Religiöse Bildung als Aufgabe der Realschule. Diskutieren Sie diese Problematik in theologischer, pädagogischer und religionsdidaktischer Hinsicht!
Thema Nr. 3
Grenzen und Möglichkeiten einer Bibeldidaktik im RU der Realschule
HERBST 2004
Thema Nr. 1
Die rechtliche und sachliche Begründung des Religionsunterrichts
Darstellung und kritische Würdigung vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion
Thema Nr. 2
Stellen sie das didaktische Konzept der Kirchen(raum)pädagogik dar und konkretisieren Sie es am Thema "Evangelische und katholische Kirche"!
Thema Nr. 3
Das Evangelische Gesangbuch (EG) im Religionsunterricht
Entfalten Sie verschiedene unterrichtliche Einsatzmöglichkeiten und reflektieren Sie dabei didaktisch, inwiefern das EG "ein Buch für Gottesdienst und Gebet, für Glaube und Leben“ (Einführung zum EG, S. 5) werden kann!
FRÜHJAHR 2004
Thema Nr. 1
Das Anliegen der Evangelischen Unterweisung - damals und heute
Thema Nr. 2
7
Die bayerische Religionslehrkraft braucht zur Erteilung des Religionsunterrichts die kirchliche Bevollmächtigung.
Welche rechtlichen, kirchlichen und didaktischen Voraussetzungen und Anforderungen verbinden sich mit dieser Maßgabe?
Thema Nr. 3
Die Arbeit mit Symbolen im Religionsunterricht an der Realschule.
Erörtern Sie diese Problematik unter theologischen, pädagogischen und religionsdidaktischen Gesichtspunkten!
HERBST 2003 Thema Nr. 1
Betrachten Sie ausgewählte religionspädagogische Konzeptionen aus Geschichte und Gegenwart unter interkonfessionellem und interreligiösem Aspekt und äußern Sie sich zu der Frage, welcher Stellenwert diesem Aspekt nach Ihrer Meinung im Religionsunterricht zukommen sollte!
Thema Nr. 2
Die Frage nach Gott im Religionsunterricht der Realschule (religionspädagogische, theologische, fachdidaktische und methodische Gesichtspunkte)
Thema Nr. 3
"Am Anfang war das Wort" (Sebastian Schubeck). Diskutieren Sie Möglichkeiten und Grenzen des Computereinsatzes (CD-ROM/Internet) im Religionsunterricht und entwerfen Sie einen Stundenverlauf zu einem selbst gewählten Lehrplanthema bei dem sich die Arbeit mit den neuen Medien in besonderer Weise empfiehlt
FRÜHJAHR 2003
Thema Nr. 1
Der therapeutische Religionsunterricht - längst überholt oder bleibend aktuell?
Erörtern Sie die Frage, indem Sie die Konzeption differenziert darstellen und zu einer begründeten Antwort kommen!
Thema Nr. 2
Das Kirchenjahr in der Schule
Zeigen Sie - fachdidaktisch reflektiert - welche Chancen und Grenzen sich bei dieser Thematik für den Religionsunterricht ergeben!
Thema Nr. 3
"Judentum" als Thema des evangelischen Religionsunterrichts an der Realschule (theologische, didaktische und methodische Gesichtspunkte).
HERBST 2002
Thema Nr. 1
„Die PDS Hessen fordert..., den Religionsunterricht Hessen zu ersetzen durch ein ethisch-
religionskundliches, musisches, philosophisches Fach, das sich wertneutral mit den verschiedenen Arten des Glaubens auseinandersetzt. Dies öffnet gerade für Schülerinnen und Schüler den Blick über den eigenen Tellerrand und verhindert die Ausgrenzung der „Nichtchristen““. Erläutern Sie, welche (berechtigten und/oder unberechtigten) Interessen hinter dieser Forderung stehen und umreißen Sie, was Ihrer Ansicht nach die angemessene Form des Religionsunterrichts in der Schule sein und was er leisten sollte!
(Fundort für das Zitat: http://www.pds-hessen.de/Pressedienst/pressedienst.html - vom
27.6.2001)
Thema Nr. 2
Der Lehrplan weist für die 6. Jahrgangsstufe das Leitthema „Schulgemeinschaft mitgestalten“ auf. Zeigen Sie unter fachdidaktischen Gesichtspunkten, welchen Beitrag der Religionsunterricht hier- zu leisten kann!
Thema Nr. 3
Weil Menschen religiös nicht „fertig“ zur Welt kommen, bedürfen sie religiöser Erziehung, Sozialisation und Bildung.
Erläutern Sie diesen Satz und klären Sie die drei angeführten Begriffe!
Zeigen Sie sodann mit welchen veränderten Bedingungen religiöse Erziehung, Sozialisation und Bildung heute rechnen müssen!
FRÜHJAHR 2002
Thema Nr. 1
Stellen Sie die wichtigsten Spielarten des problemorientierten Religionsunterrichts dar und nehmen Sie kritisch dazu Stellung!
Thema Nr. 2
Leistung im Religionsunterricht:
Diskutieren Sie die allgemeinen pädagogischen Argumente zur Leistungsmessung im Unterricht; konfrontieren Sie sie mit möglichen theologischen Einwänden und nennen Sie Möglichkeiten der Leistungsmessung im Religionsunterricht der Realschule!
Thema Nr. 3
„Identität“ und „Verständigung“:
Diskutieren Sie diese Grundbegriffe der religionspädagogischen Grundsatzdiskussion der vergan- genen Jahre im Zusammenhang des Themas Fremdreligionen im Religionsunterricht der Real- schule!
HERBST 2001 Thema Nr. 1
Stellen Sie wichtige religionspädagogische Konzeptionen und Trends der letzten dreißig Jahre dar und erörtern Sie ihre Bedeutung für den Religionsunterricht an der Realschule!
Thema Nr. 2
Religionslehrer sein im Spannungsfeld zwischen Beruf und Berufung, Professionalisierung und Mitmenschlichkeit
Erstellen Sie ein Berufsprofil für den Religionslehrer der Gegenwart unter Berücksichtigung des Selbstverständnisses und der Rolle des Religionslehrers in den religionspädagogischen Konzeptionen des 20. Jahrhunderts
Thema Nr. 3
Die Bibel muss im Mittelpunkt des Religionsunterrichts stehen!
Nehmen Sie zu dieser Forderung unter konzeptionellem und religionsdidaktischem Aspekt Stellung und beziehen Sie dazu den Befund und die Meinung des derzeit gültigen Lehrplans für die Realschule mit ein!
FRÜHJAHR 2001 Thema Nr. 1
Äußern sie sich in konzeptioneller und didaktischer Erörterung zu der Notwenigkeit und den
Schwierigkeiten und Möglichkeiten eines schulischen Religionsunterrichts in interreligiöser Per- spektive!
Thema Nr. 2
Religionsunterricht "in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaft(en)" oder in staatlicher Alleinverantwortung?
Beschreiben Sie beide Modelle von Religionsunterricht und erörtern Sie deren Stärken und Schwächen!
Thema Nr. 3
Ethische Fragen begegnen Schülerinnen und Schülern in verschiedenen Fächern der Realschule. Zeigen Sie, möglichst unter Bezugnahme auf einige konkrete Problemfelder auf, welche besonde- ren Qualifikationen der Religionsunterricht für den Umgang mit ethischen Fragen vermitteln kann!
HERBST 2000 Thema Nr. 1
Inwiefern kann schulischer Religionsunterricht zur Beheimatung der Schülerinnen und Schüler in der kirchlichen Gemeinde beitragen?
Erörtern Sie die Frage unter konzeptionellem, schulpädagogischem und didaktischem Aspekt, und nehmen Sie selbst begründet Stellung!
Thema Nr. 2
Unterrichtsvorbereitung für biblische Themen im Religionsunterricht der Realschule
Stellen Sie die Arbeitsschritte dar, die hierfür zu vollziehen sind, und verdeutlichen Sie dies an einem Beispiel aus einem der Jahrgänge der Realschule!
Thema Nr. 3
Kirchengeschichte - ein schwieriger Unterrichtsgegenstand?
Stellen Sie unter Bezugnahme auf konkrete Inhalte Schwierigkeiten und Möglichkeiten der Behandlung kirchengeschichtlicher Themen im Religionsunterricht der Realschule dar!
FRÜHJAHR 2000
Thema Nr. 1
Welche Zukunft hat der (konfessionelle) Religionsunterricht?
Beschreiben Sie die wichtigsten Modelle von "Religionsunterricht", die gegenwärtig diskutiert werden und erörtern Sie sie unter rechtlichen, theologischen und religionspädagogischen Ge- sichtspunkten!
Thema Nr. 2
Stellen Sie verschiedene Wege und Methoden der Bibelerschließung dar und bedenken Sie diese hinsichtlich ihrer religionsunterrichtlichen Relevanz!
Thema Nr. 3
Der Schüleratheismus als didaktisches Problem
Erläutern Sie religionssoziologische und entwicklungspsychologische Gründe für den Schü- leratheismus und nennen Sie didaktisch-methodische Konsequenzen für eine unterrichtliche Auseinandersetzung!
2.2. Auswertung
BEGRÜNDUNGEN DES RU INKL. DISKUSSIONEN ZUR LER, ETHIKUNTERRICHT & KONFESSIONELLEM RU (12)
Herbst 2011
Frühjahr 2011
Frühjahr 2010
Frühjahr 2009
Frühjahr 2008
Herbst 2006
Herbst 2005
Frühjahr 2005
Herbst 2004
Herbst 2002
Herbst 2001
Frühjahr 2000
RELIGIONSDIDAKTISCHE PRINZIPIEN (8) Frühjahr 2011 (Elementarisierung) Frühjahr 2010 (Erzählen)
Herbst 2009 (Performativer RU)
Herbst 2008 (Symboldidaktik)
Herbst 2005 (Problemorientierter RU)
Frühjahr 2004 (Symboldidaktik)
Frühjahr 2003 (Therapeutischer RU)
Frühjahr 2002 (Problemorientierter RU)
ÜBERGREIFENDE THEMEN (7/8)
Herbst 2011 (Was ist guter RU?)
Herbst 2010 (Empirische Forschung)
Herbst 2007 (Fächerübergreifender RU)
(Frühjahr 2007 (Biblisch-christlicher Glauben)) Frühjahr 2006 (Projektunterricht)
Frühjahr 2003 (Das Kirchenjahr) Frühjahr 2002 (Leistung im RU) Herbst 2000 (Kirchengemeinde)
INTERRELIGIÖSES LERNEN/WELTRELIGIONEN (7) Herbst 2009 (Judentum)
Frühjahr 2008 (Islam)
Herbst 2007 (eine Weltreligion)
Frühjahr 2006 (Fernöstliche Religionen) Frühjahr 2003 (Judentum)
Frühjahr 2002 (Fremdreligionen allgemein) Frühjahr 2001 (Fremdreligionen allgemein)
ETHISCHE THEMEN/WERTE UND NORMEN (7) Herbst 2010 (Werteerziehung)
Frühjahr 2010 (Ethische Themen allgemein) Herbst 2007 (Werteerziehung)
Frühjahr 2007 (Tod und Leben) Herbst 2006 (Sexualerziehung) Herbst 2006 (Gewalt)
Frühjahr 2001 (Ethische Themen allgemein)
BIBEL (6/7)
Frühjahr 2009 (Glaubenserfahrungen der Bibel) Herbst 2008 (Wundergeschichten)
(Frühjahr 2007 (Biblisch-christlicher Glauben)) Frühjahr 2005 (Bibeldidaktik allgemein) Herbst 2001 (Bibeldidaktik allgemein)
Herbst 2000 (Unterrichtsvorbereitung biblischer Themen) Frühjahr 2000 (Bibeldidaktik allgemein)
KONZEPTIONEN (4)
Frühjahr 2006 (Leitlinien des RU in Bayern & konzeptionelle Debatte im 20. Jh.) Frühjahr 2004 (Evangelische Unterweisung)
Herbst 2003 (Religionspädagogische Konzeptionen aus Geschichte & Gegenwart) Herbst 2001 (Religionspädagogische Konzeptionen der letzten 30 Jahre)
NEUE MEDIEN (4)
Frühjahr 2011 (Audiovisuelle Medien) Herbst 2008 (Neuere Medien allgemein) Herbst 2005 (Neue Medien allgemein) Herbst 2003 (Computereinsatz)
BILDUNG UND ERZIEHUNG (3)
Herbst 2010 (RU & allgemeine Bildungsaufgaben) Frühjahr 2005 (Religiöse Bildung)
Herbst 2002 (Religiöse Bildung, Erziehung & Sozialisation)
KIRCHENGESCHICHTE (3)
Frühjahr 2008 (Martin Luther)
Frühjahr 2007 (Kirchengeschichte allgemein) Herbst 2000 (Kirchengeschichte allgemein)
SCHÜLERINNEN (2/3)
(Herbst 2011)
Frühjahr 2009 Frühjahr 2000
LEHRERINNEN (2) Frühjahr 2004 Herbst 2001
GESANGBUCH (2) Herbst 2009 Frühjahr 2005
KIRCHENRAUMPÄDAGOGIK (2) Herbst 2011
Herbst 2004
DOGMATIK (1)
Herbst 2003 (Gottes Sein & Gottes Wirklichkeit)
3. Religion als Unterrichtsfach der Realschule
3.1. Schulprofil Realschule (Lehrplanebene 1)
3.1.1.Ziel und Anspruch der sechsstufigen Realschule
Gesetzliche Grundlagen des Bildungs- und Erziehungsauftrags der sechsstufigen Realschule: Grundgesetz Ds (GG), Verfassung Bayerns & Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) unter besonderer Berücksichtigung Artikel 131 der Bayerischen Verfassung:
(1) Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden.
(2) Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und vor der Würde des Menschen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft und Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne und Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt.
(3) Die Schüler sind im Geiste der Demokratie, in der Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk und im Sinne der Völkerversöhnung zu erziehen.
(4) Die Mädchen und Buben sind außerdem in der Säuglingspflege, Kindererziehung und Hauswirtschaft besonders zu unterweisen.
- Verortung der Aufgaben der Realschule in BayEUG, Art. 8 Abs. 1
(1) Die Realschule vermittelt eine breite allgemeine und berufsvorbereitende Bildung. Die Realschule ist gekennzeichnet durch ein in sich geschlossenes Bildungsangebot, das auch berufsorientierte Fächer einschließt. Sie legt damit den Grund für eine Berufsaus- bildung und eine spätere qualifizierte Tätigkeit in einem weiten Bereich von Berufen mit vielfältigen theoretischen und praktischen Anforderungen. Sie schafft die schuli- schen Voraussetzungen für den Übertritt in weitere schulische Bildungsgänge bis zur Hochschulreife.
(2) Die Realschule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10, Realschulen zur sonderpädagogischen Förderung auch weitere Jahrgangsstufen. Sie baut auf der Grundschule auf und verleiht nach bestandener Abschlussprüfung den Realschulabschluss.
(3) An der Realschule können folgende Ausbildungsrichtungen eingerichtet werden:
1.Ausbildungsrichtung I mit Schwerpunkt im mathematisch- naturwissenschaftlich-technischen Bereich,
2.Ausbildungsrichtung II mit Schwerpunkt im wirtschaftlichen Bereich,
3.Ausbildungsrichtung III mit Schwerpunkt im fremdsprachlichen Bereich; die Ausbildungsrichtung kann ergänzt werden durch Schwerpunkte im musischgestaltenden, im hauswirtschaftlichen und sozialen Bereich.
- Persönlichkeitsentwicklung und Vorbereitung auf künftige Aufgaben
- Entwicklung der Persönlichkeit mit dem Ziel eines mündigen Persönlichkeit in einer demokratischen & pluralistischen Gesellschaft
- Vermittlung relevanter Kenntnisse in den Feldern Person, Familie, Beruf & Ge- sellschaft
- Vermittlung der Wertmaßstäbe des Abendlandes & Sensibilisierung für andere Kulturen
- Förderung von Kompetenzen & Schlüsselqualifikationen für das Berufsleben Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit Informations- und Kommunika- tionstechniken mit dem Ziel einer sinn- und verantwortungsvollen Nutzung
- Eine begabungs- und neigungsgerechte Schule
- Realschule als Ort des praktischen Tuns & theoretischer Überlegungen
- Förderung des Lerneifers, der Lernfähigkeit, eines guten Gedächtnisses, des Konzentrationsvermögens & der Bereitschaft zu sorgfältigem und zuverlässi- gem Handeln
3.1.2.Bildungs- und Erziehungsschwerpunkte an der sechsstufigen Realschule
Breite allgemeine und berufsvorbereitende Bildung mit Vermittlung fachspezifischer Arbeitsweisen, Fachbegriffe & ihrer sachgerechten Verwendung
- Sprachlicher Bereich
- Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich o Gesellschaftswissenschaftlicher Bereich
- Wirtschaftswissenschaftlicher Bereich o Hauswirtschaftlich-sozialer Bereich o Religiöser Bereich
- Sittlich-ethischer Bereich
- Musisch-gestalterischer Bereich o Sport
Vermittlung eines soliden Grundwissens
- Qualität statt Quantität der Lernziele und -inhalte Anwendbarkeit des Wis- sens auch außerhalb der Schule & im späteren Leben?
- Vermittlung, Trainieren & Anwendung eines soliden Grundwissens in allen Fä- chern: Grundkenntnisse, -fertigkeiten, -einstellungen
- Achten auf konsequente Sicherung des Erlernten (Zusammenfassen, Wiederho- len, Üben, Hausaufgaben etc.)
- Vermittlung und Förderung grundlegender Kompetenzen und Einstellungen
- Vermittlung von Einstellungen & Haltungen über die fachspezifischen Kennt- nisse & Fähigkeiten hinaus, u.a.: Pünktlichkeit, Ordentlichkeit, Ausdauer, Eigen- initiative, Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit, Kreativität etc.
- Gestaltung des Unterrichts zur Förderung von Selbstständigkeit & Eigentätig- keit
Lernen lernen
- Unterstützung der eigenständigen Leistung des Lernens durch eine anregende Lernumgebung, abwechslungsreiches Lernmaterial & lebensnahe, interessante und motivierende Aufgaben
- Vermittlung der Relevanz von Lernen „Man lernt nicht für die Schule, son- dern für´s Leben!“
- Vermittlung von Kenntnissen zum vernünftigen Lernen, z.B. Benutzung von Nachschlagewerken, Umgang mit Informations- und Kommunikationsmedien etc.
- Teamfähigkeit
- Schaffen von Möglichkeiten zum gemeinsamen Lernen & arbeiten Erfahren der Vorteile gemeinsamen Arbeitens
- Erkennen der Relevanz der eigenen Meinung, aber auch der der MitschülerIn- nen Ergebnis der Gruppe, nicht eines Einzelnen
Vernetztes Denken
- Ziel von Kenntnissen & Fertigkeiten: Anwendung des Gelernten in unterschied- lichen Zusammenhängen Erkennen des Zusammenhangs von Lernzielen und -inhalten durch die SuS
- Notwendigkeit der Verknüpfung von neuen Inhalten mit alten (Vorwissen) Elaboration
Berufliche Orientierung
- Geben von Orientierungs- und Entscheidungshilfen für die Berufswahl der SuS Beratungsfunktion der Lehrkraft in Bezug auf SuS sowie auf die Eltern
- Schaffen von Möglichkeiten der Praxisbegegnung, z.B. Praktika
- Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt & der Wirtschaft Einblick & Ausei- nandersetzung mit der Arbeitswelt
- Sprachpflege
- Sprache als wichtigstes Mittel menschlicher Kommunikation und Grundvo- raussetzung für alle Belange menschlichen Lebens
- Ziele des Deutsch- und Fremdsprachenunterrichts: Sicheres & differenziertes Ausdrücken in mündlicher & schriftlicher Form
- Sprachpflege als Anliegen aller LuL in allen Unterrichtsfächern
Verantwortung für sich und die Gesellschaft
- Gemeinsames Arbeiten im Unterricht & Schulleben Fairer & rücksichtsvoller Umgang mit Anderen
- Vermittlung der Relevanz von Toleranz, Solidarität & Verantwortungsgefühl Praktische Umsetzung z.B. mit Tutoren
Kulturelle und interkulturelle Erziehung
- Vermittlung der Relevanz von Kultur für das eigene Leben
- Vermittlung von Heimatkenntnis/Heimatbewusstsein Aufbau einer eigenen Identität & Schaffen eines Verständnisses für die Welt (Weltoffenheit) o Gemeinsames Lernen & Arbeiten von SuS verschiedener Herkunft, Religion, Kultur, Wertvorstellungen & Traditionen Schaffen einer eigenen Identität & von Toleranz durch Kenntnis des Fremden/des Anderen
- Ethisches Urteilen und Handeln
- Entwicklung der Urteilsfähigkeit der SuS Verantwortliches Entscheiden & Handeln in der Gesellschaft
- Auseinandersetzung mit Werten & Normen der Gesellschaft
- Umwelterziehung
- Vermittlung der Relevanz von Nachhaltigkeit Aufzeigen der Chancen, aber auch Risiken gesellschaftlicher & technischer Entwicklungen
- Aufzeigen der Bedeutung der Natur für die Existenz des Menschen Über- nehmen von Verantwortung für Natur & Umwelt
Mitverantwortung und Mitgestaltung in der Demokratischen Gesellschaft
- Hinweisen auf die Rechte & Pflichten der SuS als Staatsbürger Überprüfung von Meinungen, Interessen etc. auf ihre Verantwortbarkeit & selbstständiges Vertreten dieser
- Ziel gesellschaftlichen Handelns: Verbesserung der Verhältnisse
- Erziehung zu Selbstständigkeit und Eigeninitiative: Übernehmen von Aufgaben im Un- terricht & in der Schule durch die SuS Tätigkeiten für die Gemeinschaft aus Eigenini- tiative heraus
Außerunterrichtliche Aktivitäten
- Vermittlung eines sinnvollen Umgangs mit der (Frei-)zeit
- Aufzeigen der Bedeutung außerschulischer, insbesondere ehrenamtlicher, Ak- tivitäten
- Bestimmung des Schullebens auch durch außerunterrichtliche Aktivitäten (SMV, Schülerzeitung, Sportveranstaltungen, Theateraufführungen etc.)
3.1.3.Unterricht und Schulleben und Stundentafel Religion (ev.)
Lebensraum Schule
- Schule als Lebens- und Arbeitsraum für SuS, LuL & die Schulleitung unter Be- teiligung der Eltern Sorgen für ein gedeihliches Miteinander (Achtung, Res- pekt, Toleranz, Regeln)
- Bemühen um ein eigenes Schulprofil & um die Weiterentwicklung der Schule
Schule und Elternhaus: Achten auf das verfassungsmäßige Recht der Eltern auf die Er- ziehung der Kinder Ziel: Bestmögliche Förderung durch Zusammenarbeit von Eltern & Schule
Gemeinsames Anliegen Erziehung: Vorbildfunktion der LuL & Abstimmung der Erziehungsarbeit mit anderen LuL & den Eltern
Schulqualität (auszugsweise)
- Schaffen eines verantwortungsvollen Klimas zwischen Schulleitung, LuL, SuS & Eltern
- Entschiedenes Bildungsbemühen aller Beteiligten o Enge Zusammenarbeit zwischen den LuL
- Vermittlung der Relevanz von Grundwissen & hohen fachlichen Leistungen o Individuelle Förderung der SuS
Positives Lernklima
- Hohe Bedeutung der Freude an der Schule & am Unterricht Erreichen durch Wertschätzung und Anerkennung aller & produktive Unterrichtsgestaltung o Einrichtung eines fördernden & fordernden Unterrichts Vermittlung des Sinns & Zwecks des Lernens
- Besprechung des Lehrplans mit der Klasse zu Beginn jedes Schuljahres
Fächerverbindendes Lernen: Wahrnehmung des Unterrichts als Ganzes Abstimmung der LuL untereinander & Initiieren eines gemeinsamen Unterrichtsvorhabens
- Lebensnaher und schülergerechter Unterricht
- Guter Unterricht via Anschaulichkeit, Methodenvielfalt & Wechsel in den Akti- ons- und Sozialformen des Lehrens & Lernens Rollenspiele, Experimente, Erkundungsgänge etc. mit dem Ziel sozialen Lernens & unmittelbarer Erfah- rung
- Beteiligung der SuS an der Gestaltung des Unterrichts in inhaltlicher & metho- discher Hinsicht
Verbindung von Theorie und Praxis
- Herstellen eines Bezugs zur Lebenswirklichkeit der SuS Handlungsorientie- rung & Lebensnähe mit Anknüpfung an die Erfahrungen der SuS o Beachtung des Prinzips der Anschaulichkeit Erarbeitung theoretischer In- halte an Beispielen
Stundenanzahl des Faches Deutsch in allen drei Wahlpflichtfächergruppen: 2 Stunden/ Woche
3.2. Fächerübergreifende Bildungs- und Erziehungsaufgaben (Lehrplanebene 2)
Berufliche Orientierung (BO)
- Vorbereiten auf Arbeitswelt, Beruf & Besuch weiterführender Schulen Unterstüt- zen & Informieren als Aufgaben der Schule mit Unterstützung durch Einrichtungen wie Berufsinformationszentren (BIZ) & Durchführung des Betriebspraktikums
- Wahlpflichtgruppe nach der sechsten Klasse als erster Weg zu einer beruflichen Ori- entierung; Jahrgangsstufe 9 mit Schwerpunktthema „Berufliche Orientierung“
- Vermittlung der Bedeutung von Werthaltungen, Arbeitstugenden & Schlüsselqualifi- kationen
Europa (EU)
- Europa mit gemeinsamen historischen Erbe, gemeinsamer kultureller Tradition & Lebenswirklichkeit Toleranz und Solidarität
- Vermittlung u.a.: Christlich-abendländisches Menschenbild, geographische Vielfalt Europas, Vielsprachigkeit, Aufgaben & Arbeitsweisen europäischer Institutionen etc. o Überwinden von Vorurteilen & Ängsten durch u.a. Schüler- und Lehreraustausch, bi- lingualen Unterricht, Studienfahrten etc.
Familien- und Sexualerziehung (FS)
- Erziehung zu verantwortlichem geschlechtlichem Verhalten mit besonderem Ziel der Förderung von Ehe & Familie
- Bejahen & Annehmen der eigenen körperlichen & seelischen Entwicklung o Krankheitsprävention
- Vermittlung von Einstellungen zum Aufrechterhalten verantwortlicher Partnerschaf- ten
Gesundheitserziehung (GE)
- Entwickeln & Fördern gesundheitsbewussten Verhaltens Verantwortung für einen selbst & für die Allgemeinheit
- Vermittlung u.a.: Gesetzmäßigkeiten & Prinzipien der Natur, Gesundheitserhaltung von Körper, Geist & Seele, Belastung der Allgemeinheit durch unvernünftiges Verhalten des Einzelnen, Grundregeln gesunder Ernährung
- Aufklärung über Drogenmissbrauch & andere Abhängigkeiten (Suchtprävention)
- Einnehmen einer kritischen Haltung gegenüber von „Lifestlye“-Produkten
Gewaltfreies Zusammenleben (GZ)
- Schaffen & Bewahren eines gewaltfreien Klimas Überwinden von Spannungen auf gewaltfreie Art & Weise
- Erkennen u.a.: Existenz vieler Formen der Gewaltausübung, Notwendigkeit eines friedlichen Miteinanders, Lernen dialogbasierter Bewältigungsstrategien o Ausprägung einer eigenen Identität Selbstbejahung, Akzeptieren persönlicher Schwächen
Informationstechnische Grundausbildung (IB)
- Informationsbeschaffung, Informationsverarbeitung & Kommunikation unter Ver- wendung moderner technischer Mittel Ziel: Selbstverständlicher, kompetenter & verantwortlicher Medienumgang
- Kennenlernen & Umgang mit der schuleigenen Geräteausstattung, Erfahrungen mit Computern sowie eine Reflexion über Vor- und Nachteile der Informations- und Kommunikationstechniken
- Mehrtägiges Projekt in der fünften Jahrgangsstufe aufgrund unterschiedlichen Vor- wissens
Medienerziehung (ME)
- Ziel der Medienkompetenz Verantwortlicher Umgang mit Medien v.a. in den Leit- fächern wie Deutsch unter Berücksichtigung der IB
- Ziele: Kennenlernen der Verbreitung & Wirkung von Medien; Verstehen und Beurtei- len der Sprache & Botschaften von Medien; Gestalten & Einsetzen von Medien; Aus- wählen & Auswerten von Medien; Sehen von Medien im gesellschaftlichen Kontext
Menschenrechtserziehung (MRE)
- Oberstes Ziel: Menschenwürdiges Leben für alle Streben nach Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Toleranz & solidarischem Handeln
- Interkulturelle Erziehung & Einsatz gegen Fremdenfeindlichkeit und für gegenseitige Achtung
- Verwirklichung der Menschenrechte inner- und außerhalb der SchuleMenschenrechtserziehung
- LuL als Vorbilder
Politische Bildung (PB)
- Politische Entscheidungen mit Einfluss auf jeden Einzelnen Auseinandersetzen mit Politik
- Vermittlung des hohen Wertes einer demokratischen Gesellschaft bzw. der dazuge- hörigen Verfassung durch Wissen, Urteilsfähigkeit & Handlungskompetenz
- Erziehen zu einer demokratischen Grundhaltung Einbeziehen der SuS in die Pla- nung des Unterrichts
- Politische Neutralität der LuL im Unterricht
Umwelterziehung (UE)
- Vermittlung eines Verantwortungsbewusstseins für Natur & Umwelt (natürliche Le- bensgrundlagen sowie gestalteter Kulturraum)
- Verstehen u.a.: Wechselseitige Abhängigkeiten zwischen Mensch & Umwelt, eigen- verantwortlichen Handelns für die Umwelt, ökologisch notwendigen & umweltge- rechten Handeln
- Notwendigkeit von Sachkenntnissen & Ausbildung einer Urteils- und Handlungsfä- higkeit
- Verkehrs- und Sicherheitserziehung (VSE)
- Verkehrserziehung, Unfallverhütung & Sicherheitserziehung Wecken eines Si- cherheitsbewusstseins bei den SuS: Verantwortung gegenüber den Mitmenschen, der Umwelt & sich selbst
- Ziele u.a.: Schulen der Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit, Erwerb von ver- kehrskundlichem & verkehrstechnischem Wissen
- LuL mit Vorbildfunktion
3.3. Pädagogische Leitthemen (Lehrplanebene 3)
- Fünfte Jahrgangsstufe - Sich in einem neuen Umfeld orientieren
- Besonderheiten der Jgst.: Neuer Lebensabschnitt & Neurorientierung
- Entwicklungspsychologische Aspekte: Leistungsbereitschaft, Neugier, Spontanität, konkretes & anschauliches Denken, Bewegungsdrang, begrenzte Ausdauer & Kon- zentrationsfähigkeit
- Pädagogische & unterrichtliche Schwerpunkte: Einhalten bestimmter Regeln & Grundsätze als wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Lernen sowie für ein ange- nehmes Klima, Vermitteln grundlegender Informationen über die Schulart & den Lehrplan, Vermitteln wichtiger Lern- und Arbeitstechniken, Fremdsprache Englisch
- Sechste Jahrgangsstufe - Schulgemeinschaft mitgestalten
- Besonderheiten der Jgst.: Vertraute Umgebung, Wahl einer Wahlpflichtfächergruppe am Ende der Jgst.
- Entwicklungspsychologische Aspekte: Bilden von Freundschaften & Gruppierungen meist im Rahmen des eigenen Geschlechts, individuelle Unterschiede in den Lernvo- raussetzungen
- Pädagogische & unterrichtliche Schwerpunkte: Blick von der Klassengemeinschaft hin auf die Schulgemeinschaft Außerschulische Aktivitäten, Ernstnehmen der SuS in ihren persönlichen Interessen Bestärken in ihren Kompetenzen
Siebte Jahrgangsstufe - Eigene Individualität entdecken
- Besonderheiten der Jgst.: Wiederfinden in einer neuen Klasse (Wahlpflichtfächer- gruppen) mit Ermöglichen eines erweiterten Weltverstehens
- Entwicklungspsychologische Aspekte: Unterschiedliches Fortschreiten der seelisch- körperlichen Entwicklung, Infragestellen der Autorität Erwachsener, Einnehmen ei- ner kritischen Haltung, mögliche Flucht in eine Scheinwelt, Suche nach Anerkennung & Bestätigung meist durch Gleichaltrige
- Pädagogische & unterrichtliche Schwerpunkte: Viel Unruhe & Verunsicherung; häu- fige Gesprächsform der Diskussion; gemeinsame Planung, Durchführung & Nachbe- reitung von Ausflügen zur Stabilisierung der Klassengemeinschaft; Bewusstwerden des eigenen Körpers; Veränderung des Verhältnisses zum anderen Geschlecht
Achte Jahrgangsstufe - Beziehungen aufbauen und gestalten
- Besonderheiten der Jgst.: Anspruchsvollere Profile der Wahlpflichtfächergruppen, komplexere Lerninhalte, Einforderung selbstständigen & eigenverantwortlichen Lernens
- Entwicklungspsychologische Aspekte: Selbstständigkeit & Selbstbestimmung, Suche nach Identifikationsfiguren, Verfolgen eigener Interessen, Verliebtsein, Zurückgehen der Bedeutung von Eltern & LuL, Ansteigen der Bedeutung Gleichaltriger, Cliquenbil- dung
- Pädagogische & inhaltliche Schwerpunkte: Fördern gemeinsamer Projekte, Begegnen der Jugendlichen mit Verständnis & pädagogischem Takt, Betrachten von Dingen aus unterschiedlichen Perspektiven, mögliche emotionale Labilität, Gruppendruck, Suchtgefahr
Neunte Jahrgangsstufe - Lebensperspektiven entwickeln
- Besonderheiten der Jahrgangsstufe: Schwerpunkt berufliche Orientierung mit pra- xisbezogenen Einblicken in das Berufsleben, Betriebspraktikum & Betriebserkun- dungen
- Entwicklungspsychologische Aspekte: Fragen nach dem Sinn des Lebens & der eige- nen Entwicklung; Untersuchen des Einflusses der Medien, der Politik & der Wirt- schaft; Reflexionsbereitschaft
- Pädagogische & unterrichtliche Schwerpunkte: Vermitteln von Kenntnissen & Fertig- keiten für den Beruf (Lebensläufe, Bewerbungsschreiben etc.), Üben des Auftretens (z.B. Rollenspiele), selbstkritische Einschätzungen, Erkennen der Relevanz von Flexi- bilität & Bereitschaft zu lebenslangem Lernen
Zehnte Jahrgangsstufe - An der Gestaltung von Gegenwart & Zukunft mitwirken
- Besonderheiten der Jahrgangsstufe: Ziehen einer persönlichen Bilanz, Abschlussprü- fung, neuer Lebensabschnitt, neues Fach Sozialkunde
- Entwicklungspsychologische Aspekte: Fordern der Jugendlichen als eigenständige Persönlichkeiten, Aufbau partnerschaftlicher Beziehungen, Übernehmen von Ver- antwortung, Lernen des Umgangs mit Krisen
- Pädagogische & unterrichtliche Schwerpunkte: Betrachten komplexer Sachverhalte aus verschiedenen Blickwinkeln, Übernehmen von Mitverantwortung in der Schule, Einbeziehen in wichtige Entscheidungsprozesse, Bilden & selbstbewusstes Vertreten einer eigenen Meinung
3.4. Fächerprofil Religion (Lehrplanebene 3)
Grundlegendes
- SuS in der Realschule im Übergangsstadium zum Erwachsenen Wahrnehmung,
Aseinandersetzung & Finden einer eigenständigen Position bzgl. verschiedener Werte & Traditionen mit dem Ziel einer selbstständigen Lebens in der Gemeinschaft unter Ernstnahme der SuS
- Geben von Impulsen zur Entfaltung der Persönlichkeit durch Eröffnung von Hoff- nungshorizonten & Vermittlung christlicher Wertmaßstäbe
- Bildung und Erziehung
- Allgemein
- Ermutigung zur Wahrnehmung als Geschöpfe Gottes mit seiner Begleitung Ernstnahme der Erfahrungen & Lebensfragen und stellen di eser in einen großen Kontext mit dem Ziel einer Orientierung für das eigene Leben
- Erproben einer Gemeinschaft: Finden & Vertreten eines eigenen Standpunk- tes sowie Lernen von Toleranz gegenüber anderen Wahrnehmung, dass der RU die SuS in ihrem Innersten berührt & ihnen dabei hilft, die eigene Persönlichkeit zu entfalten (Mündigkeit, soziale Kompetenz, Verantwor- tungsbewusstsein)
- Die biblische Botschaft im Leben umsetzen
- Wahrnehmung der lebensbejahenden & fördernden Dimension des christlichen Glaubens
- Lernen der Unterscheidung zwischen Wortlaut der Überlieferung & ihrer
Deutung
Einsicht einer gegenseitigen Ergänzung von Naturwissenschaften & Religion Kein Dualismus
- Lebensorientierung: eigenes Leben gestalten - Zusammenleben lernen
- Förderung der religiös-ethischen Lebensorientierung
- Bewusstwerden menschlicher Grunderfahrungen & Stellen in einen Sinnzusammenhang
- Sensibilisierung für globale Zusammenhänge & Ansprechen auf eine Mitver- antwortung für die Welt von morgen Verantwortungsvolles Gestalten des Lebens
- Ziele und Inhalte
- Formen religiösen Lebens (über das Kognitive hinaus)
- Kultivierung der eigenen Innerlichkeit
- Begegnung mit Gott
- Erfahrung einer spirituellen Gemeinschaft
- Erkennen der Bedeutung von Festen & Feiern für das christliche Leben
- In der Gemeinschaft glauben
- Christlicher Glaube mit der Fähigkeit zur Prägung & Veränderung des Lebens und der Kultur am Beispiel von Stationen aus dem Leben der Kirche Sichtbarmachen evangelischen Glaubens
- Anregen der KuJ zu eigenem Engagement in Kirche & Gesellschaft
- In den Dialog mit anderen Religionen und Glaubensrichtungen treten
- Einführen in das Verständnis anderer Konfessionen & Religionen
- Achtung vor den Überzeugungen anderer
- Förderung von Dialogbereitschaft & Zusammenarbeit
- Bewusstmachen einer Auseinandersetzung mit fremden Denken
- Methoden
- Problem-/ Schülerorientierung & Bibel-/ Traditionsorientierung
- Aufgabe der LuL: Verständnisvolles Begleiten von Fragen, Problemen & Entwicklungen der SuS
- Abweichen von Plänen möglich & Eingehen auf aktuelle Probleme (problemorientierter RU)
- Einsatz ganzheitlicher Methoden zur Anregung der Phantasie & Imaginati- onskraft
- Einsatz moderner Medien: Eröffnung neuer Möglichkeiten der Erarbeitung & Darstellung vieler Themenbereiche sowie kritische Auseinandersetzung und Medienkompetenz
Das Fach als Teil des Ganzen
- RU als spezifischer Zugang zu Lebensbereichen, die auch zur Thematik anderer Fä- cher gehören (Natur, Berufswelt, Partnerschaft, Sexualität) Aufnahme dieser Be- reiche zur Vermittlung eines vertieften Wirklichkeitsverständnisses o Deutlichwerden der Bedeutung des christlichen Glaubens
- Kooperation mit dem kath. RU: Entdecken von Unterschieden & Gemeinsamkeiten Deutlichwerden einer Vielfalt christlichen Denkens
- Geben wichtiger Impulse für das Schulleben durch Formen religiösen Lernens, Un- terrichtsprojekte, Anstöße zum Umgang mit Konflikten & zur Stärkung der Klassen- und Schulgemeinschaft
-Globalziel (1970) bzw. Leitlinien (2004) des ev. RU
- Leitlinien der Frühjahrssynode 2004 in Heilsbronn als Überarbeitung & Ablösung des Globalziels
- Zentrale Aufgabe des RU gemäß den Leitlinien: „Kommunikation der Schüler/innen mit der christlichen Tradition in der gegenwärtigen Welt“; Globalziel: Kommunikati- on mit dem christlichen Glauben Modifizierung des Globalziels um den Begriff Tradition (Geschichte des Christentums, Frömmigkeitspraxis, Lebensgestaltung, Ökumene, interreligiöser Dialog) = Erweiterung der Glaubenslehre um die Tradition
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.5. Lehrplan Religion (Lehrplanebene 3)
3.5.1.Jahrgangsstufe 5
Grundwissen am Ende der fünften Jgst.
- Wissen um den Wert der Schöpfung & den Wert des Menschen als Ebenbild Gottes; Bewusstsein menschlichen Handelns für die Schöpfung & Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für die Schöpfung
- Kennenlernen der Kirchengemeinde & des Kirchengebäudes vor Ort Ent-
wicklung eines Gefühls der Zugehörigkeit; Wahrnehmung der Vielseitigkeit des kirchlichen Angebots & Kennenlernen von Personen im kirchlichen Umfeld o Begreifen des AT als Buch des Glaubens mit Erfahrungen des Menschen mit Gott (Orientierung, Fragen, Einstellungen); Selbstständiges Nachschlagen bibli- scher Texte
- Wissen von Gottes Liebe zu jedem einzelnen Menschen; Wahrnehmen der ei- genen Individualität Lernen, sich anzunehmen & Bereitschaft zur Übernah- me von Verantwortung für sich selbst; Bekanntheit von Psalm 23 o Kennen biblischer Perspektiven für ein gutes Zusammenleben, Empathie, Teamfähigkeit & Ausbilden eines Bewusstseins für die Klassengemeinschaft
EvR 5.1: Schöpfung: Unser Leben und unsere Welt - ein Geschenk Gottes
- Biblischer Schöpfungsglaube: Wahrnehmung von „Schöpfungswundern“ aus der Natur; Mensch als Ebenbild Gottes; Verstehen des Lebens als einmaliges Geschenk; Ausdrücken von Dank für die Schöpfung (singen, beten, gestalten, feiern)
- Schöpfung als unabgeschlossener Prozess: Verantwortung des Menschen für die Welt
- Vorschläge zur ganzheitlichen Unterrichtsgestaltung: Finden von „Wundern der Schöpfung“; Erkennen von Bewahrenswertem (Bilder, Symbole, Lieder); Einüben eines schöpfungsgemäßen Umgangs mit Tieren; Formulieren eines Vertrags mit der „Natur“
EvR 5.2: Heimat entdecken: Kirche am Ort
- Unsere Kirchengemeinde: Besuch eines Kirchengebäudes am Schulort; Erkun- den von Menschen, Gebäuden & Angeboten der Kirchengemeinde o Über die Ortsgemeinde hinaus: Herkunftsgemeinden der SuS (christliche Kir- chen in der Umgebung); Stationen aus der regionalen KG
- Vorschläge zur ganzheitlichen Unterrichtsgestaltung: Unterrichtsgang zu Kir- chen; Feiern einer Andacht in der Ortskirche; Einbeziehung heimatgeschichtli- cher Ereignisse oder Personen
EvR 5.3: Das Alte Testament erzählt von Erfahrungen, die Menschen mit Gott machen
- Menschen erzählen von ihren Erfahrungen, Wünschen, Hoffnungen & Ängsten (Briefe, Tagebücher, Biografien)
- Aufbau der Bibel: AT & NT; Inhaltliche Blöcke des AT; Grundinformationen zur Entstehung & Bedeutung des AT für das Judentum und Christentum o Menschen machen Erfahrungen mit Gott: Beispielhafte Erfahrungen kennen lernen (z.B. Abraham und Sarah, Exodus, Königsgeschichten Ausführliche Erarbeitung eines Themenbereichs, ggf. eines zweiten); Wiederfinden von Got- tesvorstellungen & Glaubensfragen (Unsichtbarkeit Gottes, Gerechtigkeit, Ge- borgenheit)
- Vorschläge zur ganzheitlichen Unterrichtsgestaltung: Formulieren von Kinder- briefen an den lieben Gott,1 Lesen & Beantworten; Fortlaufendes Erzählen oder Lesen einer biblischen Geschichte zu Beginn oder Ende der stunde; Bibliodra- ma zu einer Geschichte des AT; Bildbetrachtung
EvR 5.4: Wer bin ich?
- In der neuen Religionsgruppe: Selbstvorstellung (Hobbys, Stärken/ Schwä- chen, Ängste, Träume, Hoffnungen)
- Leben in Vertrauen & Verantwortung: Einmaligkeit eines jeden SuS als Eben- bild Gottes; Erfahrungen & Wünsche zu Kraft, Mut und Selbstvertrauen (z.B. Psalm 23); Verantwortung für sich selbst & die eigene Gesundheit o Vorschläge zur ganzheitlichen Unterrichtsgestaltung: Übertragen der Taufsprüche in die eigene Sprache; „Mutmachsäckchen“ mit selbst gewählten Bibelworten
EvR 5.5: Meine neue Unterrichtsgruppe, meine neue Klasse
- Wir sind uns in manchem ähnlich und in vielem unterschiedlich: Freude an der Vielfalt, Bereicherung durch Verschiedenheit in der Gruppe; Toleranz & Res- pekt als Grundlage für eine gute Gemeinschaft
- Ein gutes Zusammenleben gestalten: Einander zuhören & aufeinander einge- hen (Gesprächsregeln); Teamarbeit; Gestaltung gemeinsamer Feiern o Vorschläge zur ganzheitlichen Unterrichtsgestaltung: Erstellung eines Klassen- gebetbuchs
3.5.2.Jahrgangsstufe 6
Grundwissen am Ende der sechsten Jgst.
- Kennen wichtiger Situationen aus dem Leben Jesu; Kennen zentraler Aussagen seiner Botschaft; Erfahren der Nähe Gottes durch Jesus
- Wahrnehmen der Möglichkeit, Gott im Gebet alles anzuvertrauen; Kennen des Vaterunser; Kennen evangelischer Gottesdienstelemente; Kennen christlicher Symbole & Bräuche
- Bewusstwerdung der kraft- und mutspendenden Möglichkeit des NT; Finden eigener Zugänge zu biblischen Texten; Überblick über Aufbau & Entstehung des NT
- Deutlichwerden der Ermöglichung des eigenen Lebens durch andere; Erken- nen der Mitverantwortung für die Gestaltung von Beziehungen; Kennen bibli- scher Perspektiven guten Zusammenlebens
- Bewusstwerden der Bedeutung des Einzelnen für die Gemeinschaft; Wahr- nehmung der Bedeutung der Diakonie & Kennen von Beispielen für diakoni- sche Arbeit der Kirche
EvR 6.1: Jesus Christus: Freund der Menschen
- Die Umwelt Jesu: Leben der Menschen in Palästina mit ihrem Glauben & Hoff- nungen; Aufwachsen Jesu als Jude
- Jesu Zuwendung zu den Menschen: Beispiele der Zuwendung Jesu zu anderer (Heilung, Vergebung) & die Konsequenzen
- Jesu Tod und Auferstehung: Einzug in Jerusalem bis zur Kreuzigung; Hilflosig- keit der Jünger am Beispiel des Petrus; Begegnung mit dem Auferstandenen
- Die gute Nachricht wirkt weiter und prägt Menschen
- Vorschläge zur ganzheitlichen Unterrichtsgestaltung: Betrachten, Deuten & Ge- stalten von Jesusdarstellungen; Bibliodrama; Umformulieren der Seligpreisun- gen; Lieder mit Jesus (auch aus anderen Kulturen)
EvR 6.2: Christliche Tradition und religiöses Leben wahrnehmen, verstehen, hinein- wachsen
- Christliche Bräuche, Symbole & Handlungen; Fest und Feier im Kirchenjahr
- Beispiele religiösen Lebens: Gebet, Gottesdienst, Gesang etc.
- Ergänzend ggf.: Gebet & Feier zu vergleichbaren Lebenssituationen oder Fes- ten in anderen Weltreligionen
- Vorschläge zur ganzheitlichen Unterrichtsgestaltung: Erstellen eines kirchli- chen Festkalenders; Einüben religiöser Formen (Gebet, Stille, Fasten); Erarbei- tung & Gestaltung einer Feier, einer Andacht bzw. eines Gottesdienstes; Religi- öse Feiern im Lebenslauf
EvR 6.3: Das Neue Testament - die Botschaft, die Menschen bewegt
- Botschaften, die erfreuen, stärken und Mut machen: Berichten über eigene Er- fahrungen
- Das Neue Testament als Buch: Entstehung des NT; Zeit, Umgebung, Inhalt & Einteilung; Orientierung im NT (Lesen, Nachschlagen, Zuordnen) o Das Neue Testament für Menschen heute: Umgehen mit biblischen Texten & Finden eines eigenen Zugangs; Kraft, Trost & Hoffnung aus dem Glauben ge- winnen & weitergeben
- Vorschläge zur ganzheitlichen Unterrichtsgestaltung: Abschnittweise (Vor-
)lesens eines Evangeliums; Bildliches oder kaligraphisches Darstellen selbst gewählter Bibelworte; Basteln einer Schriftrolle & Aufschreiben von Bibelworten; Finden des NT in verschiedenen Sprachen, Ausgaben etc.
Evr 6.4: Ich brauche andere Menschen, andere brauchen mich: Familie und Freund- schaft
- Meine Familie: Verstehen der Familie als tragende & entwicklungsfördernde
[...]
1 Zur Problematik dieser Formulierung vgl. Kapitel zu Gewalt/ Aggression (Werteerziehung).