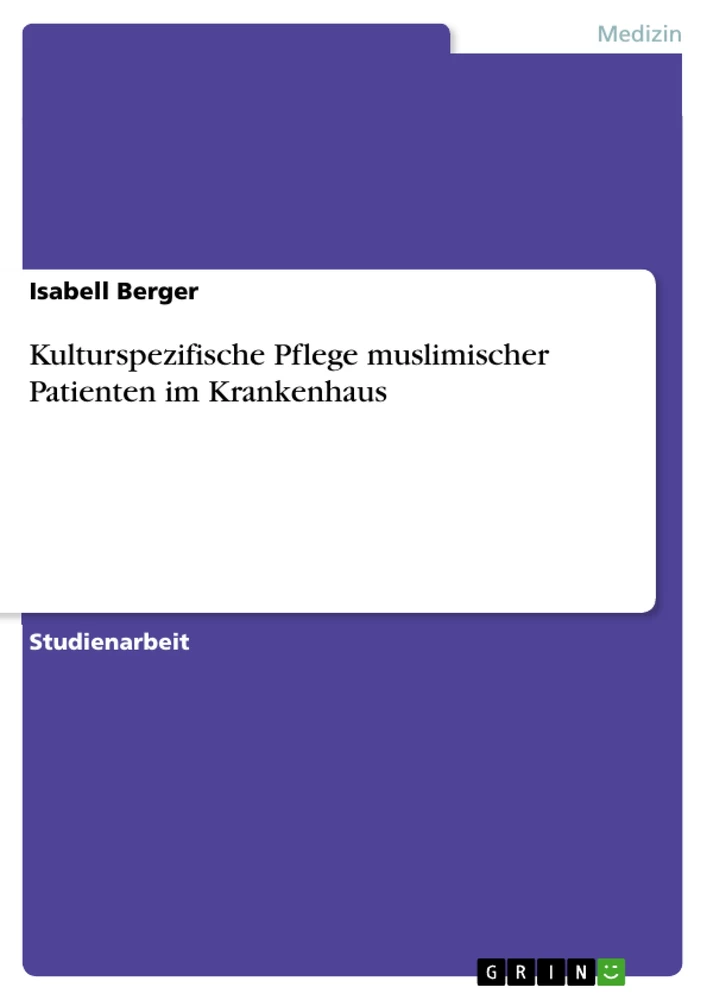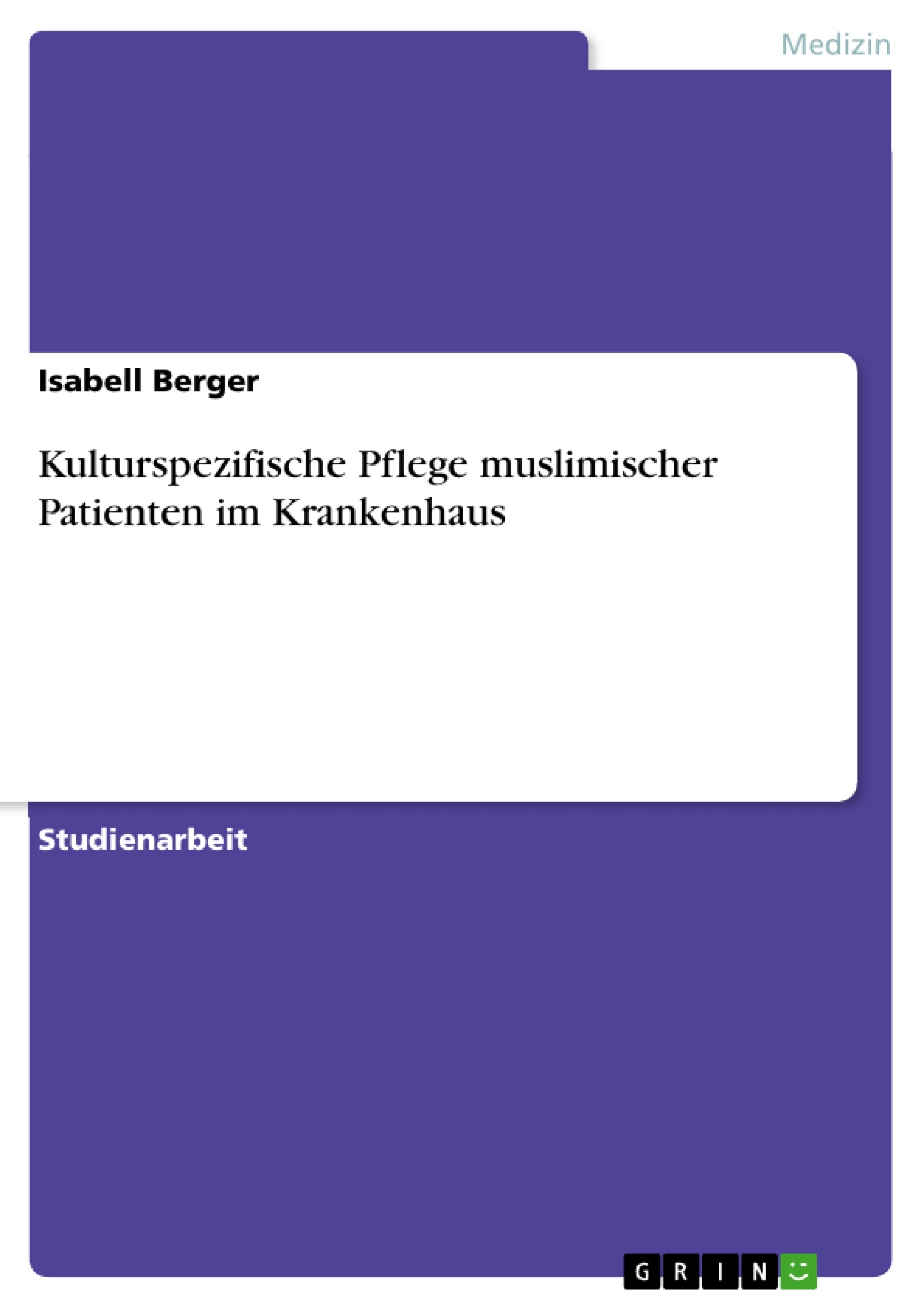Wir kommen täglich mit Menschen in Kontakt, die eine andere Kultur leben, als sie uns bekannt ist. Menschen die eine andere, für uns fremde Religion pflegen, andere Lebensgewohnheiten haben und manche Dinge einfach anders angehen.
Besonders in der Pflege, wo man sehr engen und intimen Kontakt zu fremden Menschen hat, führt das nicht selten zu Diskrepanzen.
Die folgende Arbeit ist fokussiert auf muslimische Mitbürger. Sie stellt kurz dar, wie türkische Migranten, die nun schon in der dritten oder vierten Generationen hier leben, ins Aufnahmeland Deutschland kamen und gibt einen Kurzeinblick in den Islam.
Die durch das Aufeinandertreffen der deutschen und der türkischen Lebensgewohnheiten entstehenden Kommunikationsprobleme werden kurz erläutert und die Besonderheit des Gesundheitszustandes von Migranten wird dargestellt.
Ungewissheit ist ein Zustand, der in der türkischen Kultur als bedrohlich empfunden wird. Türken reagieren oft sehr emotional und haben große Schwierigkeiten, andere Ansichten und Meinungen zu tolerieren (vgl. v. Bose et al 2012, S. 167). Auf diese und weitere Differenzen, die brisant für das Gesundheitswesen sind, wird näher eingegangen.
Speziell im stationären Bereich führen verschiedene Auffassungen von Werten und Normen immer wieder zu Unsicherheit und Missverständnissen. Für viele Pflegende stellt die Betreuung von Muslimen eine Herausforderung dar. Dabei wollen sie doch nur auf die Bedürfnisse ihrer muslimischen Patienten eingehen.
Problematiken entstehen durch den Glauben und dadurch begründete Verpflichtungen im Umgang mit Angehörigen, bei der Ernährung, im Umgang mit der Intimsphäre und mit Tod, Trauer und Schmerz. Es werden Lösungsansätze formuliert, die den Mitarbeitern in Einrichtungen des Gesundheitswesens Unterstützung bieten sollen, um kulturbedingte Konflikte erkennen und lösen zu können. Bereits in der Ausbildung können Grundsteine dazu gelegt werden. Langjährig erfahrene Mitarbeiter benötigen aktuelle Schulungen und die Ausbildung von Multiplikatoren soll helfen, vor Ort schnell kultursensibel handeln zu können.
Inhalt
1 Einleitung
2 Migration und Integration
3 Der Islam
3.1 Zielgruppe der Muslime
3.2 Interkulturelle Kommunikationsprobleme
4 Gesundheit von Migranten
4.1 Kulturelle Differenzen
4.1.1 mit Angehörigen
4.1.2 durch den Glauben
4.1.3 bei der Ernährung
4.1.4 zur Bewahrung der Intimsphäre
4.1.5 im Umgang mit Tod, Trauer und Schmerz
5 Lösungsansätze
5.1 Unterstützung für Mitarbeiter
5.2 Notwendige Konsequenzen für Aus- und Weiterbildung
6 Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Wir kommen täglich mit Menschen in Kontakt, die eine andere Kultur leben, als sie uns bekannt ist. Menschen die eine andere, für uns fremde Religion pflegen, andere Lebensgewohnheiten haben und manche Dinge einfach anders angehen.
Besonders in der Pflege, wo man sehr engen und intimen Kontakt zu fremden Menschen hat, führt das nicht selten zu Diskrepanzen.
Die folgende Arbeit ist fokussiert auf muslimische Mitbürger. Sie stellt kurz dar, wie türkische Migranten, die nun schon in der dritten oder vierten Generationen hier leben, ins Aufnahmeland Deutschland kamen und gibt einen Kurzeinblick in den Islam.
Die durch das Aufeinandertreffen der deutschen und der türkischen Lebensgewohnheiten entstehenden Kommunikationsprobleme werden kurz erläutert und die Besonderheit des Gesundheitszustandes von Migranten wird dargestellt.
Ungewissheit ist ein Zustand, der in der türkischen Kultur als bedrohlich empfunden wird. Türken reagieren oft sehr emotional und haben große Schwierigkeiten, andere Ansichten und Meinungen zu tolerieren (vgl. v. Bose et al 2012, S. 167). Auf diese und weitere Differenzen, die brisant für das Gesundheitswesen sind, wird näher eingegangen.
Speziell im stationären Bereich führen verschiedene Auffassungen von Werten und Normen immer wieder zu Unsicherheit und Missverständnissen. Für viele Pflegende stellt die Betreuung von Muslimen eine Herausforderung dar. Dabei wollen sie doch nur auf die Bedürfnisse ihrer muslimischen Patienten eingehen.
Problematiken entstehen durch den Glauben und dadurch begründete Verpflichtungen im Umgang mit Angehörigen, bei der Ernährung, im Umgang mit der Intimsphäre und mit Tod, Trauer und Schmerz. Es werden Lösungsansätze formuliert, die den Mitarbeitern in Einrichtungen des Gesundheitswesens Unterstützung bieten sollen, um kulturbedingte Konflikte erkennen und lösen zu können.
Bereits in der Ausbildung können Grundsteine dazu gelegt werden. Langjährig erfahrene Mitarbeiter benötigen aktuelle Schulungen und die Ausbildung von Multiplikatoren soll helfen, vor Ort schnell kultursensibel handeln zu können.
2 Migration und Integration
Migration stellt einen Spezialfall von Mobilität dar und ist ein anderer Begriff für Wanderungen. Gemeint ist hier die räumliche Mobilität, die den Wechsel des Hauptwohnsitzes einer Person voraussetzt (vgl. Haug 2009, S. 7). Wanderungen gibt es schon so lange, wie der Mensch existiert, und sind kein Phänomen der heutigen Zeit.
Unterschieden wird zwischen der Binnenwanderung, bei der der Wohnortwechsel innerhalb Deutschlands stattfindet, und der internationalen Migration, bei der Herkunft und Ziel der Migranten in verschiedenen Ländern liegen. In beiden Fällen ist der Wohnortwechsel für einen langfristigen Zeitraum angelegt.
Für die demographische und gesellschaftliche Entwicklung ist Migration ein zentraler Bestandteil. Die demographische Entwicklung hängt eng mit der Zuwanderung zusammen. Es gibt die verschiedensten Gründe, warum Migranten nach Deutschland kommen. Klar ist jedoch, dass die Einwanderer demographische Besonderheiten aufweisen, wie eine jüngere Altersstruktur und besondere Gesundheitsrisiken (vgl. Haug 2009, S. 56).
Für den zugewanderten Menschen bedeutet Migration tiefgreifende soziale Veränderungen, die durchaus Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Durch den Arbeitskräftemangel und die dadurch induzierte Arbeitsmigration in den 60er Jahren strömten viele verschiedene Kulturen in die Bundesrepublik. Für das heutige Gesundheitswesen bedeutet dies, dass der Bedarf an Pflege für ältere Migranten zunehmend ist.
Beispielhaft soll die anteilig größte Gruppe, die türkischen Migranten, betrachtet werden (vgl. Hoffmann 2006, S. 6).
Integration ist ein Prozess zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, der Angleichung von Lebenslagen, sowie der kulturellen und sozialen Annäherung (vgl. Hirseland 2009, S. 8).
Sie verläuft immer individuell und wird durch verschiedenste Faktoren begünstigt oder behindert. „So muss die Aufnahmegesellschaft die Rahmenbedingungen bereitstellen, um Migranten den Zugang zu den zentralen gesellschaftlichen Bereichen wie Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Auf Seiten der Migranten begünstigen vor allem individuelle Faktoren wie gute Bildungsabschlüsse die Integration (Hirseland 2009, S. 64).“
3 Der Islam
Das Wort Islam begegnet uns täglich in Zeitungen und in den Nachrichten. Wir wissen so ungefähr, was damit gemeint ist, aber was es wirklich bedeutet, ist uns nicht klar. Das Wort Islam kommt aus dem Arabischen und hat inhaltlich etwas mit Sicherheit, frei sein und Frieden zu tun. Es bedeutet aktive Ergebung in Gott, aktive Hingabe an Gott, um Frieden zu finden (vgl. Köck et al 2009, S. 12).
Der Islam ist die jüngste der drei monotheistischen Weltreligionen. Als Begründer des islamischen Glaubens gilt der Prophet Mohammed, der 570 in Mekka auf der arabischen Halbinsel geboren wurde. Im heiligen Monat Ramadan begab sich der damals 40jährige Mohammed zum Fasten auf den Berg Hira bei Mekka. Dort erschien ihm der Erzengel Gabriel und forderte ihn auf, das Wort Allahs zu verkünden. Er empfing im Laufe der folgenden Monate weitere Offenbarungen, teilte diese aber nur wenigen nahestehenden Menschen mit (vgl. Fisher 1999, S. 331).
Die Verkündungen, in denen er zum Glauben an den einen Gott aufrief und vor dem jüngsten Gericht warnte, währten für circa drei Jahre. Mohammeds Prophetentum blieb weitestgehend inoffiziell.
Es sprach sich allerdings in Mekka herum, dass Mohammed sich als Empfänger göttlicher Offenbarungen betrachtete und noch bevor er öffentlich auftrat, redete bereits ganz Mekka darüber (vgl. McCourt 2011, S. 10).
Vergleichbar mit heutigen Messe- und Pilgerstädten, war Mekka schon damals ein Handelsknotenpunkt und ein Wallfahrtsort in der Wüste, gelegen an der Weihrauchstraße. Reisende Beduinen und der Aufenthalt vieler Karawanen, die in Mekka diversen Göttern huldigen wollten, sicherte der Stadt und ihren Bewohnern ein gutes Einkommen.
Im Polytheismus verdiente Mekka also gut. Demnach sahen sie in Mohammeds Alternative des Monotheismus eine wirtschaftliche Gefahr und es kam zu einem Mordkomplott. Nach Bekanntwerden des Komplotts sah Mohammed sich gezwungen, seine Heimatstadt in Richtung Yathrib, das heutigen Medina, zu verlassen. Mit dieser Flucht im Jahr 622 beginnt die islamische Zeitrechnung.
In Mekka fungierte Mohammed hauptsächlich als Prophet und gab die Offenbarungen Gottes an seine wachsende Zahl von Anhängern weiter. In Medina hingegen wuchs er in eine führende politische Rolle hinein. Hier bewegten sich Offenbarungen in konkreter Gesetzgebung und bestimmten das Verhältnis zum Leben in der Gemeinde, zu Christen und zu Juden (vgl. McCourt 2011, S. 10).
Neben der Kaaba in Mekka ist eine Moschee in Medina der zweitheiligste Ort im Islam. Hier lebte und starb Mohammed. Es war einst sein Haus, welches sich bereits zu Lebzeiten zu einer Moschee entwickelte. Heute ist es eine Pilgerstätte.
Den Moslems ist die Lebensgeschichte Mohammeds heilig und sie versuchen seinen Qualitäten Milde, Freundlichkeit und edlem Charakter nachzueifern.
Mohammed hat stets übermenschliche Fähigkeiten geleugnet, nach dem Koran war er ein Mensch wie alle und nur ein Diener der Offenbarung (vgl. Fisher 1999, S. 336).
Nach dem Tod des Propheten Mohammed verbreitete sich der Islam mit erstaunlicher Geschwindigkeit. In erster Linie durch persönliche Kontakte und freiwillige Bekehrungen, aber auch durch gewaltsame Übergriffe und aus ökonomischen Gründen (vgl. Fisher 1999, S. 372).
Auch in Deutschland gibt es eine Vielzahl von Muslimen. Der größte Teil von ihnen ist zugewandert oder lebt in Folgegenerationen von Zuwanderern in der Bundesrepublik.
Auf diese große Bevölkerungsgruppe wird im Folgenden eingegangen.
3.1 Zielgruppe der Muslime
In Deutschland leben insgesamt rund 82 Millionen Menschen, davon sind zwischen 3,8 und 4,3 Millionen Menschen Muslime. Prozentual bedeutet dies einen Anteil zwischen 4,6 und 5,2.
Rund 45 Prozent der in Deutschland lebenden Muslime mit Migrationshintergrund sind deutsche Staatsangehörige, rund 55 Prozent verfügen über eine ausländische Nationalität (vgl. Dt. Islam Konferenz, S. 1). Bei der regionalen Herkunft der Muslime in Deutschland handelt es sich um eine sehr heterogene Bevölkerung. Knapp 2,5 bis 2,7 Millionen Muslime haben türkische Wurzeln. Somit ist die große Gruppe der Türkischstämmigen mit 63 Prozent dominant.
Rund 14 Prozent sind Personen aus südosteuropäischen Ländern, wie Bosnien, Bulgarien und Albanien. Mit rund 8 Prozent sind Migranten aus dem Nahen Osten die drittgrößte Bevölkerungsgruppe in Deutschland lebender Muslime (vgl. Dt. Islam Konferenz, S. 2).
Das äußere Erscheinungsbild einer Person gibt oftmals Auskunft, wo der Mensch tendenziell ursprünglich herkommt oder wo seine Wurzeln liegen. Hat also ein Mensch eine dunkle Hautfarbe, so kommt er aus Afrika, ist er dunkelhaarig und hat braune Augen vermutlich aus Südeuropa.
In diesem Zusammenhang wird oftmals auch eine Religion zugeordnet. Demnach ist ein türkisch aussehender Mensch automatisch auch gläubiger Muslime.
Die Mehrheit der Muslime ist gläubig und Religiosität ist insbesondere bei türkischstämmigen Muslimen ausgeprägt, jedoch sind ein Drittel der Muslime nicht gläubig.
Unter den gläubigen Muslimen gibt es verschiedene Konfessionen. Die größte konfessionelle Gruppe der Muslime in Deutschland bilden die Sunniten. Es folgt die Gruppe der Aleviten und die der Schiiten. In fast allen Herkunftsgruppen und Konfessionen sind muslimische Frauen tendenziell gläubiger als Männer (vgl. Dt. Islam Konferenz, S. 3). Starke Religiosität ist allerdings keine Besonderheit der Muslime.
Im Vergleich zu anderen Religionen in Bezug auf Gläubigkeit bestehen nur geringfügige Unterschiede. Große Unterschiede hingegen gibt es in der religiösen Alltagspraxis, wie beim Beten, dem Begehen religiöser Feste, die Einhaltung von Speisevorschriften durch den Glauben und Fastengebote (vgl. Dt. Islam Konferenz, S. 4).
Neben den katholischen und evangelischen Christen bilden Muslime heute die drittgrößte Religionsgemeinschaft innerhalb Deutschlands. Demzufolge besteht eine hohe Relevanz für das Gesundheitswesen, da diese Gruppe einen großen Anteil von Patienten im Krankenhaus bildet.
In den 60er Jahren gab es in Deutschland einen erhöhten Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften. Somit kamen im Auftrag der deutschen Regierung Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen nach Deutschland. 1961 wurde ein Abkommen dazu mit der Türkei vereinbart. Angedacht war ein zeitlich begrenzter Aufenthalt, heute leben viele dieser Migranten aber schon in dritten oder vierten Generationen in Deutschland (vgl. Binnewies 2008, S. 4).
3.2 Interkulturelle Kommunikationsprobleme
Obwohl Deutschland seit vielen Jahren ein Einwanderungsland ist und der Bevölkerungsanteil von türkischstämmigen Menschen weiter wächst, bestehen auf beiden Seiten noch immer Kommunikationsprobleme.
Unzureichende oder nicht vorhandene Deutschkenntnisse und eine resignierte Sprachkompetenz führen zweifellos zu zentralen Problemen (vgl. Uzarewicz 2009, S. 26). Doch auch wenn die Sprache verständlich scheint, wird die in Deutschland gängige sehr direkte und sachliche Kommunikation oft falsch verstanden. In der Türkei findet eine wesentlich indirektere Kommunikation statt. Sinn und Zweck ist es, ein harmonisches Verhältnis mit dem Gesprächspartner aufzubauen und sich an die dort in erster Linie vorherrschenden Regeln von Höflichkeit, Scham und Hierarchie zu halten. Jugendliche und Frauen halten so beispielsweise Blicken nicht Stand, sondern weichen ihnen extra aus. Dies ist ein Zeichen von Höflichkeit und Respekt. Auf Deutsche wirkt es eher unsicher und verweigernd.
Dieses Beispiel zeigt, wie gleiches Verhalten unterschiedlich wahrgenommen werden kann (vgl. v. Bose 2011, S. 10).
Für einen Aufenthalt im Krankenhaus bedeutet es, dass türkische Patienten kompliziert und umständlich sind, überempfindlich reagieren und sich nur schwer an Regeln halten. Umgekehrt betrachtet sind deutsche Pflegende unhöflich, kalt und unpersönlich. Sie haben einen verletzenden Befehlston und ein brutale Sprache (vgl. v. Bose 2011, S. 11).
Schon im Aufnahmegespräch und bei der Anamnese ist es möglich, dass wichtige Informationen über körperliche Befindlichkeiten nicht, oder nur verschlüsselt mitgeteilt werden. Wird die Intimsphäre und die Schamgrenze überschritten, geben Muslime oft nur unzureichende Auskünfte. Die Mitarbeiter des Gesundheitswesens müssen die verschlüsselte Kommunikation und die Tabuisierung der Intimsphäre berücksichtigen, damit Wichtiges nicht übersehen wird (vgl. v. Bose et al, 2012, S. 31).
Im Folgenden werden weitere Differenzen dargestellt, die die Brisanz einer Sensibilisierung auf Seiten der Mitarbeiter im Gesundheitswesen aufzeigen.
[...]