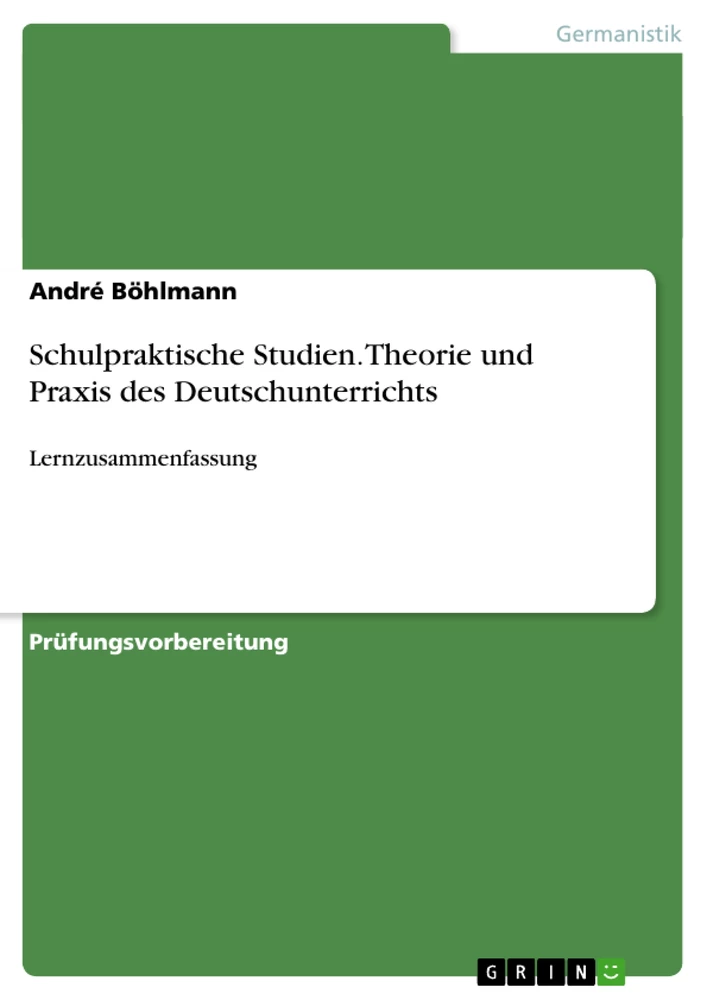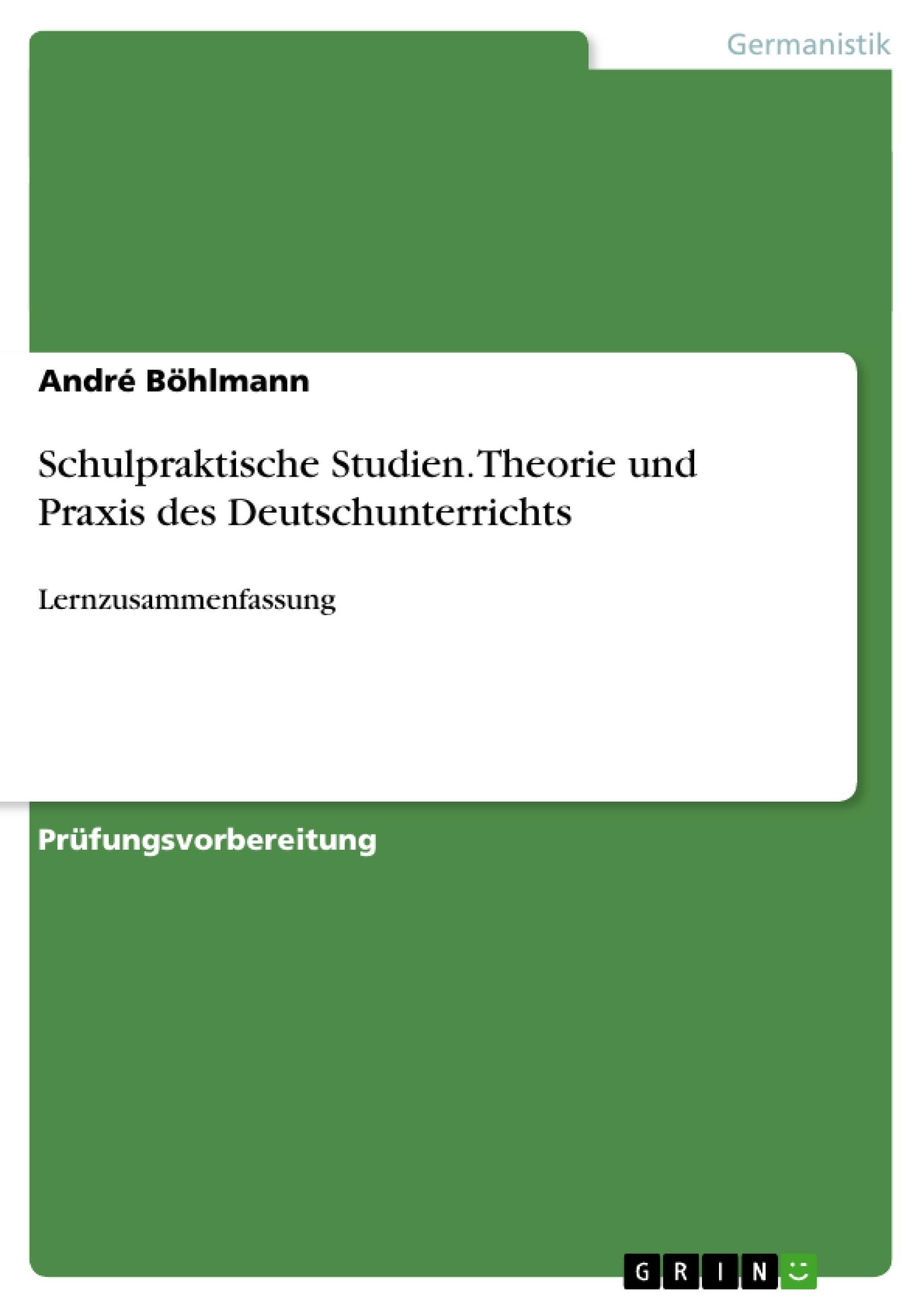Lernzusammenfassung Einführungsmodul Fachdidaktik Deutsch. Inhalt:
1. Planung einer Deutschstunde
2. Lesekompetenz
3. Handlungs- und produktionsorientierter Deutschunterricht
4. Schriftlicher Sprachgebrauch
5. Mündlicher Sprachgebrauch
6. Grammatikunterricht
7. Rechtschreibung im Deutschunterricht
1. Planung einer Deutschstunde
1.1. Bestimmungsfaktoren von Unterricht
- Lehrmittelverfügbarkeit
- Räumliche Situation
- Unterrichtsgegenstand
- Interesse am Thema
- Soziales Umfeld
- Leistungsniveau
àwirken auf Schüler und Lehrer
1.2. Analysemethoden
a) Sachanalyse:
= Analyse des Gegenstandes aus (fach-) wissenschaftlicher Sicht
Fragebereiche lit. Sachanalyse
- Text: Inhalt + Sprache
- Gattung, Autor
- Lit.-geschichtl. Einordnung, Entstehungszeit/-kontext, Epoche
- Äußere Form, Aussage des Textes, Aufbau, Struktur
- Positionen in der Sekundärliteratur
- Fachübergreifende Bezüge + intertextuelle Bezüge
Problematik der SA
à greift oft zu kurz
Gründe für SA
- Souveränes Wissen erlangen
- Aufzeigen von Zusammenhängen
- Methodenmöglichkeiten daraus ableitbar
- Begründetes Setzen von Schwerpunkten
b) Didaktische Analyse:
= Frage nach Auswahl und Legitimation von U.-Gegenständen
Zielorientierung („didaktischc Reduktion“)
- Einfache Zielsetzung (nicht zu stark vereinfacht)
- Lernziele ßà Lehrziele + gewünschtes Lernergebnis
- àÜberprüfung von Erfolg des Unterrichts
- à Beschützen davor, Bedeutung für Lernende nicht aus den Augen zu verlieren
- à wichtige Orientierungshilfe
1.3. Lernziele
Gegliedert in:
Genauigkeit: Grobziele ( bestimmtes Z), Richtziele (allgemeines Z), Feinziele (genaue Z.stellung)
Persönlichkeitsbereiche: Unterscheid. von kognitiven, affektiven, sozialen und psychomotor. Zielen
Anforderungsbereiche: Wissen (bereitstellen + abrufbar machen), können und anwenden (Wissen darauf beziehen), produktives Denken + Gestalten / eigene Lsg. Für noch nicht bekannte Probleme
à nach thüringer Lehrplan
à LZ- Taxonien (Unterscheidung)
- Orientierung an untersch. Bereichen
- Nicht nur Konzentration auf Wissen
Kompetenzen brauchen Wissen
- Wissen muss gekoppelt an Anwendunssituation vermittelt werden à was kann ich damit machen?
- Art + Qualität von Wissen entscheidend
Zentrale Zielsstellung des thüringer LP
= fachübergreifend
Ausbildung von Lernkompetenzen (nach thür. LP)
(1)Sachkompetenz:
- sprachlich-kommunikat. Fähigk. Und Fertigk.
- Ästhetisch-lit. Fähigk. Und Fertigk.
(2)Methodenkompetenz:
- grundlegende method. Fä. U. Fe.
- Infobeschaffung, -erfassung, -speicherung
- Infoverarbeitung, - aufbereitung, -weitergabe
(3)Sozialkompetenz:
- Interaktive, sozial-kommunikat. Fä. U. Fe.
(4)Selbstkompetenz:
- Emotional-affektive, selbstreflexive, selbstgesteuerte Fä. u. Fe.
Lernzielformulierung:
Bestehend aus Inhaltsteil und Verhaltensteil
Bsp: Die Schüler lernen den Autor XY (=Inhaltsteil) kennen (=Verh.teil)
1.4. Bildungsstandarts vs. Th.LP
Standarts:
- durchschnittl. Schüler sollte sie erreichen können
- Ziel: Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse
- Sind fachspezifisch
- Gelten für mittleren Schulabschluss
- Sollen Qualität des Bildungswesens sichern
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.5. Methodische Entscheidungsbereiche
(1) Handlungsformen
= Arbeitsformen
- Alle Lehr – und Lerntätigkeiten
- regeln Handlungsstruktur des Unterrichts
- Bsp.: Lehrervortrag, Gruppenarbeit
(2) Sozialformen
- regeln Beziehungsstruktur des U.
- Bsp.: Frontalunterricht, Gruppenarbeit, Parterarbeit, Team-Teaching, Stillarbeit
(3) Medien
- Allgemein gemeint
- Entscheidungskriterium = Abwechslung
(4) Differenzierung
- Unterschiedliche Schüler (Leistungen, Interessen...)
- àdarauf eingehen: unterschiedliche Aufgaben+Bücher etc.
(5) Erfolgskontrolle
- In Bezug auf S+L (Nachbereitung der Stunde)
(6) Verlaufsform
- Gliederung der Stunde
(7) Großform
- Struktur des Lernprozesses (in Projekt, Unterrichtsreihe, Einzelstunde zu einem Themenkomplex, Lektionen, usw.)
Induktive U.-Gestaltung oder Deduktive U.-Gestaltung
=von Bsp. auf Regeln schließen =erst Regeln und dann Bsp.
2. Lesekompetenz
2.1.Lesekompetenz nach Pisa
= Fähigkeit, geschriebene Texte untersch. Art
- in ihren Aussagen
- ihren Absichten
- und ihrer formalen Struktur
zu verstehen und in einen größeren sinnstiftenden Zusammenhang einzuordnen,
sowie in der Lage zu sein, Texte für verschiedene Zwecke sachgerecht zu nutzen.
àgeschriebene Texte
verstehen; nutzen; über sie reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen; Wissen und Potenzial weiterentwickeln; Teilnahme am gesell. Leben
= funktionale Sicht
Komponenten
(1) Texte
- Versch. Arten von Texten
- Klassifikation von Typen, Strukturen
(2) Leseaufgaben
Versch. Arten:
- Infos heraussuchen
- Interpretation entwickeln
- Inhalt und Form reflektieren
(3) Situationen
- Texte lesen, die für versch. Situationen geschrieben wurden
- à Diagramme und Tabellen gelten als Texte
- à notwendig für akt. Teiln. am gesell. Leben
- mentale Operationen werden in den Blick genommen
SUBSKALEN
I) Infos ermitteln
II) textbezogenes Interpretieren
-allg. Verständnis des Textes entw.
-textbezogene Interpr.
III) reflektieren und bewerten
über Inhalt und Form des Textes reflektieren
[...]