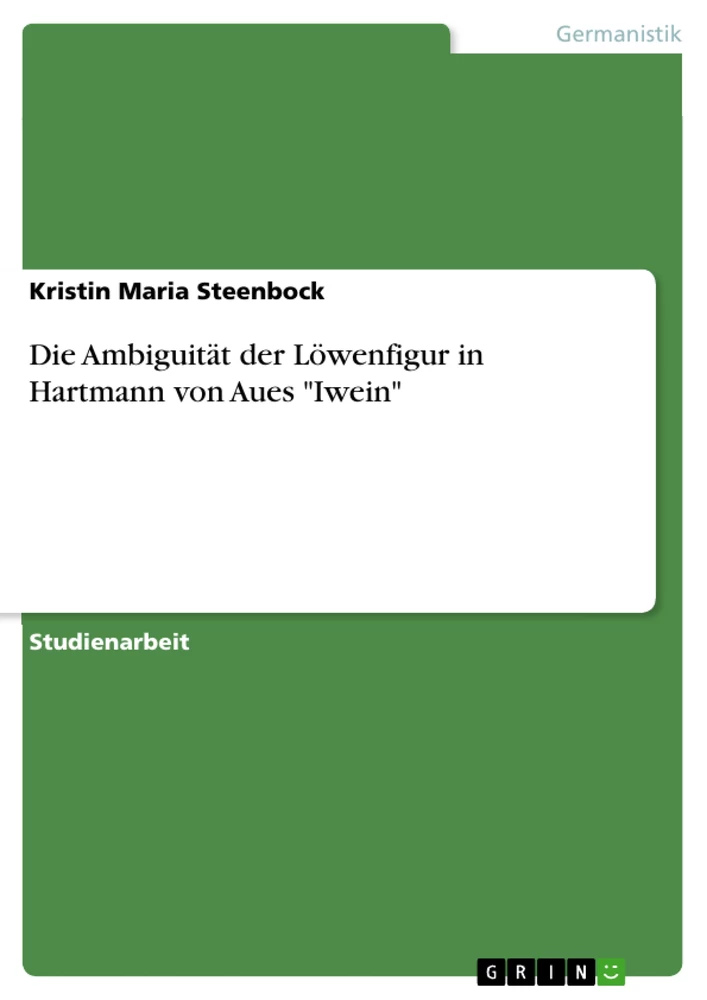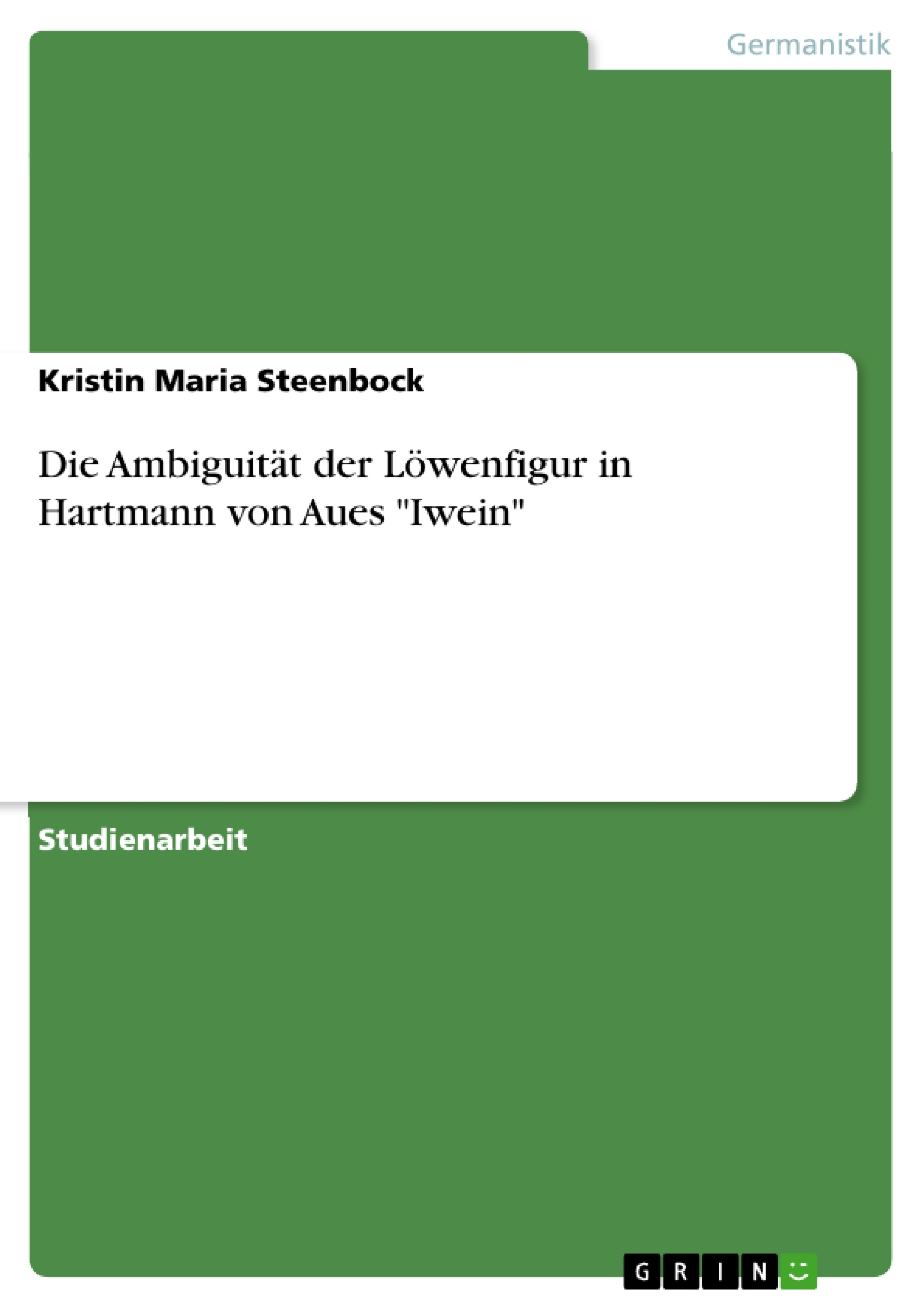Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Proleptischer Befund - Das Wilde im ersten Handlungsteil
2.1. Einführung der Löwenfigur - Der Löwen-Drachen-Kampf
2.2. Die Tradition des Löwensymbols
3. Fundierung der Beziehung - Der Sturz ins Schwert
4. Resozialisation Iweins - »Der Ritter mit dem Löwen«
5. Schluss
Bibliographie
Ende der Leseprobe aus 17 Seiten
- nach oben