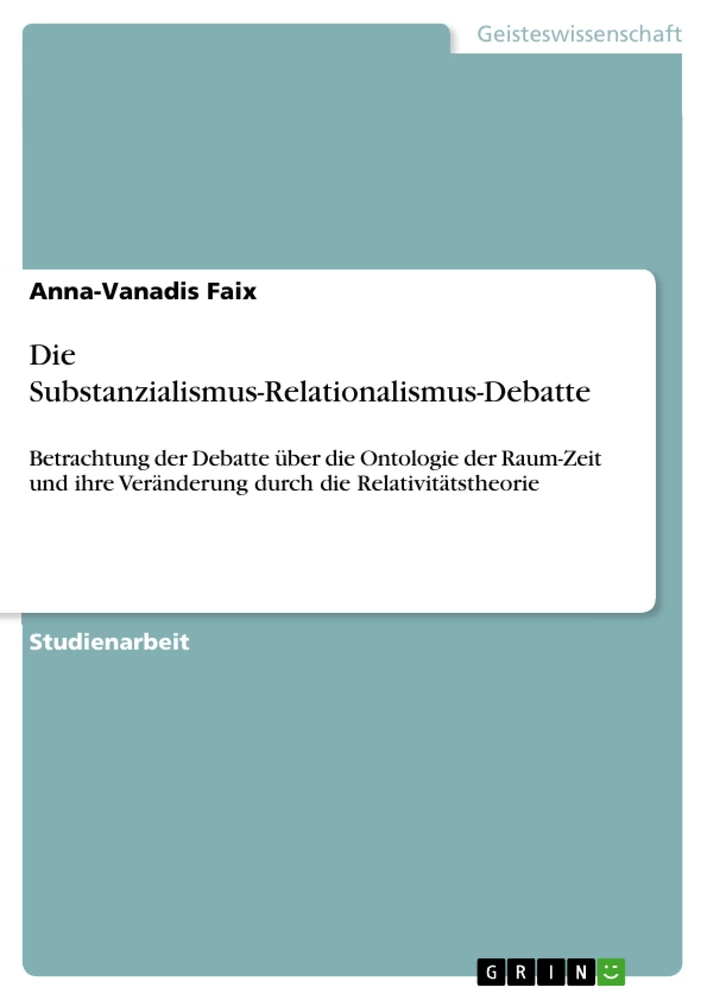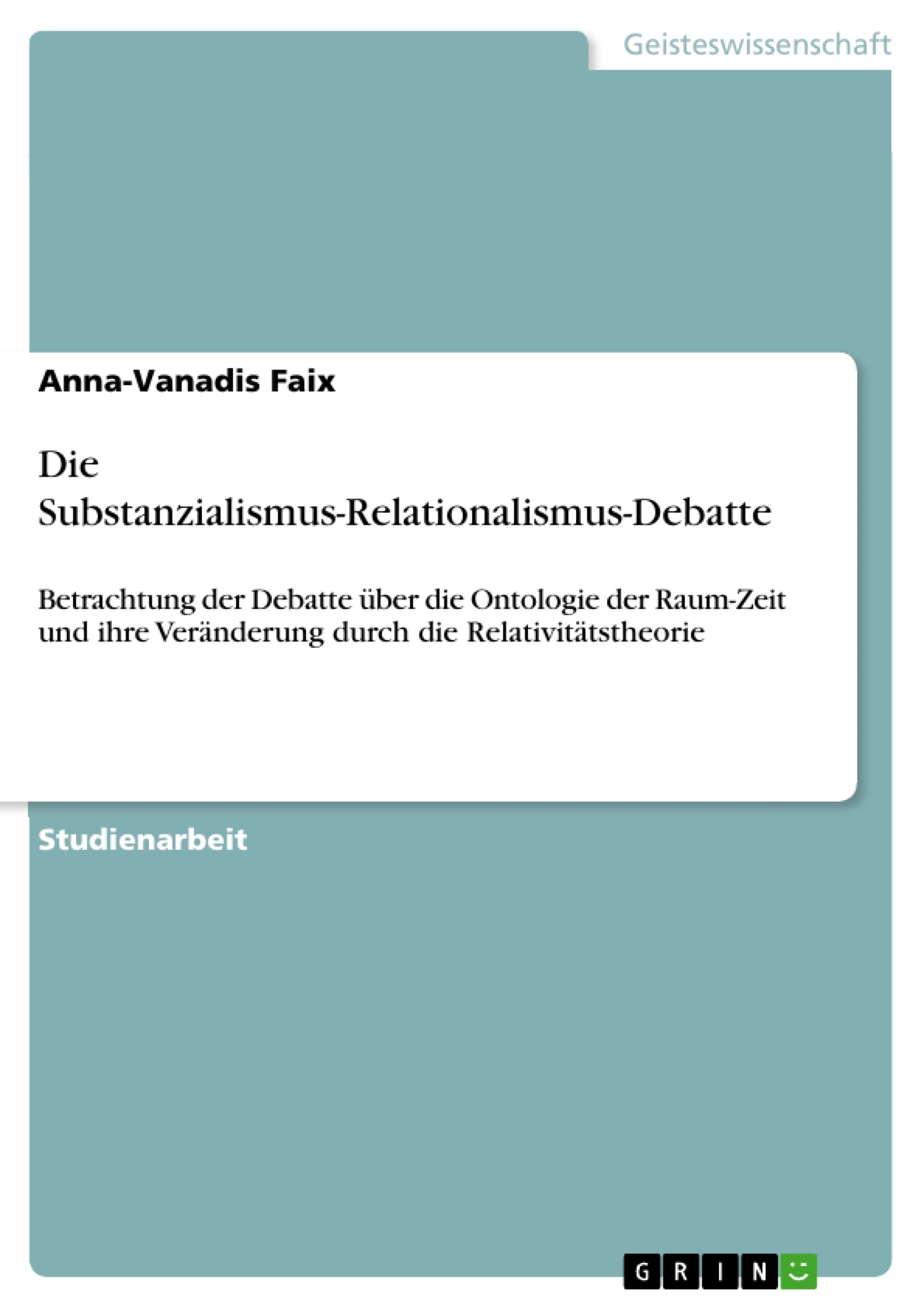Dass Albert Einstein die Physik tiefgehend revolutionierte, ist heute allgemein bekannt. Die vorliegende Arbeit greift an dieser Stelle jedoch die Frage auf, in wie weit Albert Einstein mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie (ART) Einfluss auf die Ontologie der Raum-Zeit und der damit verbundenen, vorhergehenden Relationalismus-Substanzialismus-Debatte hatte. In dieser verfocht vor allem Isaac Newton einen absoluten Raum und Leibniz hingegen interpretierte den Raum als relational. Dabei war „[d]ie frühe Rezeption der ART […] von der Idee geprägt, diese enthalte eine allgemeine Relativierung von Bewegung […].“ Jedoch wird nach einer ausgiebigeren Betrachtung der Aspekte der allgemeinen Relativitätstheorie deutlich, „[...]dass die ART keine umfassende Relativierung von Bewegung stützt, sondern wichtige Züge von Newtons absoluter Position beinhaltet.“ In wie weit dies der Fall ist und wie sich die Relationalismus-Subtanzialismus-Debatte durch die allgemeine Relativitätstheorie verändert hat, steht als zentrale Frage im Mittelpunkt dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
I.) Einleitung
II.) Substanzialismus und Relationalismus in der klassischen Physik
II.1.) Newtons absolute Interpretation
II.2.) Leibniz relationale Interpretation
II.3.) Die Leibniz-Clarke-Kontroverse
III.) Einsteins Relativitätstheorie – Revolutionierung der Physik
III.1.) Die spezielle Relativitätstheorie
III.2.) Die Allgemeine Relativitätstheorie
IV.) Die allgemeine Relativitätstheorie und die moderne Substanzialismus-Relaismus-Debatte
IV.1.) Die relationalen Aspekte der allgemeinen Relativitätstheorie
IV.2.) Die absoluten Aspekte der allgemeinen Relativitätstheorie
IV.3.) Die moderne Subtanzialismus-Relationalismus-Debatte – Ein grober Überblick
V.) Die Relativitätstheorie zwischen Leibniz und Newton
Literaturverzeichnis