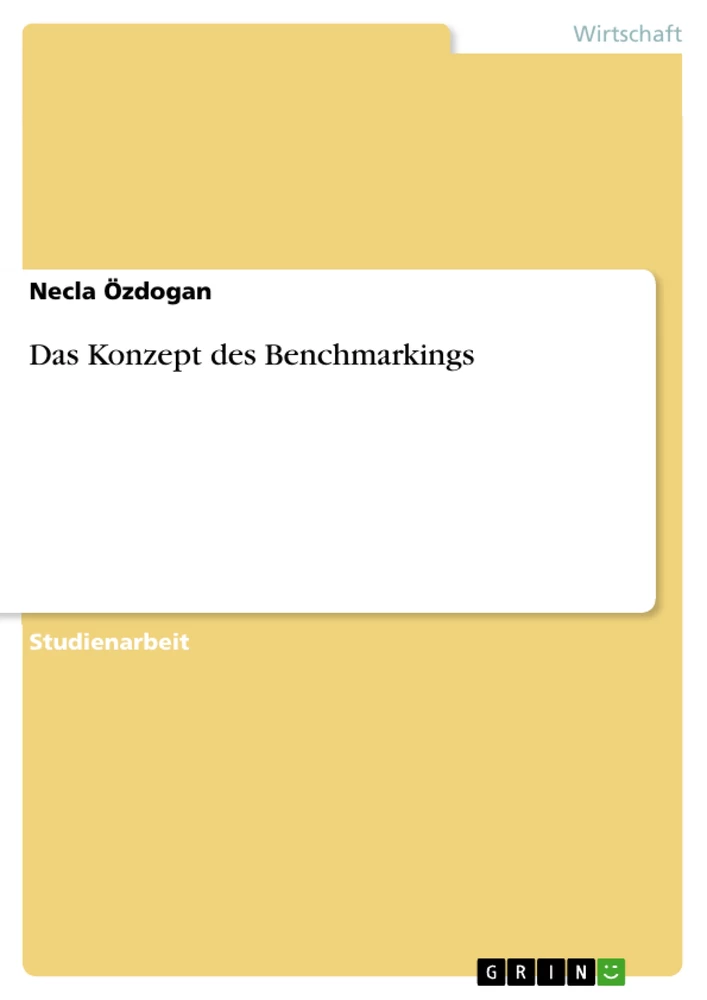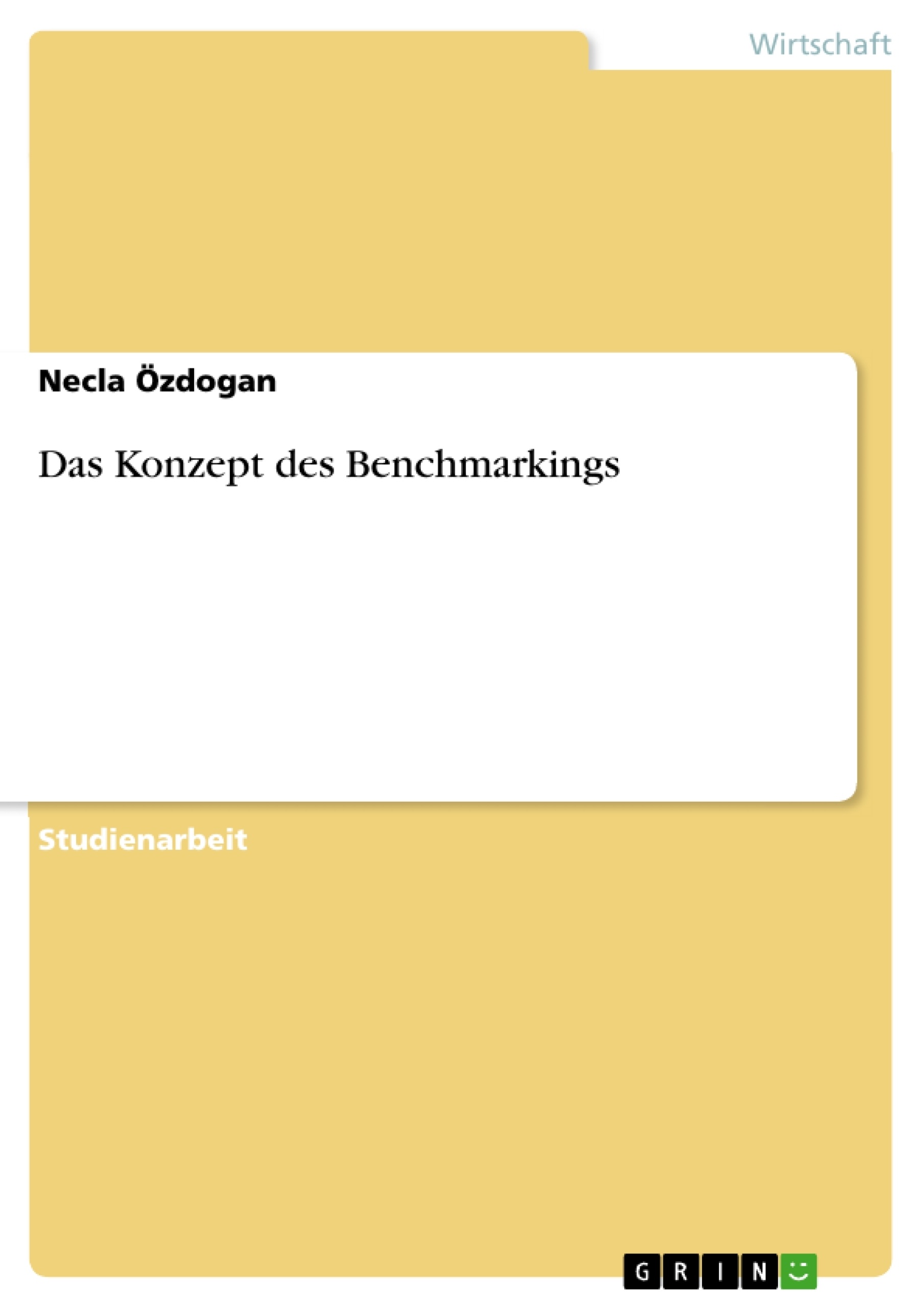Durch den Vergleich mit anderen ist es möglich, seine eigenen Potenziale zu erkennen und diese nutzbar zu machen. Um dieses Ziel zu erreichen, nimmt das Benchmarking unter den bedeutenden Managementinstrumenten einen sehr hohen Stellenwert ein. Der Schwerpunkt des Benchmarkings liegt darin, die Best Practices zu identifizieren, um dadurch nachhaltig Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Denn Benchmarking ist ein geeignetes Instrument für eine strategische Leistungsverbesserung im Unternehmen. Als wiederholter Prozess des Vergleichens mit den Besten und des Lernens von ihnen dient er dem Aufbau von Spitzenleistungen.
INHALTSVERZEICHNIS
1. Einleitung
2. Grundlagen und Funktionen von Benchmarking
2.1. Definition und begriffliche Abgrenzung
2.2. Historische Entwicklung
2.3. Ziele und Funktionen von Benchmarking
3. Arten des Benchmarkings
3.1. Internes Benchmarking
3.2. Externes Benchmarking
3.3. Produkt-Benchmarking
3.4. Prozess-Benchmarking
3.5. Strategisches-Benchmarking
3.6. Performance- Benchmarking
4. Der Benchmarking-Prozess nach Robert C. Camp
5. Erfolgsfaktoren und Nutzen des Benchmarkings
6. Zusammenfassung und Fazit
LITERATURVERZEICHNIS