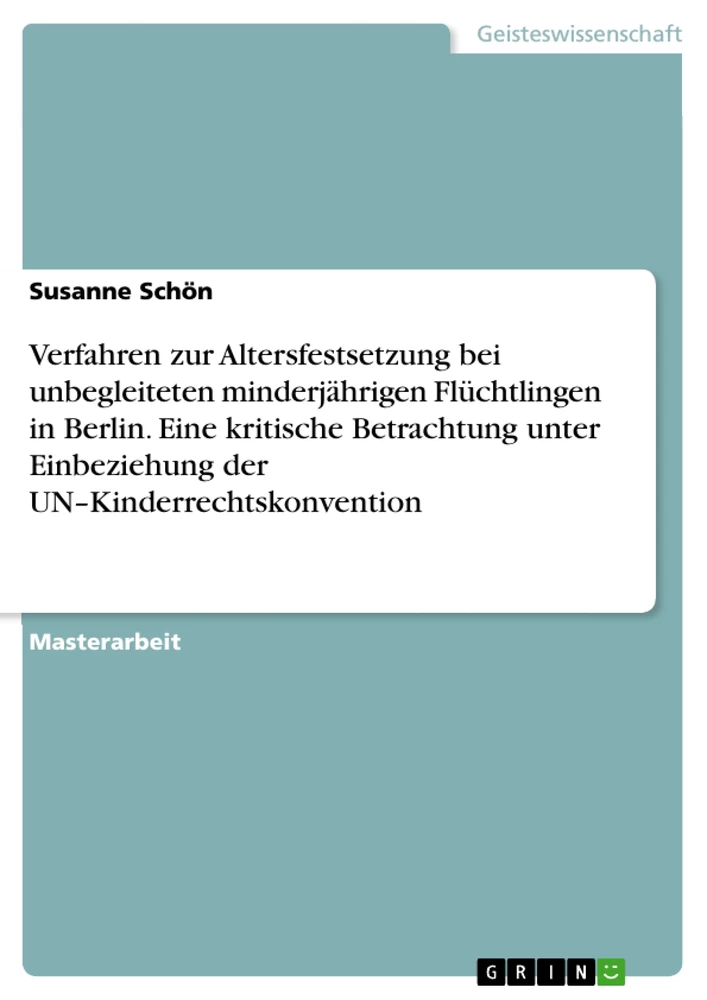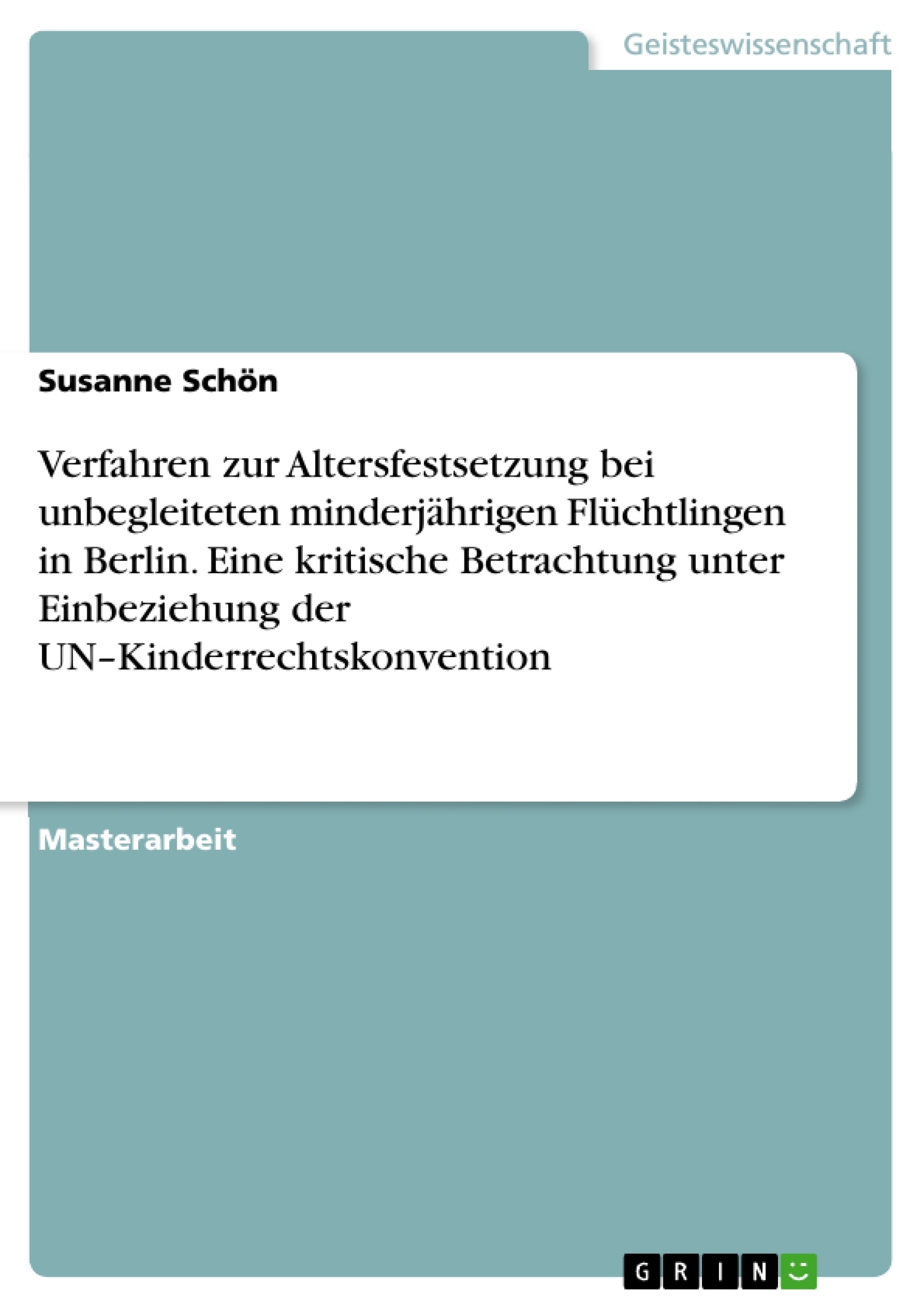Viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge reisen auf Grund ihrer Flucht ohne Visum und Dokumente zu ihrer Identität in Deutschland ein. Von den zuständigen deutschen Behörden werden den Altersangaben der Flüchtlinge in den meisten Fällen keinen Glauben geschenkt. Um das weitere aufenthaltsrechtliche und asylverfahrenstechnische Vorgehen in Deutschland abzuklären, ist es wichtig, das Lebensalter der Flüchtlinge zu bestimmen.
Die Verfahren und Vorgehensweisen zur Altersfestsetzung bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Deutschland werden vielfach kritisiert. In der Fachwelt wird diskutiert, ob grundlegende Kinder- und Menschenrechte mit deren Durchführung verletzt und missachtet werden. Die Sprache ist von fragwürdigen und unzulässigen Methoden zur Altersbestimmung sowie einer erniedrigenden Behandlung der Flüchtlinge. Häufig praktizierte Verfahren sind eine Inaugenscheinnahme und Befragung der Flüchtlinge, ein Handwurzeltest oder Röntgenuntersuchungen des Schlüsselbeins. Eine weitere Methode der deutschen Behörden ist, den jungen Flüchtlingen ein fiktives Geburtsdatum zu zuschreiben.
Die vorliegende Masterarbeit untersucht mit Hilfe von leitfadengestützten Expert_inneninterviews das Berliner Verfahren zur Altersfestsetzung. Hierbei wird die Stellung der UN-Kinderrechtskonvention analysiert und die Einhaltung derer Vorgaben überprüft. Abschließend werden Optimierungsvorschläge zur Praxis der Verfahren, orientiert an den Aussagen der befragten Expert_innen, dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einführung
1.1. Thematik und persönliche Motivation
1.2 Ziel des Forschungsvorhabens und Forschungsfrage
1.3 Methodisches Vorgehen
1.4 Aufbau der Masterarbeit
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Definition unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
2.2 Altersfestsetzung bei UMFs in Deutschland
2.2.1 Die Bedeutung des § 12 AsylVfG bei der Altersfestsetzung in Deutschland
2.3 Rechtliche Vorgaben zur Altersfestsetzung bei UMFs
2.3.1 In Deutschland
2.3.2 In Berlin
2.4 UN-KRK: Vorgaben und Forderungen für den Umgang mit UMFs zur Altersfestsetzung
2.4.1 Rücknahme der Vorbehalte zur UN-KRK und Forderungen
2.4.2 Vorgaben der UN-KRK für den Umgang mit UMFs zur Altersfestsetzung
2.4.3 General Comment Nr. 6
3. Methodologie und methodisches Vorgehen
3.1 Forschungs- und Auswertungsmethode
3.1.1 Forschungsmethode - Das Expert_inneninterview
3.1.2 Begründung der Methodenwahl
3.1.3 Inhaltsanalytische Auswertung nach Meuser und Nagel
3.2 Methodisches Vorgehen
3.2.1 Feldzugang
3.2.2 Aufbau und Strukturierung des Interviewleitfadens
3.2.3 Durchführung der Interviews
4. , Verfahren und Abläufe von Altersfestsetzung bei UMFs in Berlin
4.1 Notwendigkeit und Verfahren zur Altersfestsetzung bei UMFs in Berlin
4.1.1 Inobhutnahme
4.1.2 Einrichtung einer Vormundschaft
4.1.3 Rechtsmittel gegen die Entscheidung der SenBildJugWiss
4.1.4 Nachgeordnete Altersfestsetzung
4.2 Abläufe der Verfahren zur Altersfestsetzung bei UMFs in Berlin
4.2.1 Aufnahmegespräch der SenBildJugWiss
4.2.2 Medizinisches Verfahren - forensische Altersdiagnostik
4.2.2.1 Körperliche Untersuchung
4.2.2.2 Zahnärztliche Untersuchung
4.2.2.3 Röntgenuntersuchung der Hand
4.2.2.4 Radiologische Untersuchung des Schlüsselbeins
4.2.2.5 Ergebnisse und Auswertung der forensischen Altersdiagnostik
5. Darstellung der empirischen Befunde
5.1 Gesetzliche Grundlagen zur Altersfestsetzung bei UMFs
5.2 § 12 AsylVfG: Handlungsfähigkeit ab 16 Jahren
5.3 Kritik an den Verfahren zur Altersfestsetzung in Berlin
5.3.1 Aufnahmegespräch der SenBildJugWiss
5.3.2 Medizinisches Verfahren - forensische Altersdiagnostik
5.3.3 Einrichtung einer Vormundschaft
5.4 Positives an den Verfahren zur Altersfestsetzung in Berlin
5.5 Die Rolle der UN-KRK
5.6 Optimierungsvorschläge zu den Verfahren und Abläufen (orientiert an den Vorgaben der UN-KRK)
5.6.1 Nicht-Regierungsorganisation
5.6.2 Berliner Jugendamt
5.6.3 Amt zuständig für Vormundschaften
5.6.4 SenBildJugWiss
6. Diskussion und Beantwortung der Forschungsfrage
6.1 Altersfestsetzung bei UMFs in Berlin im Spannungsfeld zwischen nationaler Gesetzgebung und der UN-KRK
6.1.1 Nationale Gesetzgebung
6.1.2 § 12 AsylVfG - Anwendung in Berlin
6.2 Verfahren der Altersfestsetzung bei UMFs in Berlin - Beachtung oder Missachtung der UN-KRK?
6.2.1 Aufnahmegespräche der SenBildJugWiss
6.2.2 Medizinisches Verfahren - forensische Altersdiagnostik
6.3 Potenzielle Handlungsalternativen und ihre Konformität mit der UN-KRK?
7. Resümee und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einführung
1.1. Thematik und persönliche Motivation
Mit der Ratifizierung der UN-Kinderechtskonvention (UN-KRK) am 05.04.1992 hat sich Deutschland gemäß Art. 22 UN-KRK verpflichtet, allen Kindern und Jugendlichen, die Asyl in Deutschland suchen, angemessene Hilfe und Schutz zu gewähren. Dazu sollen geeignete Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden, die den Rechten der Kinder gemäß dem Abkommen entsprechen. Allerdings gab die Bundesregierung zeitgleich eine Vorbehaltserklärung ab. In der Erklärung hielt die Regierung dezidiert fest, dass die dort aufgeführten Verpflichtungen dem deutschen Ausländer- und Asylrecht für die Gruppe der Flüchtlingskinder unterzuordnen sind. Für Gegner_innen der Asylrechtspolitik bedeutete diese Erklärung, das Wohl von Flüchtlingskindern nicht vorrangig zu berücksichtigen und sie damit in ihren grundlegenden Rechten zu beschneiden. Als am 03.05.2010 das Bundeskabinett beschloss, die Vorbehalte zur UN-KRK zurückzunehmen, erhofften sich u.a. Flüchtlings-, Menschenrechts- und Kinderrechtsorganisationen, eine Verbesserung der Situation von Flüchtlings- kindern. Allerdings sind bis heute viele Forderungen immer noch nicht umgesetzt (vgl. Kauffmann/Riedelsheimer 2010, S. 8 f.).
Bereits die Regelung nach § 12 Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), dass Flüchtlinge ab Vollendung des 16. Lebensjahr als asylmündig gelten und somit wie Erwachsene im Asylbewerberverfahren behandelt werden, stellt in der deutschen Gesetzgebung eine Sonderregelung dar. Sie zeigt u.a. auf, was für eine entscheidende Rolle das Alter und somit auch die Altersfestsetzung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF)1 hat (vgl. Heinhold 2010, S. 65).
Ein weiteres Hindernis für die jungen Flüchtlinge in Deutschland ist, dass ihnen in vielen Fällen falsche Altersangaben unterstellt werden. Des Weiteren werden vorliegende Dokumente von den deutschen Behörden zumeist nicht akzeptiert, da Fälschungen vermutet werden, um gewisse Vorteile im Asylbewerber- verfahren zu erhalten (vgl. Apitzsch 2010, S. 85). Vorteile sind beispielsweise einen Vormund an die Seite zu bekommen oder die Durchführung eines Clearingverfahrens2 (vgl. Riedelsheimer 2010, S. 72).
Ebenso stellen sich die derzeitig praktizierten Verfahren zur Altersbestimmung als problematisch dar und stoßen u.a. bei vielen Verbänden und Organisationen, die sich für Flüchtlinge einsetzen, auf große Kritik. Als besonders schwierig wird zurzeit, die unklare und föderalistisch geprägte Vorgehensweise in den einzelnen Bundesländern gesehen. Besonders in Berlin und Hamburg wird eine fiktive Zuschreibung eines Geburtsdatums angewendet. Dies kann folglich Auswirkungen auf eine altersgerechte Unterstützung für die Jugendlichen haben. Ferner wird häufig das Lebensalter durch eine Inaugen- scheinnahme und einer Befragung der Flüchtlinge von Mitarbeiter_innen unterschiedlicher Behörden festgelegt. Dabei ist oftmals die Qualifizierung der Mitarbeiter_innen für eine Altersbestimmung unklar bzw. ungeeignet. Die Inaugenscheinnahme wird von den Jugendlichen oft als staatliche Willkür wahrgenommen und sie fühlen sich einem hierarchischen Verhältnis unterworfen (vgl. Riedelsheimer 2010, S. 72 f.). Ein Fallbeispiel eines UMFs aus Bremen verdeutlicht die willkürliche Vorgehensweise zur Altersbestimmung:
„ Der Jugendliche stellt sich Anfang April 2008 beim Jugendamt der Freien Hansestadt Bremen mit der Bitte um Hilfe vor. In einem Schreiben des dortigen Sachbearbeiters an die Aufnahmeeinrichtung Dortmund heißt es, er sei zusammen mit einer Sozialpädagogin dort beurteilt worden. Das Ergebnis sei, dass kein erzieherischer Bedarf vorhanden sei und damit eine Verfahrensfähigkeit bestehe. Das Alter betrage mindestens 16 Jahre, die Altersangabe des Asylsuchenden sei nicht zu akzeptieren gewesen. In einem Betreff dieses Telefaxes heißt es zur Altersangabe: „ 31.12.88 (fiktiv) “ . Auch in die Bescheinigungüber die Meldung als Asylsuchender wird dieses fiktive Geburtsdatum eingetragen, obwohl der Jugendliche selbst erklärt hatte, Ende März 1993 geboren zu sein “ (Heiber 2010, S. 138).
Die Vorgehensweise des Verfahrens wird von Seiten der Kritiker_innen als sehr problematisch dargestellt, da körperliche Reifemerkmale und das soziale Verhalten der Betroffenen nur wenig Berücksichtigung findet bzw. dazu Vergleiche herangezogen werden, die am Reifegrad mitteleuropäischer Jugendlicher gemessen werden. Dabei werden die zum Teil unterschiedlichen Sozialisationsfaktoren und damit mögliche Divergenzen in den Entwicklungsphasen außer Acht gelassen (vgl. Peter 2003, S. 43).
Weitere Verfahren zur Altersbestimmung sind medizinische Untersuchungen. Dabei sind besonders körperliche Untersuchungen für die Flüchtlinge oftmals ein unangenehmer Eingriff. Gerade in der Pubertät kann ein erhöhtes Schamgefühl, Unwohlsein hervorrufen. Zudem werden die Flüchtlinge nicht genügend über die Eingriffe informiert, da oftmals keine Dolmetscher_innen zur Verfügung gestellt werden. Ferner sind die Erlebnisse in der Vergangenheit zu beachten, die nicht selten mit gewalttätigen Übergriffen oder sexuellem Missbrauch in Verbindung stehen. Die medizinischen Untersuchungen können somit die Betroffenen an vergangene Leiden erinnern und sie noch mehr verunsichern und einschüchtern (vgl. Riedelsheimer 2010, S. 73). Das bereits angeführte Fallbeispiel des Jugendlichen veranschaulicht weiterhin die fragwürdige Vorgehensweise der medizinischen Verfahren zur Alters- bestimmung und den bedenklichen Umgang mit den Betroffenen:
„ Der Jugendliche versichert [ … ], mit keiner der Untersuchungen sei er einverstanden gewesen, im Gegenteil, er habe protestiert. Ihm sei jedoch erklärt worden, er werde Probleme bekommen, wenn er die Unter- suchungen nicht akzeptiere. Die ganze Prozedur habe 2-3 Stunden gedauert, er habe sehr gelitten, auch viel geweint. In dem Gutachten [ … ] wird ausgeführt, der Jugendliche sei mindestens 21 Jahre alt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wird daraufhin gebeten, ein neues fiktives Geburtsdatum festzusetzen. Auch wird antragsgem äß die Vormundschaft wieder aufgehoben. Kurz darauf, noch vor seinem 17. Geburtstag muss er die Jugendhilfeeinrichtung verlassen und wird in das Flüchtlingsheim für Erwachsene in Kaarst gewiesen “ (Heiber 2010, S. 139).
Häufig durchgeführte Untersuchungen im medizinischen Verfahren sind der Handwurzeltest oder Röntgenuntersuchungen des Schlüsselbeins. Besonders kritisch an den medizinischen Methoden wird der Verstoß gegen Menschenund Kinderrechte gesehen, da sie mitunter gesundheitsschädlich für den Betroffenen sein können. Es ist anzumerken, dass der Bundesgerichtshof bereits in einer Grundsatzentscheidung vom 03.12.1997, Az2StR 397/97, urteilte, dass unnötiges Röntgen strafbar ist.
„ Diese strafrechtliche Dimension des Themas schreckt jedoch weder die Behörden von ihrem Tun ab, welche die rechtsmedizinischen Gutachten in Auftrag geben, noch die beteiligtenärzte. Man meint offensichtlich, aufgrund der Ausganglage, nämlich der ungerechtfertigten illegalen Einreise der Flüchtlingskinder, zu einer solchen Handlungsweise ihnen gegenüber befugt zu sein. Dabei ist man sich der Tatsache bewusst, dass die Flüchtlingskinder sich in der Regel nicht gegen die behördlich angeordneten erniedrigenden Behandlungen wehren “ (Heiber 2010, S. 130).
Ebenso wird an den medizinischen Untersuchungen problematisch gesehen, dass durch diese kein genaues Lebensalter festgelegt werden kann, sondern nur Alterszeitspannen genannt werden können. Die Mediziner_innen können eine Altersbestimmung mit einer Abweichung von drei bis sieben Jahren feststellen. Unter den angeführten Gesichtspunkten ist jedoch für die Flüchtlinge von zentraler Bedeutung, ihr Alter genauestens zu bestimmen (vgl. Riedelsheimer 2010, S. 73).
Von den bereits erwähnten Verbänden und Organisationen wird ein einheitliches Verfahren geltend für alle Bundesländer in Deutschland gefordert, das sich an dem Kindeswohl orientiert. Die zentrale Forderung hierbei ist, Eindeutigkeit in den Zuständigkeiten sowie den angewandten Methoden herzustellen (vgl. Riedelsheimer 2010, S. 86). Ein Vorschlag in diese Richtung ist ein Verfahren, das sich an rechtsstaatlichen Kriterien orientiert und nicht einer Willkürmaßnahme gleicht. Außerdem werden eine persönliche Anhörung mit einem/r Dolmetscher_in sowie ein/e Verfahrenspfleger_in für die UMFs gefordert (ebd., S. 74).
Durch die Teilnahme an einem Seminar zur Thematik „ Menschenrechte - Kinderrechte “ bei Frau Prof. Dr. Kerber-Ganse an der Alice-Salomon- Hochschule Berlin bin ich auf die angeführten fragwürdigen Umstände der Altersfestsetzung bei UMFs in Deutschland sowie auf die dazu bestehenden Forderungen der UN-KRK aufmerksam geworden. Persönlich hat mich diese vielschichtige und kontroverse Problemstellung einerseits betroffen gemacht und andererseits wurde mein sozialwissenschaftliches Interesse geweckt. Infolgedessen habe ich den Rahmen meiner Masterthesis genutzt, um mich tiefgründiger mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.
1.2 Ziel des Forschungsvorhabens und Forschungsfrage
Immer wiederkehrend ist in den Medien zu entnehmen, dass es in vielen Gebieten der Welt zu Krisen, Konflikten, Bürgerkriegen und Katastrophen kommt, die Menschen zwingen, ihr Herkunftsland zu verlassen. Darunter fallen immer mehr Kinder und Jugendliche, die von ihren Familien getrennt werden. In Deutschland erhoffen sich viele von ihnen einen sicheren Zufluchtsort und eine bessere Zukunftsperspektive. Diese Hoffnungen werden jedoch oftmals enttäuscht und durch ein restriktives und bürokratisches deutsches bzw. europäisches Asylbewerberverfahren ins Gegenteil gekehrt (vgl. Heiber 2010, S 127).
In der vorliegenden Arbeit möchte ich mein Augenmerk auf die angewandten Verfahren und Methoden der Altersfestsetzung bei UMFs im Bundesland Berlin3 legen. Deutschlands Handlungsweise in der Altersbestimmung wird national und international seit Jahren stark kritisiert, da sie mehrere Rechte der Kinder, die ihnen aufgrund der UN-KRK zustehen, verletzen (vgl. Kauffmann 2010, S. 43). Nicht nur der Art. 22 UN-KRK macht auf den besonderen Schutz von Flüchtlingskindern aufmerksam. Ebenso der General Comment Nr. 64 beschäftigt sich mit der „ Behandlung unbegleiteter und von ihren Eltern getrennter Kinder außerhalb ihres Herkunftslandes “. Dieser umfasst u.a.
Handlungsempfehlungen, Forderungen und Kommentare zu einer umfassenden Feststellung der Identität des Kindes, worunter auch die Bestimmung des Alters fällt. Ergänzend macht die National Coalition5 (NC) darauf aufmerksam, dass trotz der großen Bedeutung der Altersfestsetzung für jeden Einzelnen, die Mindeststandards für Altersfestsetzungen, wie sie im General Comment Nr. 6 ausgeführt sind, in Deutschland nicht eingehalten werden (vgl. National Coalition 2010, S. 35).
Ziel der Masterarbeit ist es, mit Hilfe der Interviewdaten, Aussagen über die aktuelle Vorgehensweise zur Altersfestsetzung bei UMFs im Bundesland Berlin treffen zu können. Anschließend soll überprüft werden, ob das Vorgehen die geforderten Standards erfüllt. Daraus ergibt sich für den Forschungsprozess folgende Fragestellung:
Entspricht das Verfahren zur Altersfestsetzung in Berlin den Vorgaben der UN-KRK?
Dabei sollen die erhobenen Daten einen Überblick über folgende Teildimensionen der Problematik geben:
1. Abläufe und Vorgehensweisen zur Altersbestimmung in Berlin und daran anschließende Kritikpunkte bzw. Verbesserungsvorschläge der befragten Expert_innen
2. die nationale und internationale Gesetzgebung zur Durchführung einer Altersbestimmung bei UMFs
3. eine Hinterfragung der Verfahren und Methoden im Hinblick auf die Forderungen der UN-KRK
4. Vorschläge zu Handlungsalternativen für die gängige Praxis in Berlin
1.3 Methodisches Vorgehen
Die Beantwortung der Forschungsfrage wurde mit Hilfe einer empirischen Untersuchung vorgenommen. Diesbezüglich wurde die qualitative Forschungsmethode des leitfadengestützten Expert_inneninterviews angewandt. Anschließend wurden die erhobenen Daten mit der inhaltsanalytischen Methode nach Meuser und Nagel ausgewertet.
Als erster Schritt bei der Erschließung des Forschungsfeldes erfolgte eine Literaturrecherche, die theoretisches Hintergrundwissen zum Forschungs- gegenstand lieferte. Es ist festzuhalten, dass die Thematik der Alters- festsetzung bei UMFs in der Literatur unzureichend diskutiert und erforscht ist. Eine Forschung zu diesem Thema des Bundesfachverbandes Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V. (B-UMF e.V.) in Berlin befindet sich noch in der Phase der Auswertung, sodass diese für das Forschungsfeld relevanten Ergebnisse noch nicht in dieser Masterarbeit einfließen konnten. Materialen von Nicht-Regierungsorganisation (NRO), in denen Forderungen zur Verbesserung der Verfahren und Abläufe zur Altersfestsetzung bei UMFs formuliert werden, sind jedoch vorhanden.
Auf der Basis der durchgeführten Literaturstudien wurde der Interviewleitfaden konstruiert, mit dessen Hilfe die Interviews durchgeführt wurden. Anschließend wurde das Material transkribiert. Nach der inhaltsanalytischen Auswertung der erhobenen Daten, wurden diese aufbereitet und als Ergebnisse dargestellt. Anschließend wurden die empirischen Befunde einer kritischen Betrachtung unterzogen. Unter Einbeziehung der empirischen Befunde sowie der theore- tischen Literaturbezüge erfolgte eine Ergebnisdiskussion. Diese wurde im abschließenden Teil zur Beantwortung der Forschungsfrage herangezogen.
1.4 Aufbau der Masterarbeit
Nach der Einführung in die Masterarbeit werden im 2. Kapitel theoretische Grundlagen dargelegt, die der/dem Leser_in eine Einführung in die Thematik gibt. Dabei wird eine Definition des Begriffes des unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings vorgenommen. Des Weiteren wird ein allgemeiner Überblick über die Altersfestsetzung bei UMFs in Deutschland gegeben. Hierbei werden vorliegende Schwierigkeiten bzgl. der Altersfestsetzung reflektiert sowie angewandte Verfahren und Methoden genannt. Weiterhin wird in diesem Kapitel die Bedeutung des § 12 AsylVfG herausgearbeitet und gesetzliche Grundlagen für die Altersfestsetzung in Deutschland sowie speziell für das Bundesland Berlin angeführt. Abschließend wird Bezug auf die UN-KRK genommen und eruiert, welche Vorgaben und Forderungen bezüglich der Altersfestsetzung gestellt werden. Diesbezüglich wird der General Comment Nr. 6 herangezogen.
Das 3. Kapitel stellt den methodischen Teil dar. Es werden die Forschungs- und Auswertungsmethode erläutert und die Wahl dieser begründet. Im nächsten Schritt wird das Verfahren vom Feldzugang, über den Aufbau des Leitfadens, bis hin zur tatsächlichen Datenerhebung beschrieben.
Im folgenden Kapitel werden die Verfahren und angewandte Methoden zur Altersfestsetzung in Berlin dargelegt und erläutert. Die Darstellung basiert auf den Aussagen der Interviewpartner_innen, da keine vertiefende Literatur zu diesem Bereich existiert. Hierbei werden die Notwendigkeit bzw. Erfordernis der Altersfestsetzung in Berlin verdeutlicht, sowie die Methoden des Aufnahme- gesprächs und der forensischen Altersdiagnostik dargestellt. Im Anschluss erfolgt im 5. Kapitel die ausführliche Darstellung der empirischen Befunde.
Im 6. Kapitel der Arbeit werden die erhobenen Daten, im Hinblick auf die Forschungsfrage diskutiert und einer kritischen Betrachtung in Bezugnahme auf die Vorgaben der UN-KRK unterzogen. Im abschließenden Kapitel erfolgt eine Zusammenfassung der gesamten Schlussfolgerungen und die Beantwortung der Forschungsfrage „ Entspricht das Verfahren zur Altersfestsetzung bei UMFs in Berlin den Vorgaben der UN-KRK? “ wird vorgenommen. Auf der Grundlage der vorliegenden Forschungsergebnisse werden als Ausblick Handlungsempfehlungen für die Praxis formuliert.
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Definition unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
In Publikationen und Veröffentlichungen zu diesem Thema finden immer wieder unterschiedliche Begriffe wie zum Beispiel „ unbegleitete Kinder “, „ Kinder- flüchtlinge “ sowie „ unbegleitete Flüchtlingskinder “ Verwendung. Da diese Begriffe für die Problemstellung der Masterarbeit jedoch nicht die notwendige Ganzheitlichkeit ausdrücken, wird in der vorliegenden Arbeit der Begriff des „ unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings “ benutzt.
Unter der Anwendung der unterschiedlichen Begrifflichkeiten finden sich auch verschiedene Definitionen wieder. So definieren beispielweise der Europäische Flüchtlingsrat, die United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) oder die UN-KRK diese Personengruppe unterschiedlich. Die vorliegende Arbeit orientiert sich an der Definition der UN-KRK. Hierzu werden im Folgenden die Bezeichnungen „ unbegleitet “, „ minderjährig “ und „ Flüchtling “ im Einzelnen betrachtet.
Laut dem General Comment Nr. 6 (2005)6 zu der UN-KRK werden als unbegleitet, Kinder im Sinne des Artikels 1 der Konvention bezeichnet, die von beiden Elternteilen oder anderen Verwandten getrennt sind und „ nicht von einem Erwachsenen betreut werden, der von Gesetzes wegen oder gewohnheitsm äß ig für eine solche Betreuung verantwortlich ist “ (vgl. B-UMF e.V. 2005, S. 5).
Ein Kind bzw. Minderjährige_r nach Art 1 UN-KRK ist „ jeder Mensch, der das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach dem auf das Kind anzuwendende Recht nicht früher eintritt “ .
Nach Art 22 des Übereinkommens wird ein Flüchtlingskind als „ ein Kind, das die Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt oder nach Maßgabe der anzuwendenden Regeln und Verfahren des Völkerrechts oder des innerstaatlichen Rechts als Flüchtling angesehen wird [definiert] “ .
Ergänzend zu diesem Definitionsrahmen verweist Manfred Liebel (2007) in seinem Buch „ Wozu Kinderrechte “ auf die Bedeutung des subjektiven Hintergrunds der UMFs. Demzufolge spielen die Gründe der Kinder, ihr Herkunftsland zu verlassen, eine zentrale Rolle. Oft sind die Kinder auf der Suche nach einer neuen Lebensperspektive, wurden von ihren Familien aus Angst oder Sorge weggeschickt oder von Rebellen, Soldaten oder der Regierung verjagt, um nur einen kleinen Teil möglicher Hintergründe zu nennen. Zu dem ist nicht zu vergessen, welche enormen Unsicherheiten, Gefahren und Strapazen ihnen auf ihrer Flucht begegnen und was für große Hoffnungen sie auf das Ankunftsland setzen (vgl. Liebel 2007, S. 160).
2.2 Altersfestsetzung bei UMFs in Deutschland
Die meisten in Deutschland ankommenden UMFs sind größtenteils keine Kleinkinder mehr, sondern befinden sich im Alter zwischen 13 und 17 Jahren mit unterschiedlichen Entwicklungsständen (vgl. Heiber 2010, S. 127).
In der Regel führen die UMFs bei der Einreise in das Bundesgebiet Deutschland keine Ausweispapiere (oder andere Unterlagen zum Nachweis ihrer Identität) mit sich, noch besitzen sie ein Visum. Das liegt in den meisten Fällen daran, dass sich eine Flucht durch ein abruptes und unvorbereitetes Aufbrechen auszeichnet und den Flüchtlingen häufig keine Zeit mehr bleibt, sich um Geburtsurkunden oder andere Papiere zu kümmern. Zudem ist das Besorgen von Belegen durch die Situation in einigen Ländern, wie zum Beispiel in Kriegs- oder Krisengebieten, gar nicht bzw. nur schwer möglich (vgl. Riedelsheimer 2010, S. 73).
Laut Heiber (2010) schenken die zuständigen Behörden in Deutschland in den meisten Fällen den Altersangaben der Jugendlichen keinen Glauben. Es ist eher das Gegenteil der Fall, denn die Frage nach dem Alter wird mit dem Vorwurf der Lüge gegenüber den UMFs verbunden (vgl. Heiber 2010, S. 127). Ferner wird den Flüchtlingen die Pflicht auferlegt, Beweise für ihre Minderjährigkeit vorzulegen (vgl. Kauffmann 2010, S. 37). Ebenso ist zu bedenken, dass es für die Kinder und Jugendlichen eine große Belastung darstellt, sich alleine bei den deutschen Behörden vorstellen zu müssen. Noch bevor ihr Schicksal oder ihre Fluchtgründe eine Rolle spielen, müssen sie sich einer Prüfung ihres Alters unterziehen (vgl. Heiber 2010, S. 127).
Da den UMFs häufig eine Falschangabe ihres Alters unterstellt wird, ist es sinnvoll, sich mögliche Motive für Falschangaben anzuschauen. Riedelsheimer (2010) stellt dies in dem Buch „ Kinderflüchtlinge “ anschaulich dar. Dabei nennt er beispielweise als vermeintliche Vorteile für die Kinder und Jugendlichen gegenüber Erwachsenen: die Bestellung eines Vormunds, die Unterbringung in einer Jugendhilfeeinrichtung, den Besuch einer Schule oder die Durchführung eines Clearingverfahrens. Er fasst zusammen, dass die genannten Motive für erwachsene Flüchtlinge nicht erstrebenswert sind und aufenthaltsrechtliche und asylverfahrenstechnische Vorteile nicht existieren (vgl. Riedelsheimer 2010, S. 72).
Letztendlich führt das Verfahren zur Altersbestimmung in Deutschland häufig dazu, dass die Jugendlichen als entweder mindestens 18 Jahre alt registriert werden und damit volljährig sind oder sie als mindestens 16 Jahre alt geschätzt werden und damit als verfahrensfähig7 gelten und somit keinen Vormund mehr zur Seite gestellt bekommen (vgl. Heiber 2010, S. 127).
Darüber hinaus empfinden viele Verbände und Organisationen, die sich für die Rechte und Anliegen von Flüchtlingen einsetzen, die Altersfestsetzung als eine fiktive Zuschreibung oder bezeichnen sie sogar als willkürliches Verfahren. Zudem sind sie der Auffassung, dass die Altersfestsetzung einen Eingriff in die körperliche Gesundheit sowie eine erniedrigende Behandlung für die Betroffenen darstellt. In Deutschland ist die Altersfestsetzung mittels in Augenscheinnahme die meist verbreitetste Methode. Bei diesem Vorgehen wird jedoch nur selten beachtet, dass in diesem Alter eine große Schwankung in der körperlichen und psychosozialen Entwicklung vorliegen kann. Bei den bestehenden Verfahren werden zu dem außer Acht gelassen, dass Kinder aus anderen Ländern unterschiedliche Reifegrade aufweisen können und eine Fluchterfahrung Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung nehmen kann (vgl. Peter 2003, S. 42 f.).
Bei dieser Kritik wird der Mangel an einem einheitlichen und standardisierten Verfahren zur Altersfestsetzung bei UMFs in Deutschland deutlich. Deshalb folgt im nächsten Abschnitt eine kurze Zusammenfassung der bestehenden Methoden in den Bundesländern sowie den durchführenden Institutionen der Altersfestsetzung. Dabei wird insbesondere ein Blick auf das Bundesland Berlin geworfen werden.
Hierzu hat der B-UMF e.V. eine Übersicht aus der Antwort der Bundesregierung zur Aufnahme von UMFs aus dem Jahr 2009 zusammengestellt. Zusammen- fassend kann man aus diesen Daten entnehmen, dass die Altersfestsetzung in den 16 Bundesländern am häufigsten durch die zuständige Ausländerbehörde oder das Jugendamt erfolgt. In einigen Bundesländern auch durch das Gesundheitsamt oder die Clearingstelle. In Berlin ist für die Altersbestimmung zuerst die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft (SenBildJugWiss) zuständig. In weiterführenden Verfahren kann das Familiengericht, Mediziner_innen mit der Bestimmung des Lebensalters beauftragen.
In den meisten Bundesländern werden die Methoden der Inaugenscheinnahme und das Führen eines Gespräches von berufserfahrenen Mitarbeiter_innen zur Altersbestimmung angewendet. In einigen Bundesländern, wie zum Beispiel in Thüringen, Niedersachsen, aber auch Berlin, werden zusätzlich medizinische Verfahren, wie radiologische Untersuchungen und die Ermittlung des Zahnstatus, zur Bestimmung des Alters durchgeführt. In Berlin werden sowohl zahnmedizinische Untersuchungen sowie Magnetresonanztomographien (MRT) vom Schlüsselbein gemacht. Hinzu kommt eine Betrachtung der äußeren Geschlechtsmerkmale (vgl. B-UMF e.V. 2009, S 1 ff.).
2.2.1 Die Bedeutung des § 12 AsylVfG bei der Altersfestsetzung in Deutschland
Der § 12 AsylVfG legt die Handlungs- und Verfahrensfähigkeit im Asylverfahren auf das 16. Lebensjahr fest. Daran anknüpfend ist auch der § 68 Ausländergesetz (AuslG), in dem ebenfalls die Handlungsfähigkeit für das Verfahren nach dem Ausländergesetz auf das 16. Lebensjahr festgesetzt ist. Damit sollen Betroffene rechtlich bedeutsame Handlungen im Verwaltungs- verfahren selbstständig vornehmen (vgl. Peter 2003, S. 38 f.). Für 16- und 17- jährige unbegleitete Flüchtlinge heißt das, wie volljährige Asylbewerber_innen behandelt zu werden und somit häufig ohne Vormund dem Verfahren ausgesetzt zu sein, was vielfach zur Überforderung führt (vgl. Mohr 2000, S. 8).
Mit den genannten Regelungen sind die Behörden in der Lage asyl- und aufenthaltsrechtliche Entscheidungen gegenüber dieser Personengruppe zügig treffen sowie umsetzen zu können. Damit dienen sie der Verfahrens- beschleunigung (vgl. Peter 2003, S. 39). Somit sind die Gesetzesgrundlagen als Vorteil für die Behörden angedacht, haben jedoch gleichzeitig viele Nachteile für die UMFs mit sich gebracht. Beispielsweise können die Jugendlichen auf die Bundesländer verteilt werden, in Unterkünften für Erwachsene unterkommen oder sogar in Abschiebehaft kommen (vgl. Mohr 2000, S. 8). Ferner ist fraglich, inwieweit ein UMF ohne familiären Bezug, alleine und unbetreut in einem anderen Land, die nötige Einsichtsfähigkeit in die Bedeutung eines solchen Verfahrens hat und seiner Mitwirkungspflicht nachkommen kann. Kurz gefasst, ob er den gestellten Anforderungen des Asylverfahrens alleine gerecht werden kann (vgl. Peter 2003, S. 40). Denn die Festlegung einer Minderjährigkeitsgrenze hat nicht nur mit dem Erreichen einer bestimmten Zahl zu tun, sondern drückt auch das Erreichen einer bestimmten Persönlichkeitsentwicklung sowie psychosozialen Reife und Befähigung aus (vgl. Mohr 2000, S. 8).
Durch fehlende Ausweispapiere und die Zweifel an der Richtigkeit der Altersangaben bedeutet dieser Sachverhalt für die Altersfestsetzung bei UMFs, dass es immer wieder zu Problemen bei der Prüfung der Handlungsfähigkeit kommt. Peter (2003) stellt fest, dass Behörden häufig die Altersangaben von unter 16 Jährigen nach oben korrigieren (vgl. Peter 2003, S. 41). Die Herabsetzung der Handlungs- und Verfahrensfähigkeit auf das 16. Lebensjahr durch § 12 AsylVfG trug wesentlich dazu bei, dass das Verfahren zur Altersfestsetzung überhaupt erst eingeführt wurde (vgl. Jordan 2000, S. 61).
Durch die im § 12 AsylVfG festgelegte Handlungsfähigkeit ab dem 16. Lebensjahr erfährt die Altersfestsetzung eine enorme Bedeutung und die Genauigkeit der Altersbestimmung ist von großer Relevanz. Wie bereits angedeutet, spielt auch eine gewisse emotionale Reife und mentale Verantwortung in diesem Verfahren eine große Rolle, sodass dieser Aspekt auch bei der Bestimmung des Alters nicht außen vorgelassen werden darf.
2.3 Rechtliche Vorgaben zur Altersfestsetzung bei UMFs
2.3.1 In Deutschland
In Deutschland bestehen zum einen im Asylverfahrens- und im Aufenthaltsgesetz rechtliche Grundlagen und Regelungen zur Feststellung der Identität, worunter auch die Feststellung des Lebensalters fällt. Zum anderen gibt es eine Dienstanweisung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), in der u.a. das Vorgehen zur Bestimmung des Alters festgehalten wird.
Der § 16 Abs. 1 im AsylVfG legt fest, dass „ die Identität eines Ausländers8, der um Asyl nachsucht, durch erkennungsdienstliche Maßnahmen zu sichern [ist]. […] Es sei denn, er sei noch keine 14 Jahre alt “ . Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 2 sieht das AsylVfG nur das Anfertigen von Lichtbildern und Fingerabdrücken als geeignete Maßnahmen vor.
Im Aufenthaltsgesetz (AufenthG) ist laut § 49 Abs. 1-10 die Überprüfung, Feststellung und Sicherung der Identität auf vielfältige Weise zugelassen. Der § 49 Abs. 3 AufenthG formuliert ausdrücklich, wenn „ Zweifelüber die Person, das Lebensalter oder die Staatsangehörigkeit des Ausländers “ bestehen, dann „ sind die zur Feststellung seiner Identität, seines Lebensalters oder seiner Staatsangehörigkeit erforderlichen Maßnahmen zu treffen “ .
Der § 49 Abs. 6 AufenthG sieht folgende Maßnahmen als rechtlich zugelassen: das Aufnehmen von Lichtbildern, das Abnehmen von Fingerabdrücken, Messungen und ähnliche Maßnahmen, einschließlich körperliche Eingriffe, die von einem Arzt zur Feststellung des Alters vorgenommen werden, wenn sie kein Nachteil für die Gesundheit des Ausländers darstellen. Diese sollen dennoch nur durchgeführt werden, wenn die Feststellung der Identität auf anderer Art und Weise nicht oder nicht rechtzeitig oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten erfolgt. Der Paragraph hält ebenso fest, dass diese Maßnahmen nur bei Ausländern zulässig sind, die das 14. Lebensjahr vollendet haben. Wenn jedoch Zweifel über das Alter bestehen, dann geht das mitunter zu Lasten des Asylbewerbers/der Asylberwerber_in.
Zusätzlich wird in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz vom 26.10.2009 zu § 49 Abs. 3 AufenthG folgendes geschrieben:
„ [ … ] zur Feststellung der Identität, des Lebensalter und der Staatsangehörigkeit gem äß Absatz 3 ist zunächst eine eingehende Befragung des Ausländers zu seiner Person und zu seinem bisherigen Lebenslauf erforderlich, um Anhaltspunkte für weitere Ermittlungen zu erhalten (z.B. Zeugenbefragungen, Anfragen bei in- und ausländischen Behörden, Vorführung bei einer Vertretung des vermuteten Heimatlandes sowie Befragung durch hierzu ermächtigten Bedienstete des vermuteten Heimatlandes). Der Betroffene ist aufzufordern, geeignete Nachweise (z.B. Dokumente) beizubringen, die seine Angaben belegen “ (Bundesministerium des Innern 2009, S. 225).
Ebenfalls bestimmt die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu § 49 Abs. 6 Satz 2 AufenthG, dass bei Ausländern unter 14 Jahren die genannten Maßnahmen unzulässig sind. Erlaubt sind aber insbesondere kindgerechte Befragungen (vgl. ebd., S. 226). Ferner wird auch hier festgehalten:
„ Zweifel an der Vollendung des 14. Lebensjahres gehen aufgrund der Darlegungslast nach § 82 Abs. 1 Satz 1 zu Lasten des Ausländers. Ist der Zweck der Maßnahme auf die Feststellung des Lebensalters gerichtet, kann dieser Zweck nicht durch bloße Behauptung des Jugendlichen, jünger als 14 Jahre alt zu sein, unterlaufen werden. In diesem Fall findet die Einschränkung des Abs. 6 Satz 2 deshalb nur Anwendung, wenn die Inaugenscheinnahme ergibt, dass es sich um ein noch nicht 14jähriges Kind handelt “ (ebd., S. 226).
Die angeführten Gesetzestexte und die genannte Allgemeine Verwaltungs- vorschrift verdeutlichen, dass körperliche Eingriffe zur Altersbestimmung nur in Ausnahmefällen Anwendung finden dürfen und andere Maßnahmen vorrangig beachtet werden müssen. Diesen Umstand unterstreicht nochmals die EU- Asylverfahrensrichtlinie im Artikel 17 Abs. 5 - 6. In dieser ist festgehalten, dass körperliche Eingriffe zum Zweck der Altersfeststellung nur dann zulässig sind, wenn vorab eine ausführliche kind- bzw. jugendgerechte Befragung stattgefunden hat, danach keine anderen Möglichkeiten der Überprüfung der Angaben des minderjährigen Flüchtlings mehr bestehen und dieser einer ärztlichen Untersuchung zugestimmt hat (vgl. Art. 17 Abs. 5 bis Abs. 6 Richtlinie 2005/85/EG). Somit wird erneut ersichtlich, dass ärztliche Untersuchungen erst dann erfolgen dürfen, wenn alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft wurden und versagt haben.
Die Dienstanweisung „ Asylverfahren “, herausgegeben vom BAMF (Stand 2010), enthält u.a. den Punkt „ Altersbestimmung bei Minderjährigen “. Diesbezüglich wird bestimmt, dass erstens eine Festlegung eines fiktiven Alters bei Jugendlichen, die vorgeben unter 16 Jahre zu sein, aber augenscheinlich älter sind, grundsätzlich bei den Landesbehörden liegt und zweitens, dass das Bundesamt in diesen Fällen bei der Bearbeitung der Asylanträge regelmäßig von dem durch die zuständige Landesbehörde festgelegten fiktiven Alters- angaben ausgeht. Dieser Grundsatz gilt, wenn offenkundig Zweifel an der Richtigkeit der Altersangabe des Jugendlichen besteht (vgl. BAMF 2010, S. 23).
Weiterhin heißt es in der Dienstanweisung, dass es Ausnahmefälle gibt, bei denen die Altersbestimmung nicht offenkundig möglich ist und deswegen „ beim Bundesamt Bedenken hinsichtlich der Verfahrensfähigkeit des Jugendlichen bestehen “ (BAMF 2010, S. 23). In diesen Fällen nimmt das Bundesamt mittels Inaugenscheinnahme durch eine/n Sachbearbeiter_in für Asylangelegenheiten mit Sonderaufgabe und einer weiteren Person eine eigene Alterseinschätzung vor (vgl. BAMF 2010, S. 23).
2.3.2 In Berlin
Selbstverständlich hat auch Berlin nach den rechtlichen Grundlagen des Asylverfahrens- sowie Aufenthaltsgesetzes und der Dienstanweisung des BAMF zu handeln. Darüber hinaus gibt es jedoch für die zuständigen Behörden und Gerichte in Berlin bestimmte Gesetzesgrundlagen zu den Verfahren der Altersfestsetzung, auf derer ihr Handeln fundiert. Diese werden im Folgenden dargestellt9.
Zu Beginn des Verfahrens der Altersfestsetzung10 in Berlin nimmt die SenBildJugWiss als Funktion des Landesjugendamtes eine Altersschätzung im Rahmen einer Inobhutnahme vor. Gemäß § 42 SGB VIII ist eine Inobhutnahme nur bei Minderjährigen möglich, sodass bei Zweifeln an den Altersangaben der UMFs nach § 62 SGB I sich die betroffene Person den notwendigen „ä rztlichen und psychologischen Untersuchungsmaßnahmen “ unterziehen muss. Für die SenBildJugWiss kommt hierbei auch § 20 SGB X zum Tragen, nach dem die Behörde von Amtswegen her eigene Ermittlungen anstellt, um den Sachverhalt, hier die Unsicherheit über das Alter der Person, aufzuklären.
Obwohl bekannt ist, dass die Mitarbeiter_innen in dem Gespräch mit den UMFs einen standardisierten Fragebogen11 verwenden und auf Basis dieses Gespräches und des Fragebogens eine Einschätzung des Alters fällen, war durch Recherchen eine Dienstanweisung oder Ähnliches für die Mitarbeiter_innen der SenBildJugWiss in Berlin nicht zu eruieren.
Nach der Feststellung der Minderjährigkeit des UMFs durch die SenBildJugWiss wird eine Vormundschaft für diesen beantragt. Die Voraussetzung für eine Vormundschaft gemäß § 1773 BGB, worunter die Minderjährigkeit fällt, wird vom in Berlin zuständigen Familiengericht geprüft. Im Rahmen des Amtsermittlungsgrundsatzes nach § 26 FamFG hat das Gericht unter Ausschöpfung aller verfahrensrechtlich zulässigen Aufklärungs- möglichkeiten nach Gewissheit und Sicherheit, sich eine Beurteilung über das Alter des Betroffenen zu verschaffen. Auf dieser Grundlage hat das Gericht eine Entscheidung über die Festlegung des Alters des UMFs zu fällen und bedient sich dabei meist der Anordnung von medizinischen Gutachten.
Ferner ist, wie bereits erwähnt, im Rahmen des § 49 Abs. 6 AufenthG eine Altersfestsetzung möglich. In Berlin nimmt jedoch das Landesamt für Bürger- und Organisationsangelegenheiten (LABO), das für das Asylverfahren zuständig ist, keine Altersbestimmung vor, sondern orientiert sich an den Angaben der SenBildJugWiss.
2.4 UN-KRK: Vorgaben und Forderungen für den Umgang mit UMFs zur Altersfestsetzung
Zunächst ist herauszustellen, dass die UN-KRK ein völkerrechtlicher Vertrag ist, der für die Vertragsstaaten unmittelbare Verpflichtungen impliziert.
„ [Er ist] [ … ] nach Wortlaut, Zweck und Inhalt geeignet und hinreichend, wie eine innerstaatliche Regelung rechtliche Wirkungen zu entfalten [ … ]. [ … ] Der Vertrag [räumt] [ … ] auch unmittelbar bestimmbare Rechte ein und [soll] nicht nur zwischenstaatliche Rechte und Pflichten begründen, [sondern es] können hieraus Rechte abgleitet werden “ (Heinhold 2010, S. 60).
Ferner ist die UN-KRK ein Regelwerk, welches den Schutz Minderjähriger sicherstellen will. „ Sie definiert Grundsätze und Kinderrechte und verpflichtet die Staaten, sie zu achten und zu gewähren “ (ebd.).
2.4.1 Rücknahme der Vorbehalte zur UN-KRK und Forderungen
Wie bereits angeführt, ratifizierte die deutsche Bundesregierung am 05.04.1992 die UN-KRK, gab allerdings gleichzeitig eine Vorbehaltserklärung ab. Diese hielt fest, dass keine Bestimmung das Recht der Bundesrepublik Deutschland beschränken könne und somit die UN-KRK dem deutschen Ausländer- und Asylrecht für die Gruppe der Flüchtlingskinder unterzuordnen sei. Am 03.05.2010 nahm die deutsche Regierung diese Erklärung zurück. Durch die Rücknahme der Vorbehalte war jedoch noch keine grundlegende Änderung bewirkt, aber eine Voraussetzung für gesetzliche und rechtliche Erneuerungen geschaffen. Flüchtlings-, Menschenrechts- und Kinderrechtsorganisationen erhofften sich durch die Rücknahme der Vorbehalte eine Verbesserung der Situation von Flüchtlingskindern (vgl. Kauffmann/Riedelsheimer 2010, S. 8 f.).
Um nach der Rücknahme die Achtung des Kindeswohls in Deutschland vorrangig zu behandeln und den Vorgaben der UN-KRK Beachtung zu schenken, müssen laut Kauffmann (2010) u.a. das Aufenthalts- und Asylverfahrensgesetz angepasst, ein kindgerechtes Asylverfahren eingeführt, die Verfahrensfähigkeit ab 16 Jahren aufgehoben sowie die Praxis willkürlichen Altersschätzungen gegenüber Kindern rechtlich untersagt werden. Auch im ersten Kinder- und Jugendreport zur UN-Berichtserstattung über die Umsetzung der UN-KRK in Deutschland wird die Willkür der Altersschätzung und der behördliche Umgang mit UMFs kritisiert und eine Kontrollinstanz gefordert (vgl. Kauffmann 2010, S. 43 f.).
Bezüglich des Asylverfahrensgesetzes wird hinsichtlich der Altersschätzung nach der Rücknahme der Vorbehalte folgender Handlungsbedarf gesehen. Es wird gefordert, dass nach Ausschöpfung der vorhandenen Prüfungs- möglichkeiten, den Angaben des Betroffenen Glauben zu schenken. Bei den Prüfungsmöglichkeiten kann nach den Vorgaben der Asylverfahrensrichtlinie vorgegangen werden. Diese verlangt eine ärztliche Untersuchung, zu der der Flüchtling oder ein/e Vertreter_in von ihm eingewilligt haben muss und vorher umfassend über diese aufgeklärt wurde. Zudem ist das Wohl des Kindes vorrangig zu beachten. Das bedeutet, in Zweifelsfällen verfahrensrechtlich von der Minderjährigkeit auszugehen (vgl. Heinhold 2010, S. 64 f.)
2.4.2 Vorgaben der UN-KRK für den Umgang mit UMFs zur Altersfestsetzung
Vorweg ist zu bemerken, dass es in der UN-KRK keine gesonderten Artikel zur Altersfestsetzung bei UMFs gibt, da sie in erster Linie allgemein, abstrakt und für alle Kinder geltend, formuliert ist. Dennoch lassen sich aus einigen Artikel Vorgaben für den Umgang mit UMFs zur Altersfestsetzung ableiten.
Demzufolge hält Art. 2 UN-KRK fest, dass jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind gewährleistet wird, nicht diskriminiert zu werden. Dazu treffen die Vertragsstaaten „ alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass das Kind vor allen Formen der Diskriminierung oder Bestrafung [ … ] geschützt wird “ . Dieses Diskriminierungsverbot ist selbstverständlich auch bei der Altersfestsetzung von UMFs zu beachten.
Ferner spielt der Art. 3 UN-KRK bei der Altersbestimmung eine wichtige Rolle. Denn dieser verpflichtet alle öffentlichen und privaten Einrichtungen dazu, bei Maßnahmen, die Kinder betreffen das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen (vgl. Liebel 2007, S. 162). Dieser Aspekt sollte grundsätzlich bei der Durchführung von Maßnahmen zur Altersfestsetzung nicht aus den Augen verloren werden.
Bei dem Wohl des Kindes ist es bedeutend, dem Kind, dessen Interessen und Meinung Gehör zu schenken. Sodass nach Art. 12 UN-KRK „ dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben [werden sollte], in allen das Kind berührenden Gerichts- und Verwaltungsverfahren entweder mittelbar oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden “ .
Das bedeutet, dass ein UMF in Bezug auf die Altersfestsetzung die Möglichkeit zustehen muss, sich diesbezüglich zu äußern und der Aussage Berücksichtigung im Verfahren geschenkt wird.
Weiterhin fordert Art. 19 UN-KRK die Vertragsstaaten dazu auf, alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, „ um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, Schadenszuführung [ … ], vor schlechter Behandlung [ … ] zu schützen, solange es sich in der Obhut [ … ] eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters [ … ] befindet [ … ] “.
So kann daraus geschlossen werden, dass hierunter auch UMFs fallen, die einen Vormund haben oder vom Jugendamt in Obhut genommen wurden. In Anbetracht dessen sollte bei den Maßnahmen zur Altersfestsetzung beachtet werden, dass das Kind keine Schäden davon trägt oder unangemessen behandelt wird.
Außerdem fordert der Art. 20 UN-KRK, das Kindern, die vorübergehend oder dauerhaft aus ihrer familiären Umgebung getrennt werden, einen Anspruch auf besonderen Schutz und Beistand des Staates haben. Der Art. 22 UN-KRK, der sich konkret auf UMFs bezieht, besagt ebenfalls, dass gegenüber einem Kind, das als Flüchtling anerkannt werden will oder als Flüchtling angesehen wird, angemessener Schutz und humanitäre Hilfe zu gewährleistet ist und zwar unabhängig davon, ob es in Begleitung seiner Eltern oder einer anderen Person befindet oder nicht.
2.4.3 General Comment Nr. 6
„ Der Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte des Kindes verfasst, ebenso wie die anderen UN-Menschenrechtsausschüsse, Kommentare, "General Comments", auf Deutsch "Allgemeine Bemerkungen". Diese Kommentare betreffen zentrale Probleme und Anliegen, die der Ausschuss wahrnimmt, wenn er die Einhaltung der Kinderrechte kontrolliert, zu der sich fast alle Staaten durch ihren Beitritt zur Kinderrechtskonvention verpflichtet haben “ (B-UMF e.V. 2005, .S.2).
Der General Comment Nr. 6, in Deutsch „ Allgemeine Bemerkung Nr. 6 “, wurde 2005 herausgegeben und bezieht sich auf die „ Behandlung unbegleiteter und von ihren Eltern getrennter Kinder außerhalb ihres Herkunftslandes “.
Der General Comment Nr. 6 nimmt u.a. Bezug auf den Art. 3 UN-KRK, welcher auf das Wohl des Kindes Bezug nimmt. Hierzu wird nochmals explizit darauf aufmerksam gemacht, dass „ in Vorbereitung jeder Entscheidung, die für das Leben eines unbegleiteten und von seiner Familie getrennten Kindes von gr öß erer Tragweite ist, auf jeder Stufe die Abwägung zum Wohle des Kindes zu dokumentieren [ist] “ (ebd., S. 8).
Hierunter fällt auch die Bestimmung des Alters, da dieses ausschlaggebend für den weiteren Aufenthalt des UMFs in Deutschland ist.
Weiterhin fordert der General Comment Nr. 6 eine fundierte Entscheidung darüber, was im Interesse des Kindeswohls liegt. Unter anderem wird eine klare und umfassende Feststellung der Identität des Kindes verlangt. Eine Voraussetzung dafür ist, dem Kind Zugang zum Hoheitsgebiet zu gewähren und in einem entsprechenden klärenden Prozess eine erste Einschätzung zu fällen. Diese erste Einschätzung sollte in einem Eingangsgespräch in einer freundlichen und sicheren Atmosphäre stattfinden, von speziell geschultem Personal altersgerecht geführt und mit sensiblen Befragungstechniken durchgeführt werden. Da zur Feststellung der Identität auch das Lebensalter gehört, sind diese Forderungen auch auf die Altersfestsetzung zu beziehen (vgl. ebd.).
In der Allgemeinen Bemerkung werden zudem auch speziell unter dem Kapitel „ Berücksichtigung notwendiger allgemeiner und besonderer Vorkehrungen zum Schutz des Kindes “ unter dem Bereich „ Erste Begutachtung und Sofort- maßnahmen “ Empfehlungen für den Umgang mit UMFs zur Feststellung des Alters ausgesprochen. Als Erstes wird ausdrücklich betont, dass das Wohl des Kindes das Leitprinzip jeder Handlung sein muss. Unter angemessenen und notwendigen Identifizierungsmaßnahmen wird auch die Feststellung des Alters miteinbezogen. Hierbei sollte nicht nur dem physischen Zustand des Kindes, sondern auch der psychischen Reife Beachtung geschenkt werden. Ferner ist die Untersuchung „ in einer Art und Weise durchzuführen, die wissenschaftlich fundiert, sicher, kindgerecht, vorurteilslos und dem Geschlecht des Kindes angemessen ist “ (ebd., S. 10). Jedes Risiko für die körperliche und seelische Unversehrtheit des Kindes ist zu vermeiden und die Würde des Menschen zu achten. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist, dass im Falle verbleibender Zweifel zu Gunsten des Betroffenen zu entscheiden ist, sobald die Möglichkeit besteht, dass es sich um ein Kind handeln könnte (vgl. ebd.).
3. Methodologie und methodisches Vorgehen
3.1 Forschungs- und Auswertungsmethode
3.1.1 Forschungsmethode - Das Expert_inneninterview
In der Methodenliteratur wurde das Expert_inneninterview lange Zeit eher randständig behandelt, trotzdem war es eine vielfach eingesetzte Methode in der Sozialforschung. Häufig wird es im Rahmen eines Methodenmix eingesetzt, fungiert aber auch als selbständiges qualitatives Verfahren zur Datenerhebung (vgl. Meuser/Nagel 2011, S. 57). Des Öfteren wird nicht nur von einem Expert_inneninterview, sondern auch von einem Leitfadeninterview oder einem leitfadengestützten Expert_inneninterview gesprochen (vgl. Liebhold/Trinczek 2009, S. 32).
Bevor in diesem Kapitel die Methode des Expert_inneninterviews näher erläutert wird, ist erst einmal zu klären, was eine/n Expert_in charakterisiert. Ein/e Expert_in verfügt über ein spezielles Wissen, dass er/sie nicht nur alleine besitzt, jedoch nicht für jede/n interessierte/n Dritte/n ohne Weiteres im Handlungsfeld zugänglich ist. Der/die Expert_in ist nicht in der Rolle als Privatperson von Interesse, sondern vielmehr als Funktionsträger_in innerhalb eines organisatorischen oder institutionellen Kontextes von Bedeutung. Somit ist der Expert_innenstatus auch vom jeweiligen Forschungsinteresse sowie -standpunkt abhängig (vgl. Meuser/Nagel 2009, S. 467). Folglich zielt das Interview auf einen ausgewählten Personenkreis ab, der im Hinblick auf das jeweilige Forschungsinteresse spezifisches Wissen mitbringt. So existiert ein klar begrenzter Bezugsrahmen über einen eindeutig abgegrenzten Realitätsausschnitt. Außerhalb dieses Ausschnitts ist der/die Expert_in eine „ ganz normale Person “ (vgl. Liebhold/Trinczek 2009, S. 33 f.).
Das Expert_innenwissen ist aber nicht einfach abrufbar und damit frei verfügbar, sondern es muss aus den Aussagen der Expert_innen rekonstruiert werden. Das bedeutet, die jeweiligen Relevanzsysteme, handlungs- bzw. funktionsbereichsspezifischen Muster werden interpretativ nachgebildet.
„ Damit ist es letztlich die Aufgabe der sozialwissenschaftlichen
Interpreten, diesen „ impliziten Hintergrund “ des Handelns zu rekonstruieren “ (ebd., S. 35).
Das Expert_inneninterview zielt somit klar auf komplexe Wissensbestände ab, die für die Erklärung von sozialen Phänomenen von Bedeutung sind (vgl. ebd.).
Um genau dieses Wissen zu generieren, stützt sich das Expert_inneninterview auf eine klar definierte Ausrichtung, die durch einen Leitfaden vorstrukturiert wird. Der offene Leitfaden bietet ausreichend Raum für narrative Erzählpassagen mit eigener Relevanzsetzung und ermöglicht eine inhaltliche Fokussierung aber auch selbstläufige Schilderungen (vgl. ebd.). Bei den Fragen ist es wichtig, dass sie sich auf das „ Wie “ des Entscheidens und Handelns konzentrieren, denn dadurch lassen sich allgemeine Prinzipien und Maximen gut erfassen. Außerdem sollten die Fragen durch ihre Formulierung verdeutlichen, dass sie auf überpersönliches und institutionsbezogenes Wissen abzielen. Nachfragen können dazu dienen, konkretere Schilderungen zu Erlebnissen oder Erzählungen zu erhalten (vgl. Meuser/Nagel 2009, S. 474).
Mit der Auswahl der Expert_innen und der Vorstrukturierung durch den Leitfaden, hat der/die Forscher_in einen thematischen Schwerpunkt gesetzt. Trotzdem bleibt die Bedeutungsstrukturierung durch die erzählende Gesprächsstruktur dem Befragten größtenteils überlassen. Durch die Offenheit lassen sich konzeptionelle Vorüberlegungen durchaus verwerfen (vgl. Liebhold/Trinczek 2009, S. 37).
Diese doppelte Ausrichtung des Expert_inneninterviews nennt man auch „ geschlossene Offenheit “. Damit gemeint sind zum einen die konzeptionellen Vorüberlegungen, die das Feld strukturieren und eingrenzen sowie zum anderen das Erzählprinzip, das dem/der Interviewte/n ermöglicht, die Bedeutungsstruktur zu gestalten und zu beeinflussen. Somit gehen Deduktion und Induktion in diesem Fall Hand in Hand (vgl. ebd.).
3.1.2 Begründung der Methodenwahl
In der vorliegenden Forschungsarbeit wurde die Methode des Expert_inneninterviews zur Erhebung der Daten angewendet, da mit dieser, wie bereits im vorherigen Abschnitt erläutert, Wissen von Expert_innen über ein bestimmtes Themenfeld erschlossen werden kann.
Für das vorliegende Forschungsinteresse scheint diese Erhebungsmethode besonders geeignet, da einerseits das spezifische Wissen bestimmter Personenkreise in organisatorischen und institutionellen Kontext gefragt ist und anderseits die inhaltliche Tiefe durch bspw. quantitative Erhebungsverfahren nicht erreicht werden kann. Darüber hinaus würden eine mündliche Befragung der Betroffenen selbst oder ethnografische Methoden aus zeitökonomischen Gründen nicht in Betracht kommen und für das Forschungsinteresse nicht zielführend sein.
Für den Forschungsprozess war von Bedeutung, dass die Expert_innen ihr besonderes Wissen über soziale bzw. fachliche Kontexte für die Untersuchung zur Verfügung stellten, sodass im Ergebnis soziale Situationen bzw. Prozesse rekonstruiert werden konnten und eine Beantwortung der Forschungsfrage ermöglicht wurde (vgl. Gläser/Laudel 2009, S. 11 ff.).
3.1.3 Inhaltsanalytische Auswertung nach Meuser und Nagel
Der folgende Abschnitt beschreibt die Auswertungsmethode nach Meuser und Nagel sowie die einzelnen Vorgehensschritte.
Bei der inhaltsanalytischen Auswertung nach Meuser und Nagel (1991) geht es um den Vergleich mehrerer Interviewtransskripte von Exptert_innen. Dabei soll das Überindividuell-Gemeinsame aus den Interviews herausgearbeitet werden, um Aussagen über gemeinsam geteilte Wissensbestände, Relevanzstrukturen, Wirklichkeitskonstruktionen, Interpretationen und Deutungsmuster treffen zu können. Beim Vorgehen des thematischen Vergleichs sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede festgestellt werden (vgl. Meuser/Nagel 1991, S. 452).
Die Auswertung orientiert sich an thematischen Einheiten sowie an inhaltlich zusammengehörige, über den Text verstreute, Passagen. Die Vergleichbarkeit der Texte wird weitestgehend einerseits durch den gemeinsam geteilten institutionell-organisatorischen Kontext der Expert_innen und andererseits durch die leitfadenorientierte Interviewführung gesichert (vgl. ebd., S. 453).
Das Modell ist in sechs Phasen der Auswertung aufgeteilt, die im Folgenden kurz dargelegt werden:
1. Transkription: Die Auswertung setzt die Transkription der audiographisch aufgezeichneten Interviews voraus. Auch wenn nicht jeder Abschnitt transkribiert werden muss, wird doch auf die Vollständigkeit der Transkription des Interviews wertgelegt (vgl. ebd., S. 455).
2. Paraphrase: In dieser Phase wird eine sequenzielle Strukturierung des Textes nach thematischen Einheiten vorgenommen. Dabei wird sich an dem Alltagsverständnis orientiert. Bei der Paraphrasierung soll dem Gesprächs- verlauf gefolgt und wiedergeben werden, was die Expert_innen insgesamt geäußert haben. Dabei soll das Wissen zwar textgetreu, aber in eigenen Worten wiedergegeben werden (vgl. ebd., S. 456). Bei einer guten Paraphrase gehen Themen und Aspekte nicht verloren. Es kommt auf die
Reduktion von Komplexität an, ohne wichtige Dinge wegfallen zu lassen. Hiermit wird zum ersten Mal das Textmaterial verdichtet (vgl. ebd., S. 457). 3. Kodieren: Im dritten Punkt geht es darum, die paraphrasierten Passagen mit Überschriften zu versehen. Es soll eine thematische Ordnung hergestellt werden. Dabei soll die Terminologie der Expert_innen aufgegriffen werden. Zum Beispiel können Begriffe oder Redewendungen aus dem Interview übernommen werden. Es ist möglich einer Passage mehrere Überschriften zu geben bzw. eine Passage auch zu teilen (vgl. ebd., S. 458). 4. Thematischer Vergleich: Ab hier geht die Auswertung über die einzelnen Texteinheiten hinaus. Es werden thematisch vergleichbare Textpassagen aus den verschiedenen Interviews gebündelt. Es kommt zu einer textnahen Kategorienbildung, d.h. Passagen aus Interviews mit gleichen oder ähnlichen Themen werden zusammengestellt und die Überschriften werden vereinheitlicht (vgl. ebd., S. 459).
5. Soziologische Konzeptualisierung: In diesem Abschnitt kommt es zur Ablösung vom Text. Gemeinsames aus den Interviews soll in eine Form von Kategorien gebracht werden. In einer Kategorie wird das gemeinsam geteilte Wissen der Expert_innen verdichtet und verdeutlicht. Ziel ist es hierbei, eine Systematisierung von Relevanzen, Typsierungen, Verallge- meinerungen und Deutungsmustern zu erreichen. Es entsteht eine empirische Generalisierung, sodass Aussagen über Strukturen des Expert_innenwissens getroffen werden können. Die Verallgemeinerung bleibt jedoch auf dem vorliegenden empirischen Material begrenzt (vgl. ebd., S. 462).
6. Theoretische Generalisierung: Im letzten Schritt der Auswertung ist die Darstellung der Ergebnisse wichtig, in dem eine Interpretation der empirisch generalisierten Aussagen stattfindet (vgl. ebd., S. 463). Dabei werden Sinneszusammenhänge zu Typologien oder zu Theorien verknüpft. Die Empirie und Theorie wird nun miteinander verbunden. Die getroffenen Vorüberlegungen und Konzepte sind entweder inadäquat, falsifiziert oder sie passen. Dennoch muss jede gezogene Konsequenz begründet werden (vgl. ebd., S. 465).
3.2 Methodisches Vorgehen
3.2.1 Feldzugang
Der Feldzugang wurde mit Hilfe der Praxisforschungswerkstatt namens
„ Entscheidungsprozesse in Feldern der Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik - Entstehung, Verarbeitung & Wirkungsweise „ der Alice- Salomon-Hochschule Berlin ermöglicht und unterstützt. Es war von Bedeutung im Forschungsprozess unterschiedliche Sichtweisen und Standpunkte von Expert_innen einzuholen und zu beleuchten. Ziel war es, auf der einen Seite einen möglichst weitgefächerten und kontrastreichen Einblick in das Themengebiet zu erhalten und auf der anderen Seite eine Grundlage zu erarbeiten, die eine Gegenüberstellung der Äußerungen und Aussagen der Interviewpartner_innen ermöglicht.
Die Expert_innen wurden eingangs per E-Mail und/oder Telefonat zu ihrer Bereitschaft für ein Interview angefragt. Im Prozess der Kontaktaufnahme zeigte sich, dass es dem Forschungsthema nicht an Aktualität und Brisanz fehlt und genügend Gesprächsstoff für ein Interview vorhanden ist. Jedoch ist zu vermuten, dass es wegen der heiklen und immer wieder in der Kritik stehenden Thematik dazu geführt hat, dass der Zeitpunkt der Interviewanfragen besonders problematisch war, um einen Feldzugang zu finden und auf eine positive Auskunftsbereitschaft zu treffen.
Für das Forschungsvorhaben wurden folgende Einrichtungen/Organisationen12 für ein Interview angefragt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Einige Einrichtungen, Organisationen und Personen können auf Grund der Wahrung der Anonymität nicht namentlich genau benannt werden.
3.2.2 Aufbau und Strukturierung des Interviewleitfadens
Der Interviewleitfaden ist ein Instrument zur Erhebung von Daten, welches eine Art „ inhaltliches und chronologisches Gerüst “ im Interview darstellt und dem/der Interviewer_in trotzdem weitestgehende Entscheidungsfreiheit lässt, wann und in welcher Form die Fragen gestellt werden (vgl. Gläser/Laudel 2009, S. 142). Die bereits erwähnte „ geschlossene Offenheit “ des Expert_inneninterviews bietet eine flexible Handhabung des Interviewleitfadens (vgl. Liebold/Trinczek 2009, S. 38).
Durch theoretisch-wissenschaftliche Vorüberlegungen gelangt man unter Einbeziehung von Variablen und Einflussfaktoren zu einer präzisen Formulierung des Erkenntnisinteresses und somit auch zu der Entwicklung der Fragen des Leitfadens. Dieser Schritt ist sehr wichtig für die Entstehung des Leitfadens, da dieser die einzige schriftliche Unterstützung im Interview bietet. Er stellt bei mehreren Interviews sicher, dass gleichartige Informationen erhoben werden (vgl. Gläser/Laudel 2009, S. 143). Ferner unterstützt die leitfadengestützte Gesprächsführung mit Expert_innen den/die Forscher_in, dem thematischen Fokus des Forschungsinteresses gerecht zu werden und diesen nicht aus den Augen zu verlieren (vgl. Liebold/Trinczek 2009, S. 38).
Die durchgeführten Expert_inneninterviews wurden im Forschungsprozess auf Grundlage eines offenen Interviewleitfadens geführt, um den Expert_innen genügend Raum für möglichst detaillierte und selbstläufige Beschreibung sowie Erzählungen zu geben. Zudem wurde auf erzählgenerierende Nachfragen Wert gelegt, um weitere Detaillierungen zu ermöglichen. Durch Vorüberlegungen und Recherchen stellten sich folgende Faktoren als zentral für die Beantwortung der Forschungsfrage dar, sodass sich an diesen Punkten die Entwicklung sowie Formulierung der Fragen für den Leitfaden13 orientierte:
I. Abläufe und Vorgehensweisen der Verfahren zur Altersfestsetzung in Berlin sowie die angewandten Methoden
II. Gesetzliche Grundlagen zur Altersbestimmung bei UMFs
III. § 12 AsylVfG: Handlungsfähigkeit ab dem 16. Lebensjahr
IV. Kritik an den Verfahren (mit Bezug zur UN-KRK)
V. Vorschläge zu Handlungsalternativen zu den Verfahren und Methoden (Orientierung an der UN-KRK)
Bei der Reihenfolge der Fragen im Interviewleitfaden ist es von Bedeutung, dass inhaltlich zusammengehörende Themen nacheinander behandelt werden, um zum einen eine Annäherung an einem natürlichen Gesprächsverlauf zu ermöglichen und zum anderen dem/der Interviewpartner_in genügend Zeit zu geben, sich an bestimmte Themen zu erinnern und diese wieder zu geben (vgl. Gläser/Laudel 2009, S. 146).
Da der Anfang und Schluss eines Interviews eine wichtige Phase darstellen, ist es hier von besonderer Bedeutung, auf die Wahl der Eingangs- und Abschlussfrage zu achten. Zu Beginn werden die Rollen der Gesprächs- partner_innen definiert und das Klima des Interviews bildet sich heraus. Deswegen ist es ratsam, eine sogenannte „ Aufwärmfrage “ auszuwählen, die leicht zu beantworten ist. Ebenso sollte die letzte Frage angenehm sein und keine heiklen Themen mehr anschneiden, damit nicht die Gefahr besteht, dass das Interview einen unangenehmen Eindruck hinterlässt (vgl. ebd., S. 147 ff).
In den geführten Interviews wurde deshalb zu Beginn die Vorstellung der Interviewpartner_innen und ihres Arbeits- bzw. Themengebietes gewählt. Die Abschlussfrage, ob der/die Interviewpartner_in noch andere Aspekte ergänzen möchte, bietet dem/der Expert_in die Möglichkeit, Themen hinzuzufügen, die ihm/ihr im Interview zu wenig berücksichtigt wurden.
Nach einem geführten Interview liegen spezifische und situationsgebundene Erfahrungen vor. Dieses erweiterte Wissen kann im Leitfaden und damit im Untersuchungsverlauf integriert werden, sodass der Interviewleitfaden im Forschungsprozess immer wieder überarbeitet und angepasst wurde. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, sich flexibel an neue Inhalte und Interviewsituationen anzupassen (prozesshafte Vorgehensweise). Diese Verfahrensweise steigert erheblich die Qualität des erhobenen Datenmaterials. (vgl. ebd., S. 149).
[...]
1 Die Begründung der Begriffswahl des unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings ist im Kapitel 2.1 zu finden.
2 „ Im Zusammenhang mit jungen Flüchtlingen verwenden Fachkräfte den Begriff in der Regel für den Prozess, in dem eine umfassende Bestandsaufnahme des Ist- Standes des Minderjährigen in allen zentralen Lebensbereichen steht und mögliche Lösungsansätze für verschiedene Problembereiche erarbeitet werden “ (Riedelsheimer 2010, S. 63).
3 Die Verfahren zur Altersfestsetzung in Deutschland variieren stark, sodass eine detaillierte Analyse bundesweit für diesen Rahmen zu umfangreich wäre.
4 „ Der Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte des Kindes verfasst [ … ] Kommentare [und] "General Comments", auf Deutsch "Allgemeine Bemerkungen". Diese Kommentare betreffen zentrale Probleme und Anliegen, die der Ausschuss wahrnimmt, wenn er die Einhaltung der Kinderrechte kontrolliert, zu der sich fast alle Staaten durch ihren Beitritt zur Kinderrechtskonvention verpflichtet haben “ (B-UMF e.V. 2005, S. 2).
5 „ In der National Coalition haben sich [ … ] Organisationen und Initiativen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zusammengeschlossen mit dem Ziel, die [UN-KRK] [ … ] bekannt zu machen und ihre Umsetzung in Deutschland voranzubringen “ (National Coalition o.J.) .
6 Auf den General Comment Nr. 6 wird im Kapitel 2.4.3 näher eingegangen.
7 Auf den Aspekt der Verfahrensfähigkeit und die Bedeutung für die Altersfestsetzung wird im Kapitel 2.2.1 näher eingegangen.
8 Der Begriff des „ Ausländers “ wird hier aus dem Asylverfahrensgesetz übernommen.
9 Da keine Durchführungsbestimmung oder Ausführungsvorschrift o.ä. für die Altersfestsetzung in Berlin existiert, wird sich in diesem Abschnitt an den Angaben der Interviewpartner_innen orientiert.
10 Auf die Verfahren der Altersfestsetzung in Berlin wird in Kapitel 4 eingegangen.
11 Der Fragenbogen der SenBildJugWiss ist im Anhang 5. Kapitel zu finden.
12 Einige Einrichtungen, Organisationen und Personen können auf Grund der Wahrung der Anonymität nicht namentlich genau benannt werden.
13 Die Leitfäden für die einzelnen Interviews sind im Anhang zu finden.