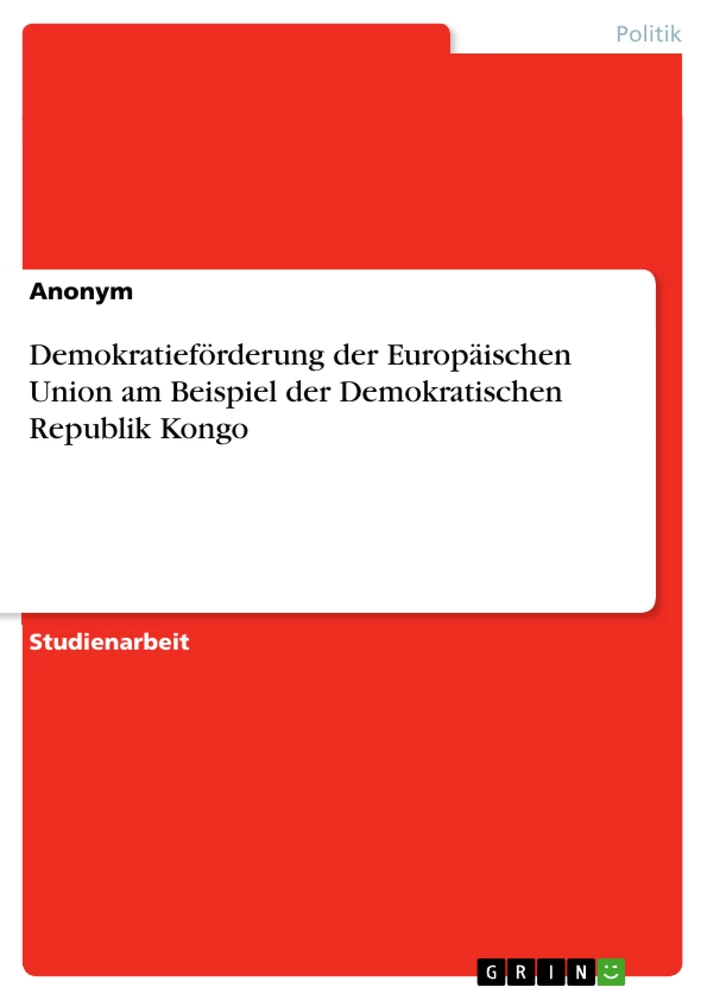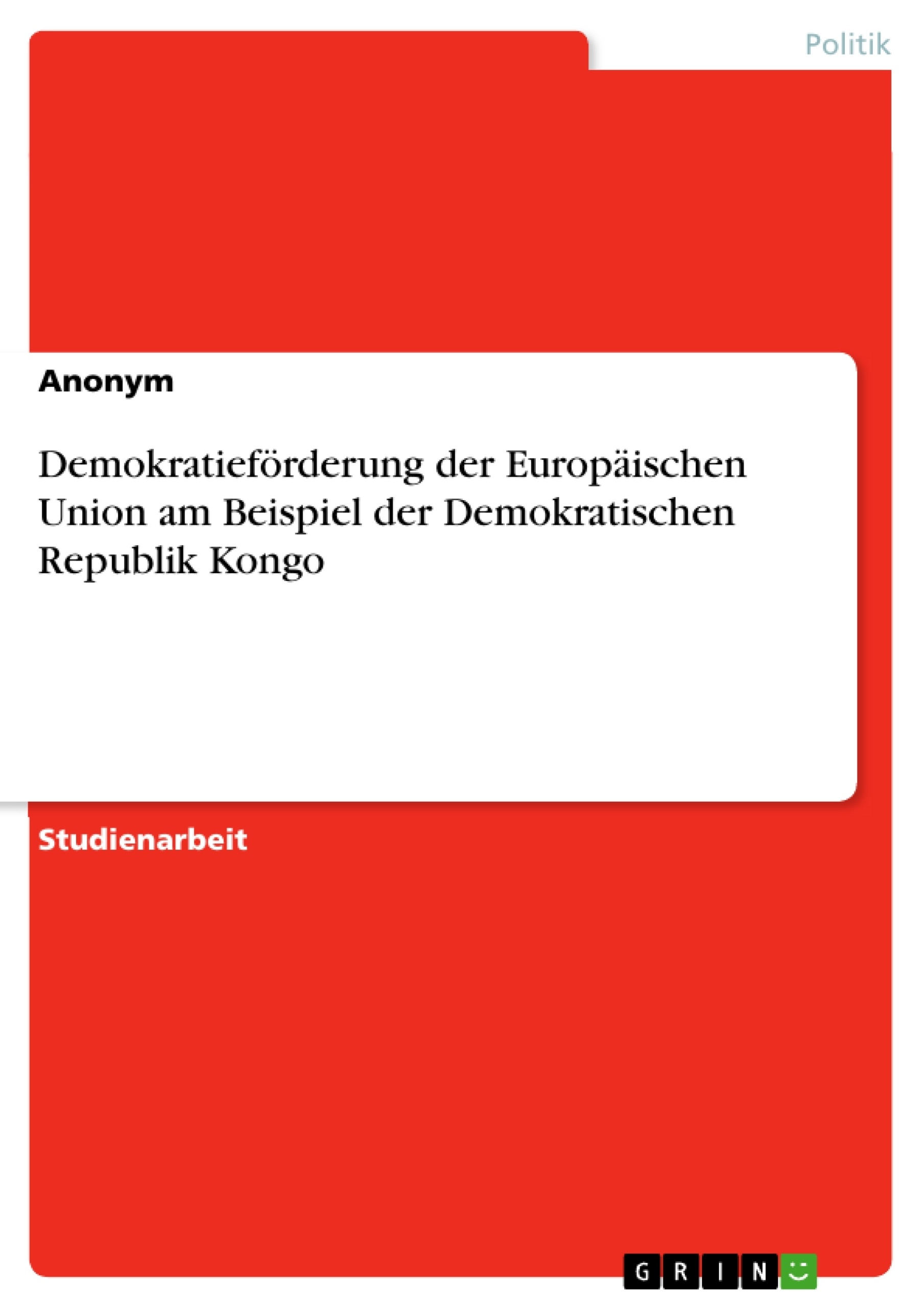Thomas Lauren Friedman, amerikanischer Journalist der New York Times, entwickelte im Dezember 1996 eine Theorie, die besagt, dass Staaten, die ein Mc Donald’s besäßen, keinen Krieg miteinander führen würden. Die sogenannte „Golden Arches Theory“ sollte mit dem Kosovokrieg widerlegt werden, doch es bleibt unumstritten, dass Demokratien seltener miteinander Krieg führen als alle anderen Regime (Friedman 1996). Der sogenannte „Demokratische Frieden“ legt den Grundbaustein dafür, dass westliche Staaten ambitioniert sind, demokratische Grundordnungen in die Welt hinauszutragen (Hanseclever 2003 :9).
Die Europäische Union ist bereits seit Jahrzehnten bestrebt, autoritäre Regime in die Demokratie zu führen. Ihnen stehen dabei eine Vielzahl von Mitteln zur Verfügung, die politische, finanzielle sowie beratende Hilfen umfassen. Das Ziel ist klar vorgegeben: durch die Umstrukturierung undemokratischer Systeme soll es Staaten ermöglicht werden, ihren Bürgern eine demokratische Grundordnung zu sichern. Mit dieser Voraussetzung können sie sich wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich entfalten. Dies hat im besten Falle zur Folge, dass eine Zivilgesellschaft entsteht, die sowohl ihre Grund- und Freiheitsrechte ausüben, als auch politische Prozesse mittragen kann, ob nun durch den Urnengang oder durch ative Teilnahme.
Dieses Ziele wollte die Europäische Union beziehungsweise die Vereinten Nationen 1999 auch in der Demokratischen Republik Kongo umsetzen. Hierfür wurden friedenssichernde und ökonomische Hilfspakete geschnürt, die den Staat in die Demokratie führen sollte. Doch das Ergebnis fiel nicht aus, wie geplant. Heute leidet das Land fortwährend unter Bürgerkriegen und Menschenrechtsverletzungen. Doch kann die Mission der Demokratieförderung in der Demokratischen Republik als gescheitert angesehen werden? Diese Frage soll auf den folgenden Seiten erörtert werden.
In dieser Forschungsarbeit wird im ersten Schritt die Demokratieförderung beleuchtet. Hierzu sollen sowohl die Methoden, als auch Strategien und Instrumente erläutert werden. Darauf folgend soll die Europäische Union als Förderer betrachtet werden. Im zweiten Abschnitt der Hausarbeit wird die Demokratische Republik Kongo genauer betrachtet um danach erläutern zu können, warum die Europäische Union als Demokratieförderer weitgehend gescheitert ist. Im letzten Teil werden alle Ergebnisse in einem Fazit zusammengetragen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Methoden der Demokratieförderung
Strategien und Instrumente der Demokratieförderung
Die Europäische Union als Förderer der Demokratie
Die Demokratische Republik Kongo: eine defekte Demokratie?
Das Scheitern der Demokratieförderung in der Demokratischen Republik Kongo
Fazit
Quellen