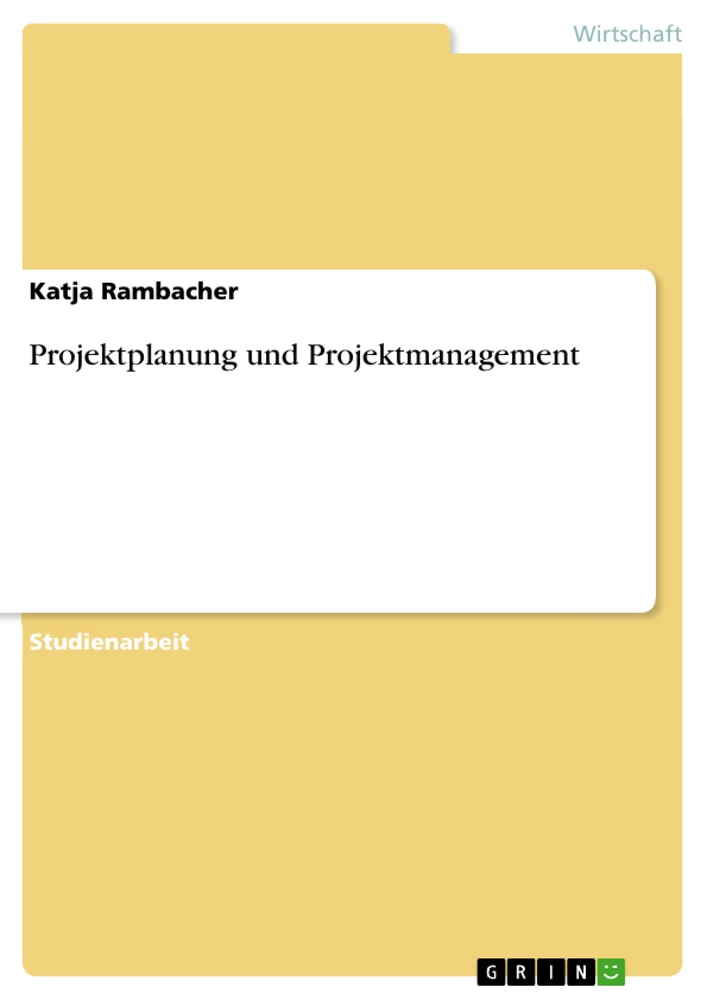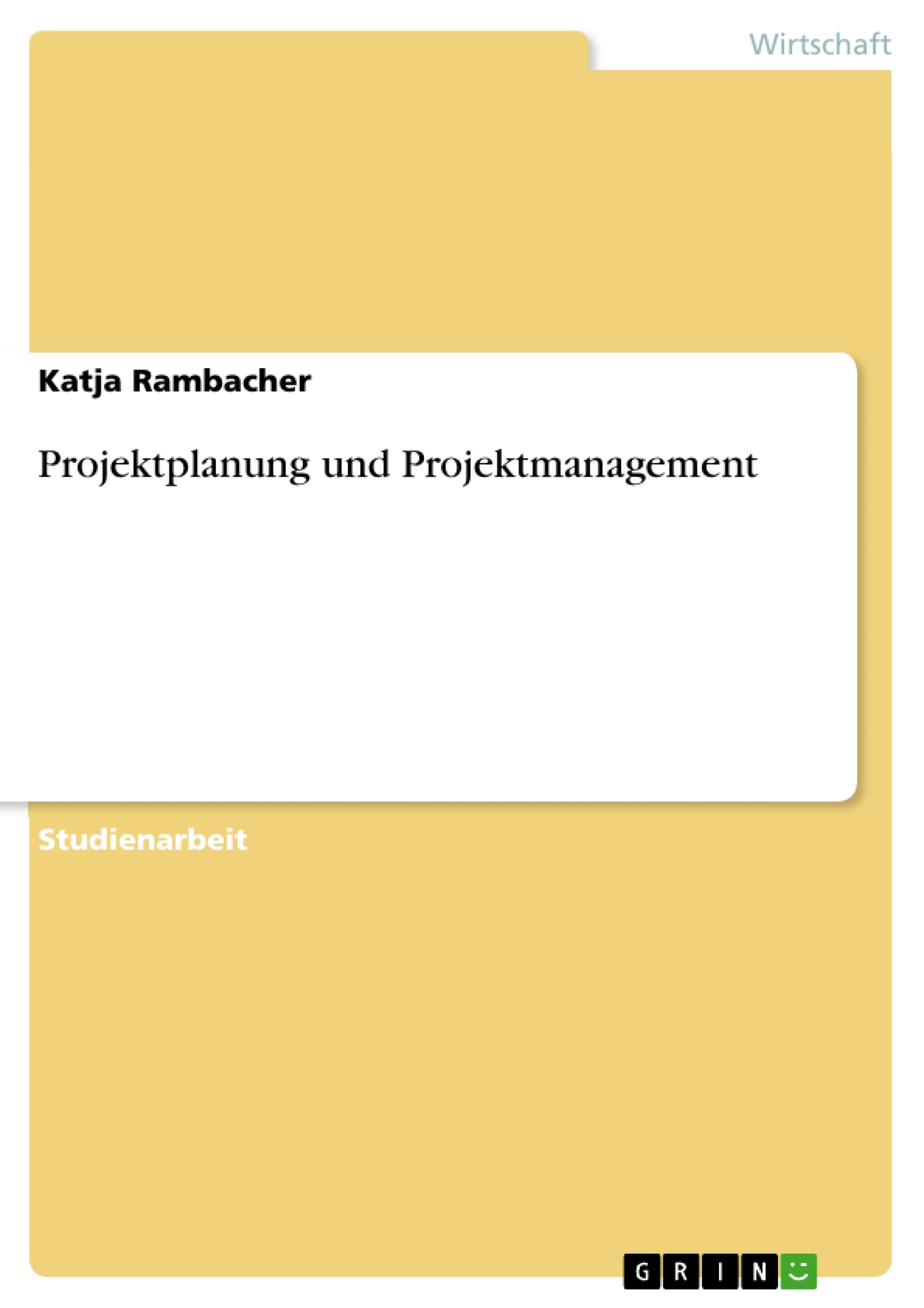Im Rahmen des Seminars Projektmanagement sollen in dieser Seminardokumentation die relevanten Projektmanagementthemen mit ihren theoretischen Hintergründen zu einem vorgegebenen Projektauftrag aufgezeigt werden.
Um ein Projekt zum Erfolg zu führen, ist die genaue Definition seiner Ziele ein entscheidender Faktor. Eine Hilfe zur Formulierung von Zielen stellt das Akronym SMART dar, das für die wichtigsten Eigenschaften von Zielen steht. Demnach sollten Zielformulierungen stets spezifisch, messbar, aktiv erreichbar, realistisch und terminiert sein.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Ausgangslage
1.1 Arbeitsauftrag
1.2 Begriffsbestimmung Projekt
2 Projektziele
3 Projekt-Umfeld-Analyse
3.1 Stakeholder-Analyse
3.2 Risiko-Analyse
4 Projektstrukturplan
5 Ablauf- und Terminplanung
6 Fazit
Literaturverzeichnis