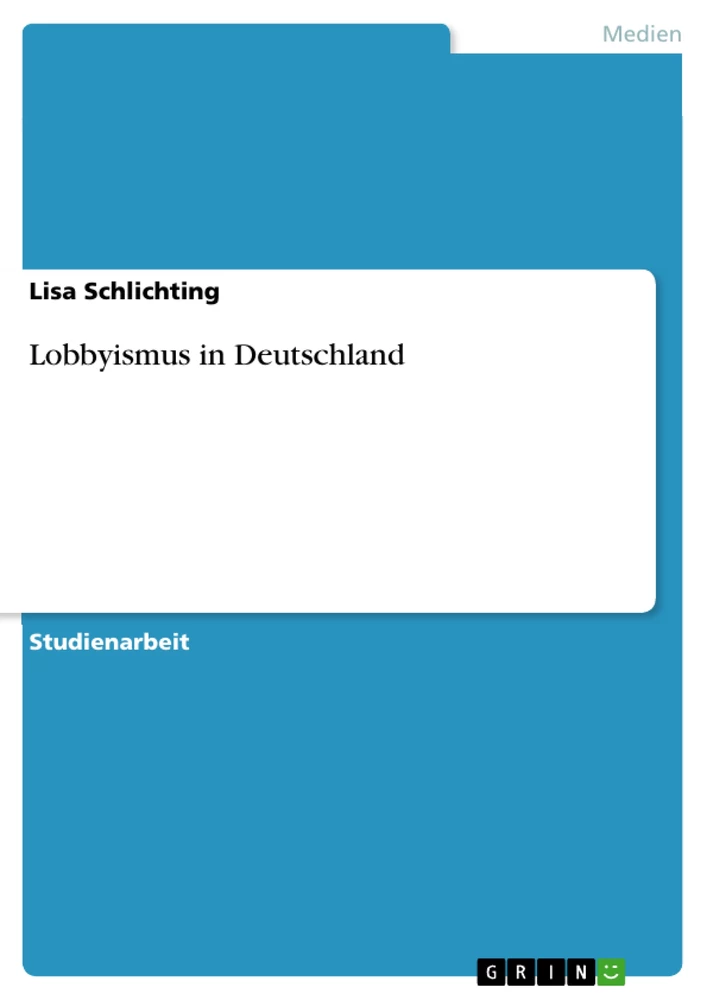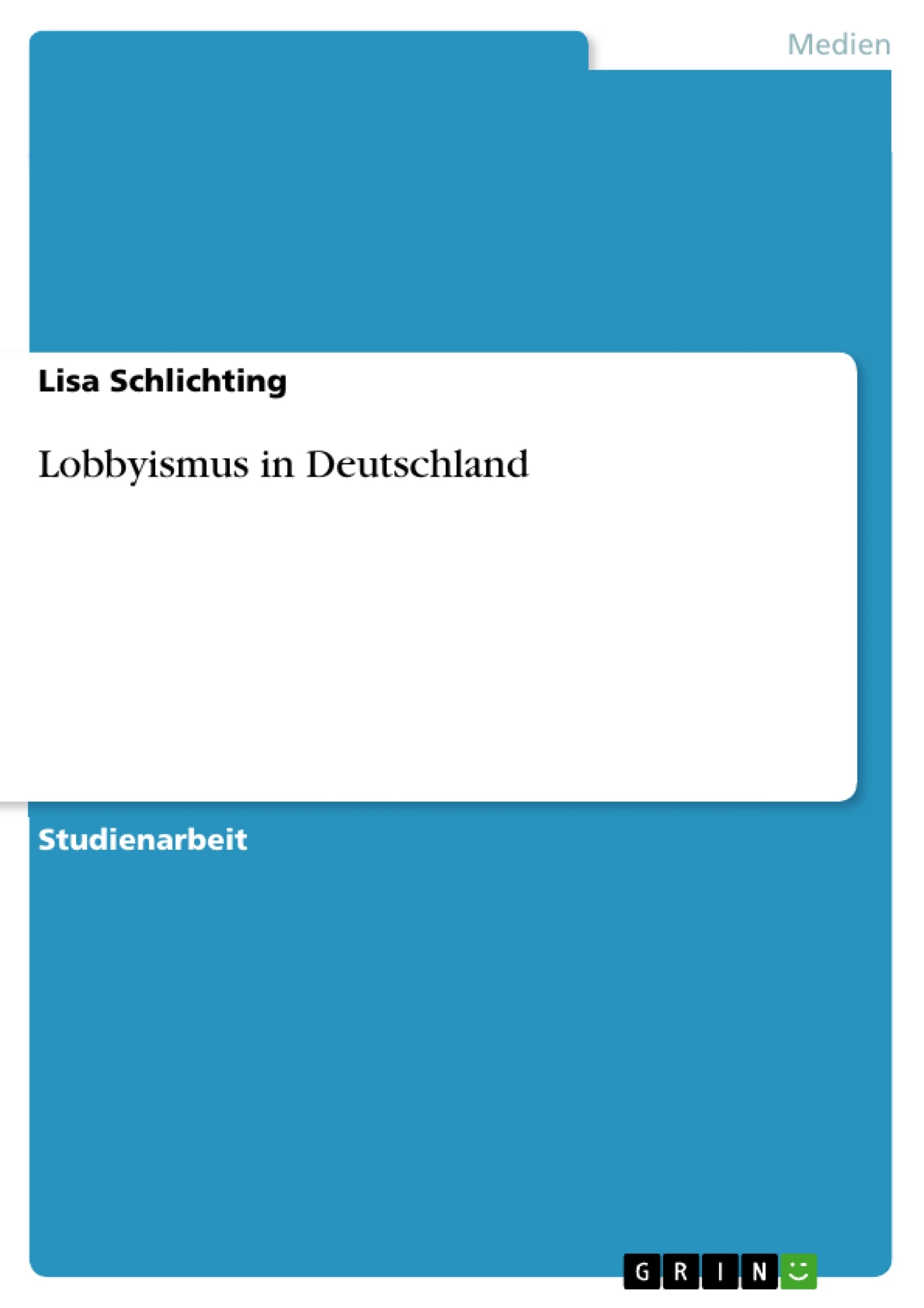Im September 2013 eröffnete der weltweit größte Software-Konzern Microsoft eine Hauptstadtrepräsentanz in Berlin. Einen wesentlichen Bereich nimmt innerhalb der Repräsentanz die Public Affairs Abteilung des Unternehmens ein. Doch was verspricht sich ein Weltunternehmen davon mit einer Public Affairs Abteilung im Politikzentrum vertreten zu sein? Und inwieweit spielt dabei die direkte politische Interessenvertretung also Lobbyismus bzw. Lobbying eine Rolle?
Um diese exemplarische Entwicklung, hinter der ein struktureller sowie personeller Wandel im Lobbyismus steht, näher erklären zu können wird im ersten Teil eine grundlegende Definition der beiden Begriffe Lobbying bzw. Lobbyismus und Public Affairs gegeben. Diese begrifflichen Zuordnungen sowie die einerseits bedeutenden Abgrenzungen und die andererseits partiellen Überschneidungen der beiden Begriffe bilden die Basis und sollen als stabiles Fundament dienen, um im weiteren Verlauf auf den personellen (bezogen auf die drei signifikantesten Akteursfelder) sowie strukturellen Wandel (bezogen auf den Prozess der Professionalisierung und Europäisierung) eingehen zu können. Hierbei ist festzuhalten, dass Lobbying ein Element der Public Affairs darstellt und Public Affairs weitgreifender auch öffentlichkeitsbezogene Inhalte vermittelt und somit oftmals mit Public Relations in Verbindung gebracht wird. Neben den Beschreibungen der beiden Begriffe und ihrer Beziehung zueinander werden weiterhin ihre Funktionen erläutert und es wird ebenfalls auf die Problematik der mangelnden Transparenz und Glaubwürdigkeit eingegangen, auf welches in Kapitel drei spezifischer Bezug genommen wird.
Im Anschluss bildet Abschnitt zwei „Wandel des Lobbyismus“ den Kern dieser Arbeit. Der Wandel des Lobbyismus in allen seinen Dimensionen wird zeitlich oftmals mit dem Regierungswechsel von Bonn nach Berlin verbunden. Es sind Veränderungen im lobbyistischen Akteursfeld, genauer: die „[...] Expansion und Pluralisierung des Systems organisierter Interessen[...]“ , welches als Folge gesellschaftlicher, ökonomischer, politischer und ökologischer Modernisierungsprozesse zu begründen ist, zu beobachten. Dabei haben es traditionelle Verbände zunehmend schwerer die heterogenen Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten und verlieren kontinuierlich an Mitgliedern und somit auch erheblich an Einflusspotenzial.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Lobbyismus
2.1 Lobbyismus und seine Grenzen
2.2 Lobbyismus als Teil der Public Affairs
3. Wandel des Lobbyismus
3.1 Erosion des Korporatismus: das Problem der Interessenverbände
3.2 Interne Konzernrepräsentanzen im Politikzentrum Berlin
3.3 Auftragslobbying: die externen Lobbying-Dienstleister
3.4 Professionalisierungs- und Europäisierungsprozess
4. Ausblicke und Trends im Lobbyismus
4.1 Exemplarische Entwicklungen im Finanzlobbyismus
4.2 Ansätze zur Regulierung
5. Schlussbetrachtung
6. Literaturverzeichnis