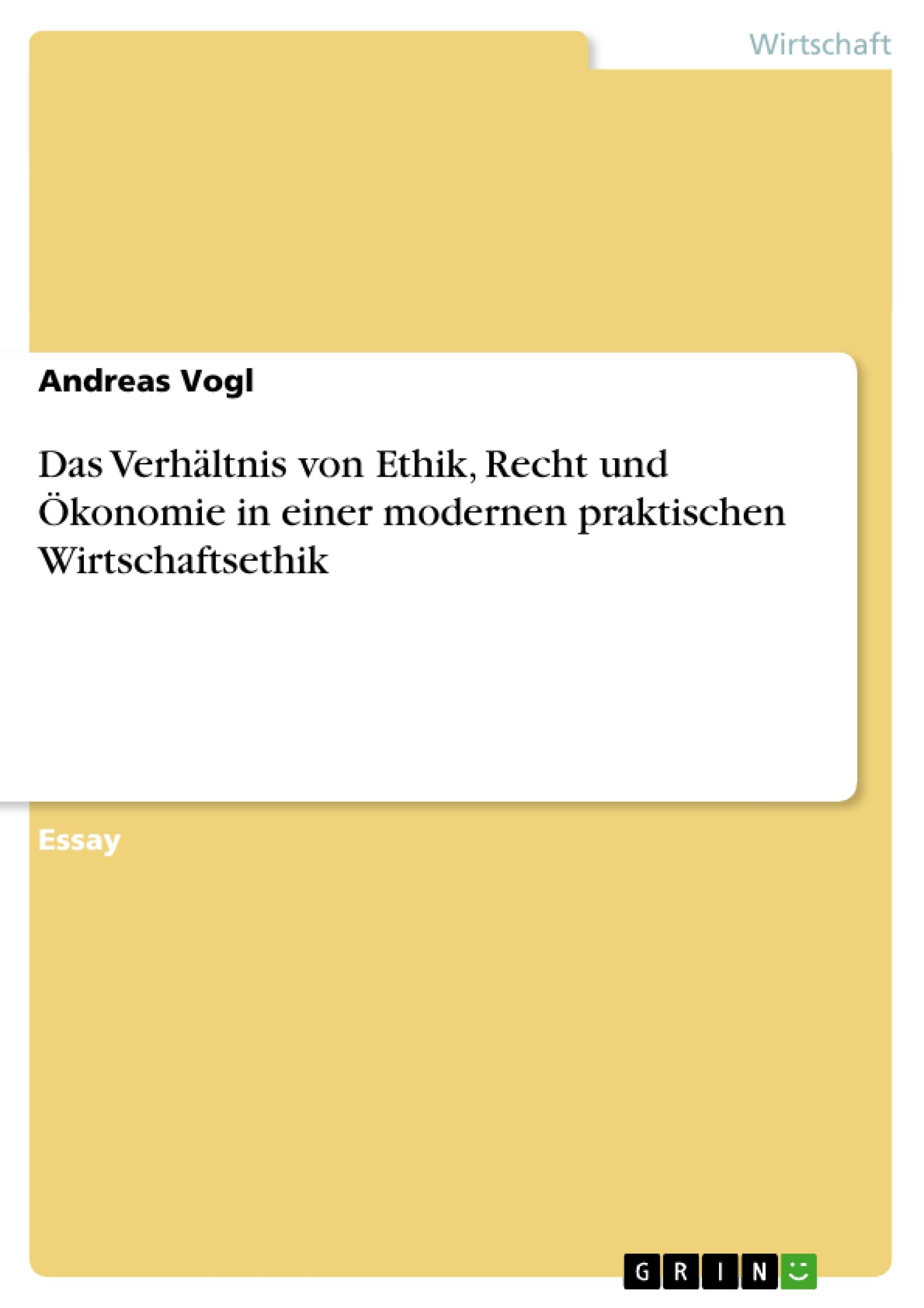Durch den technologischen Fortschritt in den letzten Jahrzehnten kam es zu einem rasanten Wandel in der Weltwirtschaft. Die Globalisierung schreitet immer weiter voran und wir Deutschen, als eine vom Export stark geprägte Nation, vollziehen, gemessen an der Anzahl der Transaktionen, wirtschaftliche Handlungen in einem noch nie dagewesenen Maße. Dabei werden häufig ethische Werte und Normen durch den unbedingten Willen der Nutzen-maximierung schlichtweg außer Acht gelassen. Warum ist das so? Fragen zur Gewinnmaximierung von Unternehmen werden in unserem Bildungssystem meines Erachtens hinreichend behandelt, jedoch Fragen zu einer modernen praktischen Wirtschaftsethik nicht. Vielleicht mehr als je zuvor ist eine moderne praktische Wirtschaftsethik, welche sich mit der moralischen Bewertung wirtschaftlicher Handlungen beschäftigt, notwendig.
In diesem Zusammenhang möchte ich mich im Folgenden mit einigen grundlegenden Fragen der Wirtschaftsethik beschäftigen. Meine primäre Intention ist dabei das Verhältnis zwischen Moral, Recht und Ökonomie schlüssig darzulegen, um ein Verständnis für sittlich-moralisch gutes Handeln zu schaffen. Meine zentrale Fragestellung lautet: Was ist notwendig um die Wirtschaft aus ethischer Sicht zu verbessern?
Das Verhältnis von Ethik, Recht und Ökonomie in einer modernen praktischen Wirtschaftsethik
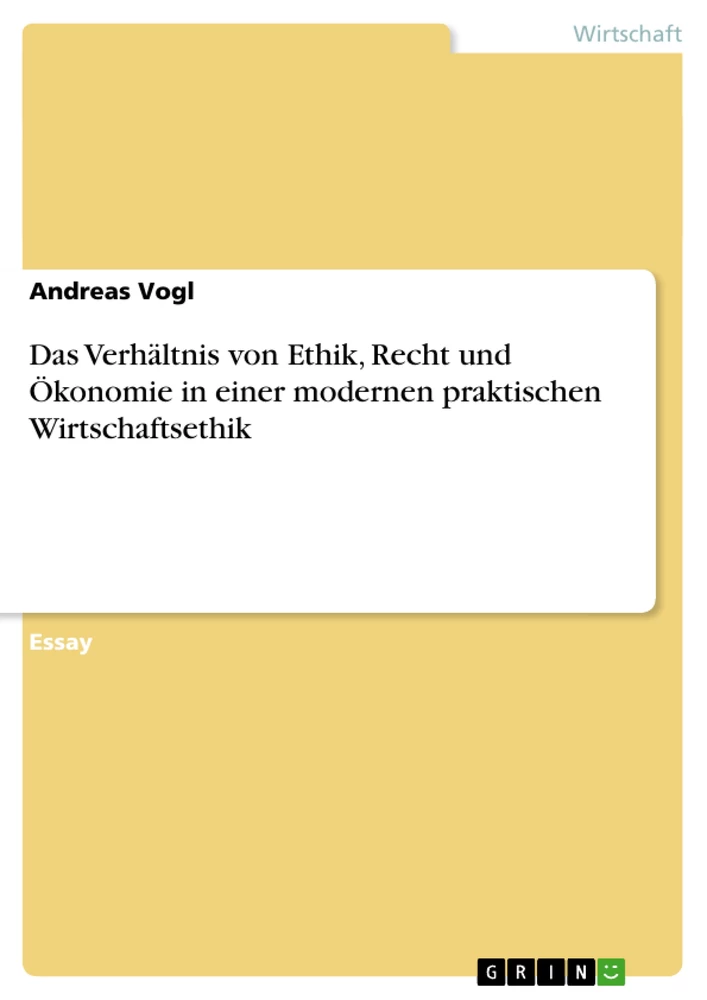
Essay , 2013 , 9 Seiten , Note: 1,3
Autor:in: Master of Science (M.Sc.) Andreas Vogl (Autor:in)
BWL - Unternehmensethik, Wirtschaftsethik
Leseprobe & Details Blick ins Buch