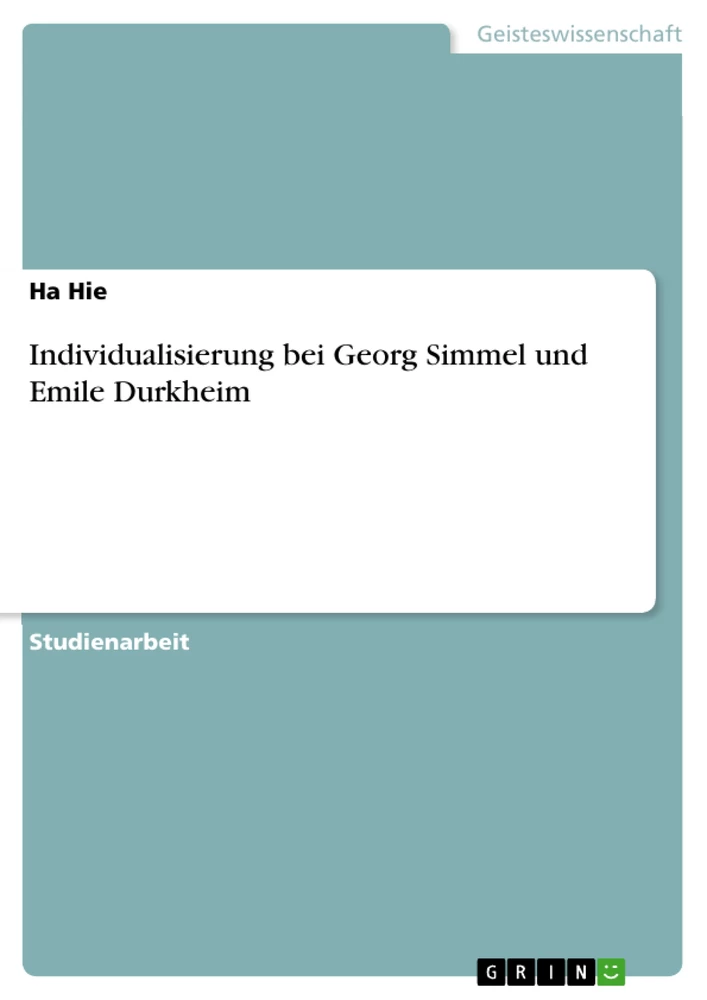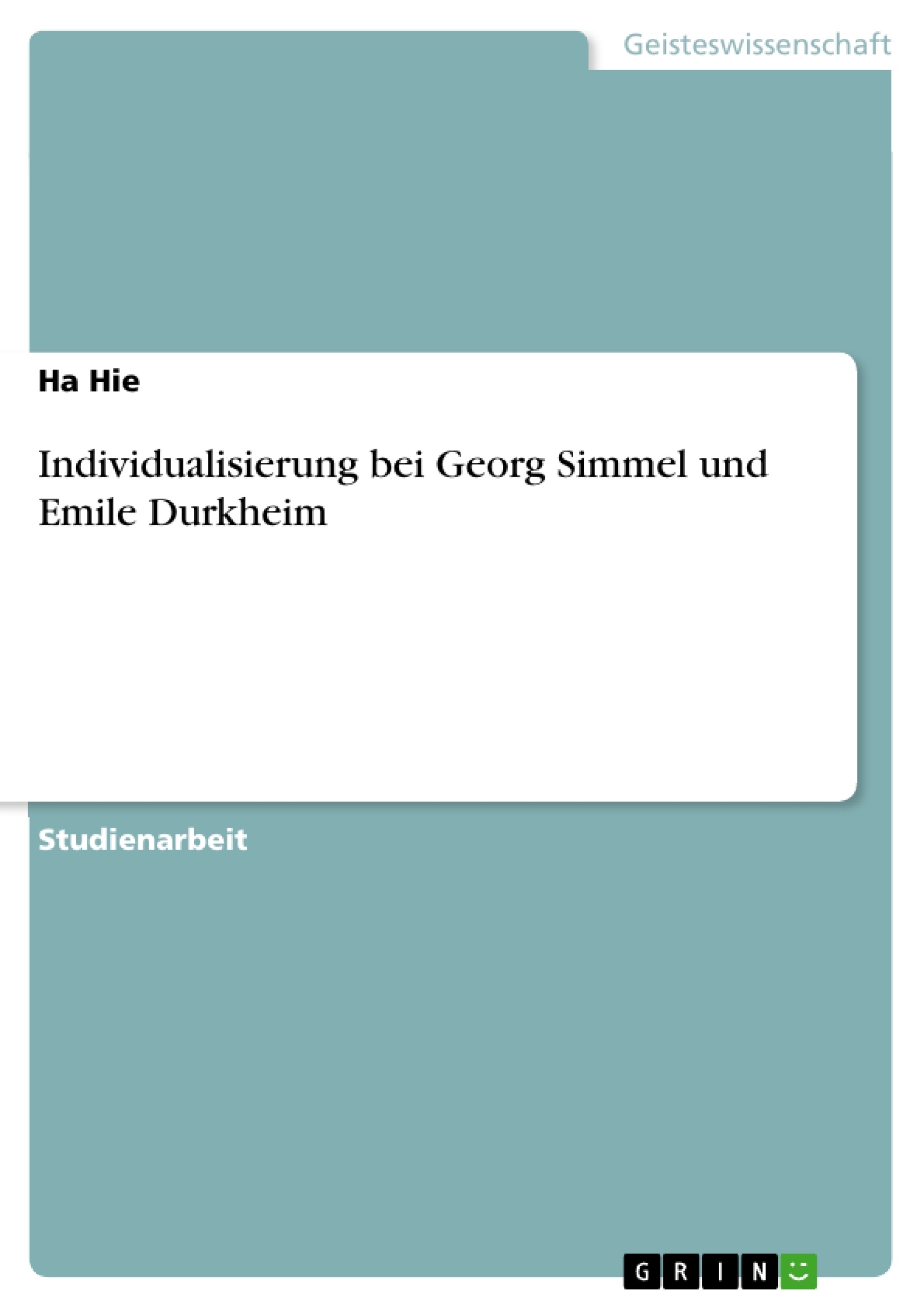Individualisierung als Schlagwort begegnet einem längst nicht mehr in vorwiegend soziologischen Kontexten. Es dient in den verschiedensten Bereichen als ein positiv konnotierter Begriff für Konzepte, die den Fokus auf die Persönlichkeit des einzelnen Menschen legen. Damit ist die inhaltliche Präzisierung von Individualisierung im aktuellen Sprachgebrauch scheinbar schon erschöpft. Individualisierung kann sowohl als Leitbild für sonderpädagogische Einrichtungen, als Mittel zur Kundenbindung oder zur Steigerung des Lernerfolgs bei Schülern und als Arbeitsteilungsmodell herangezogen werden, um nur einige Beispiele zu nennen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Individualisierung bei Durkheim
2.2. Von der mechanischen zur organischen Solidarität
2.3. Die krankhafte Entwicklung der Individualisierung
2.4. Fazit: Erziehung zum moralischen Individualismus
3. Individualisierung bei Simmel
3.1. Das Individuum und die Gesellschaft
3.2. Die Motoren der Individualisierung: Geld und Großstadt
3.3. Fazit: Synthese von quantitativem und qualitativem Individualismus
4. Kontrastierung der beiden Theorien
4.1 Gemeinsamkeiten
4.1.1 Gründe der Individualisierung
4.1.2. Veränderung der sozialen Beziehungen
4.1.3. Individualisierung als Emanzipation
4.1.4. Individualisierung als Ohnmacht
4.2 Unterschiede
4.2.1. Optimismus und Ambivalenz
4.2.2. Zwei Arten des Individualismus
4.2.3. Lösungsansatz
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis