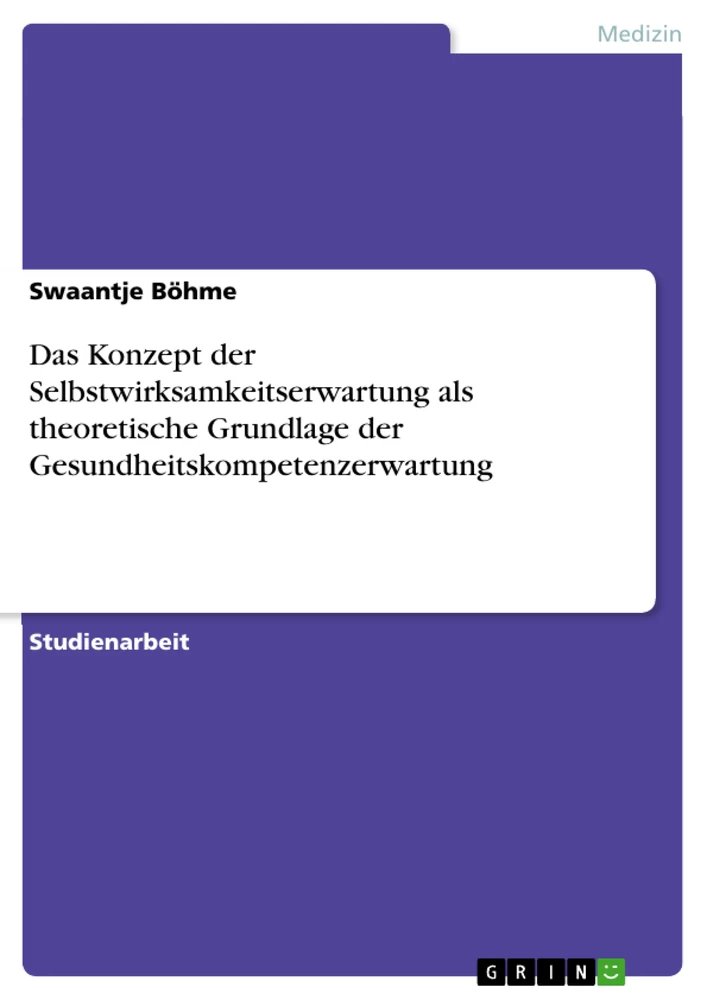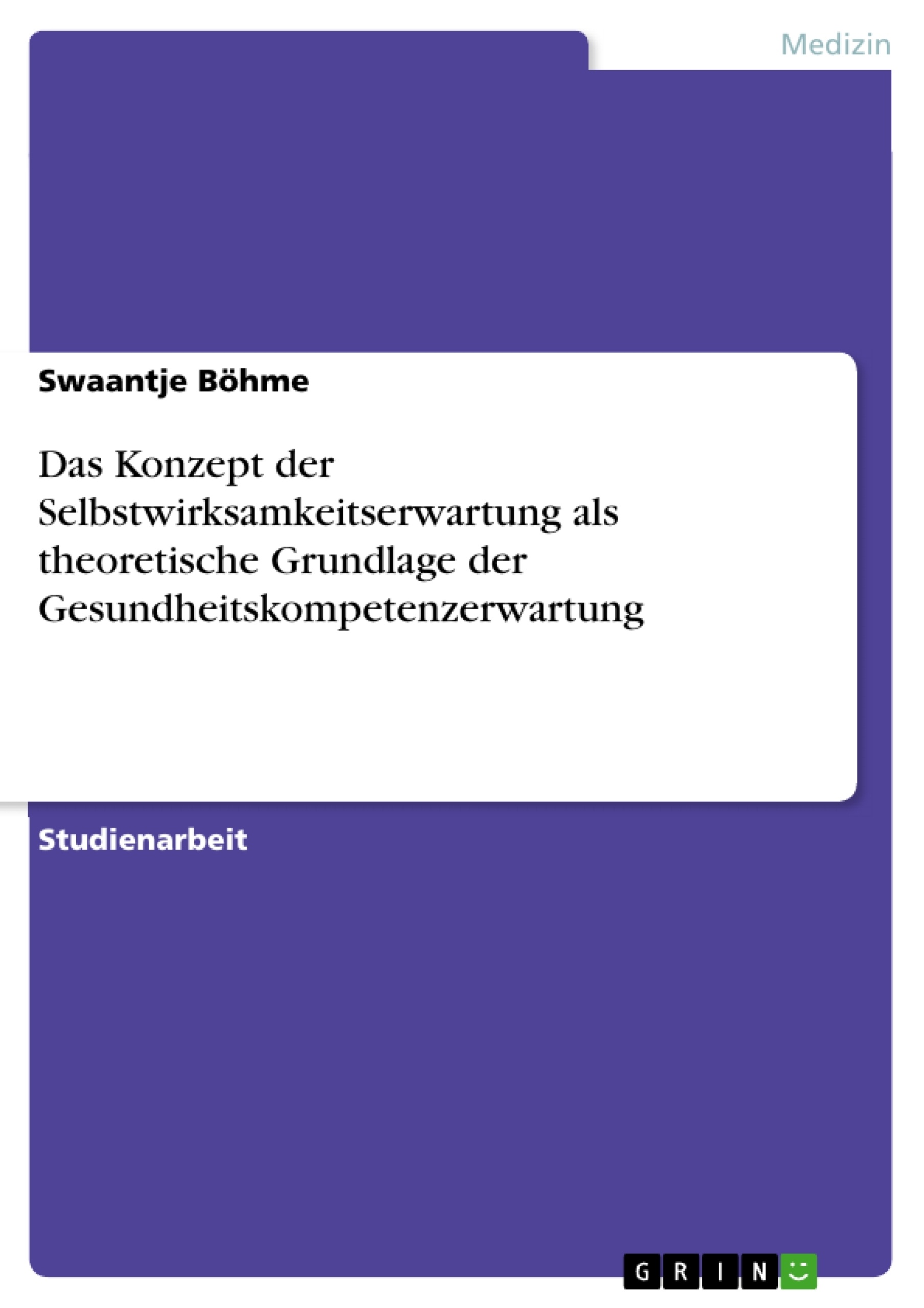In dieser Arbeit wird das bedeutsame Thema der Selbstwirksamkeitserwartung näher unter dem Aspekt der Gesundheitskompetenz nach Wieland beleuchtet. Gesundheit und damit auch die Gesundheitskompetenzerwartung nimmt in der heutigen Gesellschaft, welche durch die hohe Gewichtung dieser Themen auch als Gesundheitsgesellschaft bezeichnet werden kann, immer mehr an Bedeutung zu (vgl. Kickbusch, 2006). Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, dem Leser die beiden Konzepte, die Selbstwirksamkeits- und die Gesundheitskompetenzerwartung, näher zu bringen und die gemeinsamen Grundlagen aufzuzeigen. Die Arbeit besteht aus zwei Oberthemen, welche sich in unterschiedliche Unterthemen aufgliedern. Das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung wird zunächst in Abschnitt 2 beschrieben. Anschließend werden die Arten und Dimensionen der Selbstwirksamkeit, mit den Auswirkungen steigender und absinkender Selbstwirksam-keitserwartungen, sowie die Selbstwirksamkeitsdynamik vorgestellt. Neben den vier Einflussfaktoren wird auch auf die Bedeutung der Rahmenbedingungen, sowie der Nahzielen eingegangen. Im Abschnitt 3 wird das Konzept der Gesundheitskompetenzerwartung beschrieben. Neben der Vor-stellung verschiedener Definitionen, erfolgt an gegebener Stelle die Spezialisierung auf die Definition der Gesundheitskompetenz nach Wieland (2007, 2008). Zuletzt werden der Fragebogen zur Gesundheitskompetenzerwartung und die daraus resultierenden geschlechtsspezifischen Ergebnisse vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Selbstwirksamkeitserwartung - Eine Begriffsbestimmung
2.1 Die Arten und Dimensionen der Selbstwirksamkeitserwartung
2.1.1 Die Dimensionen der Selbstwirksamkeitserwartung
2.1.2 Die Arten der Selbstwirksamkeitserwartung
2.2 Selbstwirksamkeitsdynamik
2.2.1 Einflussfaktoren auf die Selbstwirksamkeitserwartung
2.2.2 Die Bedeutung von Rahmenbedingungen und Nahzielen
3. Gesundheitskompetenzerwartung - Ein Konzept viele Definitionen
3.1 Gesundheitskompetenzerwartung nach Wieland
3.2 Geschlechtsspezifische Gesundheitskompetenz
4. Fazit
Literatur