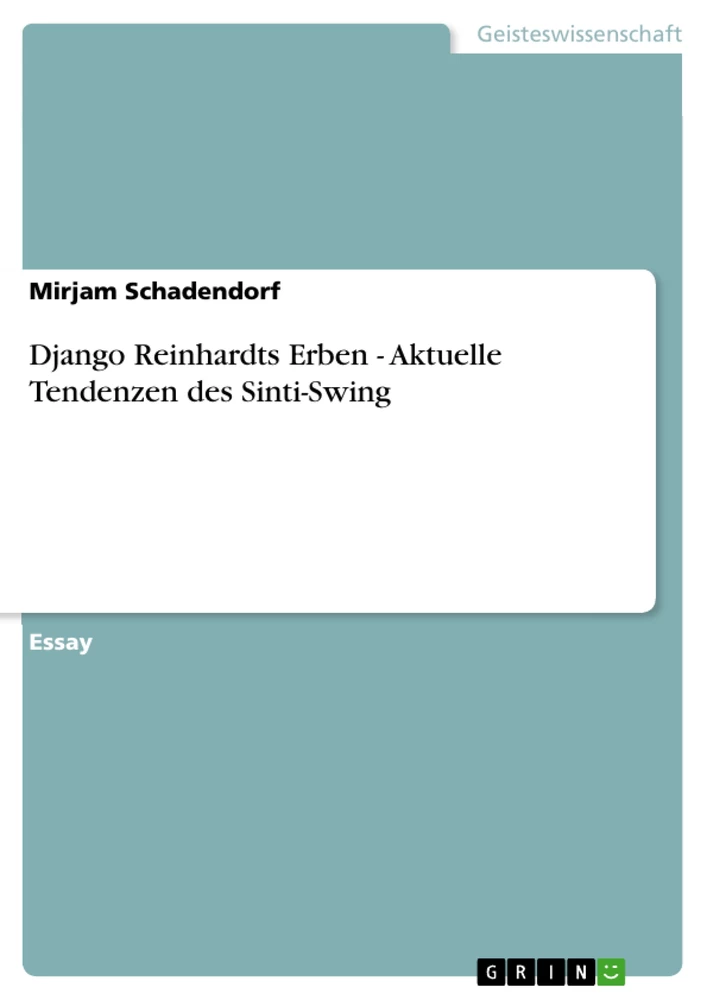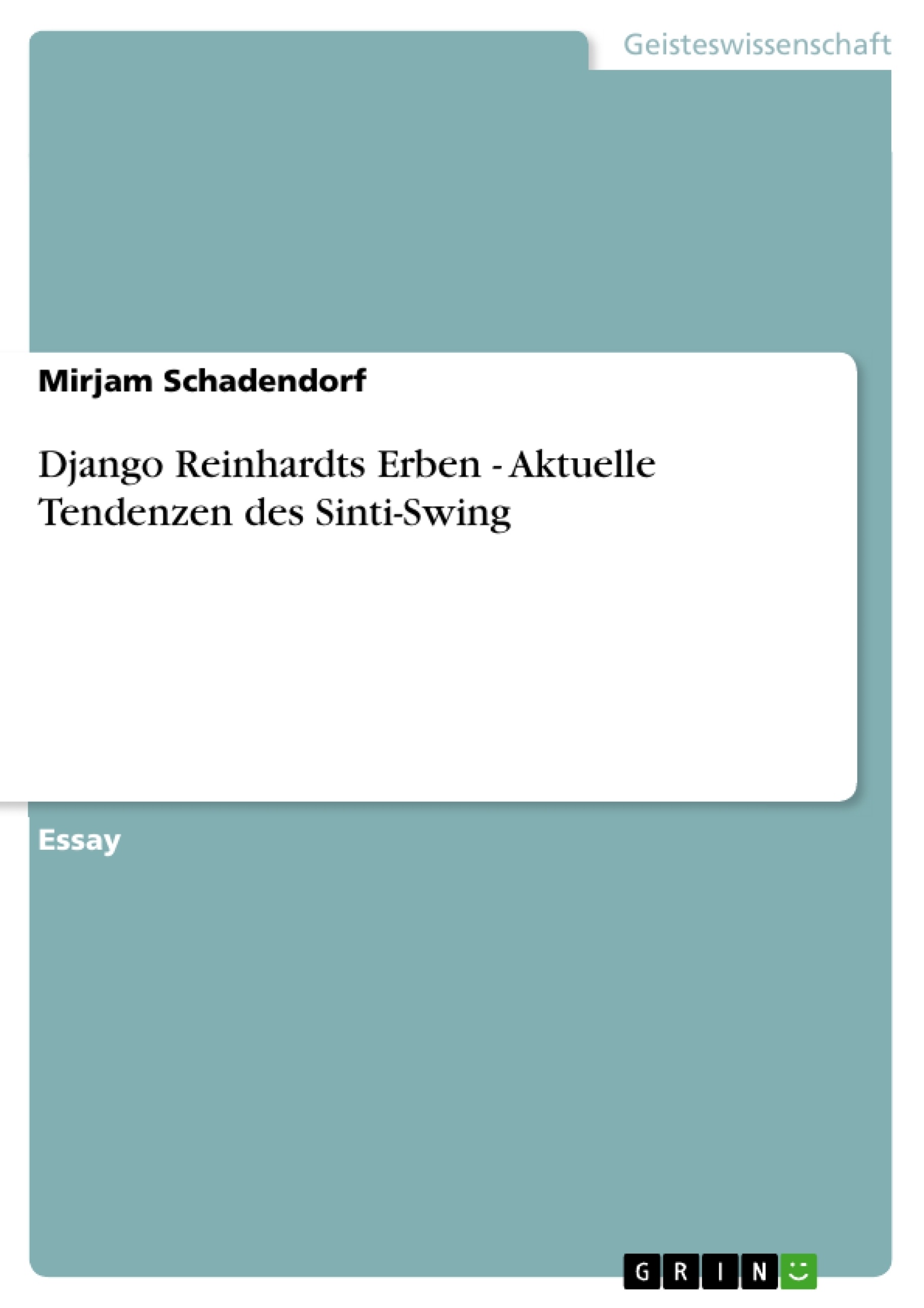In den 30er Jahren des 20. Jahrhundert prägte Django Reinhardt gemeinsam mit dem Geiger Stéphane Grapelli den Sintiswing. Im Pariser "Hot Club de France" begründete er eine ganz eigene, nationale Tradition des Jazz, die ungeheuer erfolgreich wurde. Doch nach dem Krieg und Django Reinhardts frühem Tod wurde es ruhig um den Sintiswing. Erst in den 70er Jahren setzte eine Veränderung ein; Sinti und Roma begannen Django Reinhardts Stil als Identifikationobjekt für sich zu entdecken. Und so ist es kein Wunder, dass seit den 80er Jahren wieder sehr gut ausgebildete und hoch begabte Jazzgitarristen den Sintiswing für sich entdeckten. Wawau Adler, Diknu Schneeberger, Gismo Graf und Andreas Varady haben in den letzten zehn Jahren ein großes Publikum begeistert und das Interesse an dem fast vergessenen Gitarrenstil neu geweckt. Gleichzeitig haben sie aber auch - ihrem Alter entsprechend - Django Reinhardts Stil bereichert, verändert und ihm neue Elemente hinzugefügt.
Der Essay umfasst einen historischen Abriss zur Entstehung des Sintiswing und stellt dann vier Gitarristen und einen Geiger vor. Es ergibt sich ein lebendiges Bild der aktuellen Situation des Sintiwsing.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Das Geheimnis der Tradition
Die Geburtsstunde des Sinti-Swing
Ein Vermächtnis für die Nachwelt
Markus Reinhardt
Wawau Adler
Ein unverhofftes Talent
Gismo Graf
Irisch-ungarische Koproduktion
Wunderbare Haltung