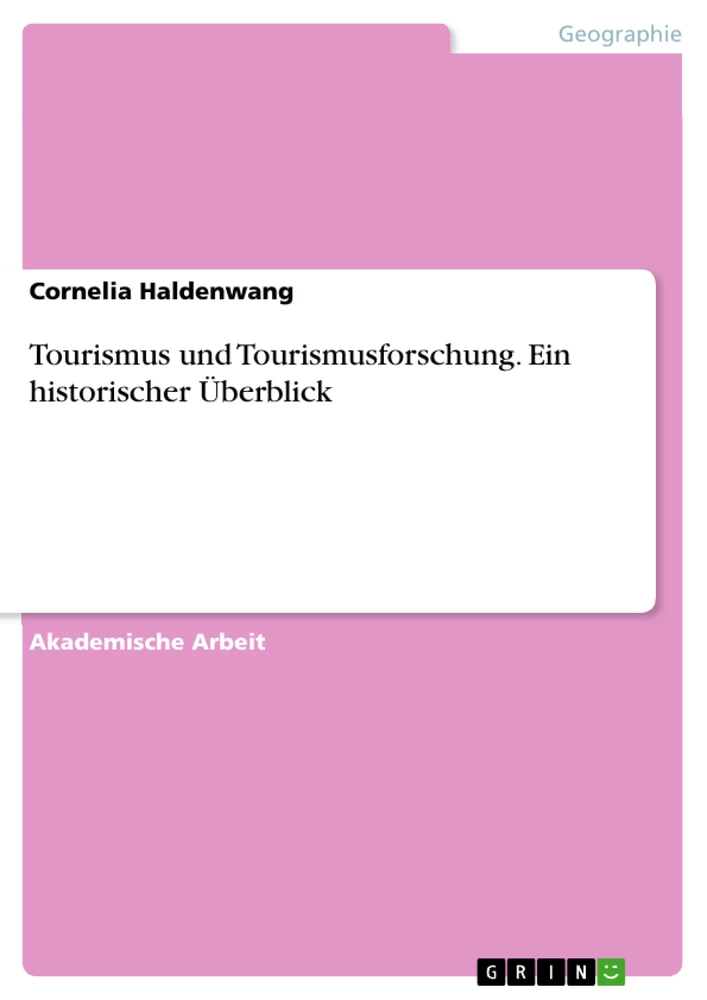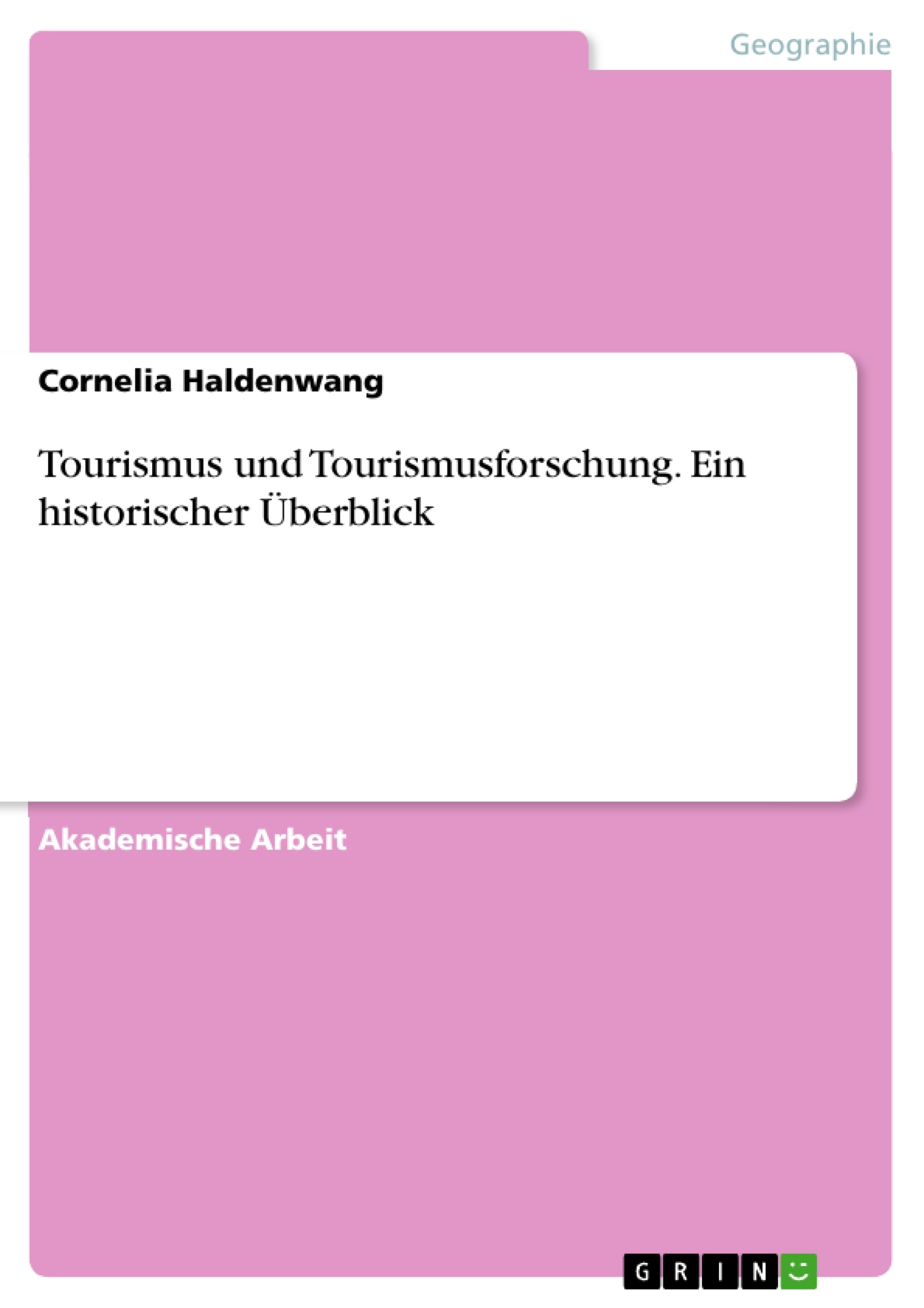Der Ursprung des Wortes „Tourismus“, geht auf das Wort „tornus“ aus dem Lateinischen und auf das griechische Wort „tornos“ zurück, die mit den Begriffen Rundgang, Zirkel oder Wiederholung übersetzt werden können. Durch diese Herleitung wird der wiederkehrende, sich jährlich wiederholende Aspekt des Tourismus betont.
Die folgende Arbeit soll die historische Entwicklung des Tourismus wiedergeben. Deshalb wird der Tourismus zunächst in den unterschiedlichen Epochen der Antike und des Mittelalters, sowie die Anfänge des Massentourismus im 18. und 19. Jahrhundert betrachtet. Danach werden die Entwicklungen im 20. Jahrhundert sowie heute widergegeben.
Abschließend wird sich noch einmal ein größerer Punkt der Tourismusforschung und dem aktuellen Forschungsstand selbst widmen.
Inhaltsverzeichnis
1. Definition von Tourismus
2. Historischer Abriss der Tourismusentwicklung
Tourismus in der Antike
Tourismus im Mittelalter
Tourismus im 18. und 19. Jahrhundert – Anfänge des Massentourismus
Tourismus des 20. Jahrhunderts
Aktuelle Entwicklungen im Tourismus
3. Forschungsstand
Literaturverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur)