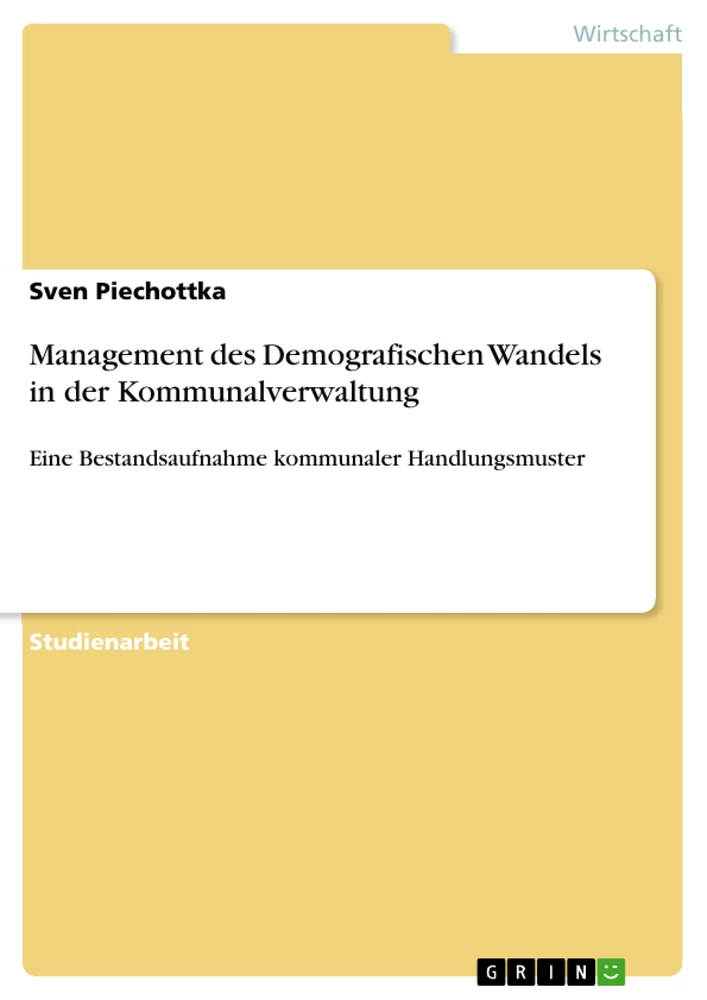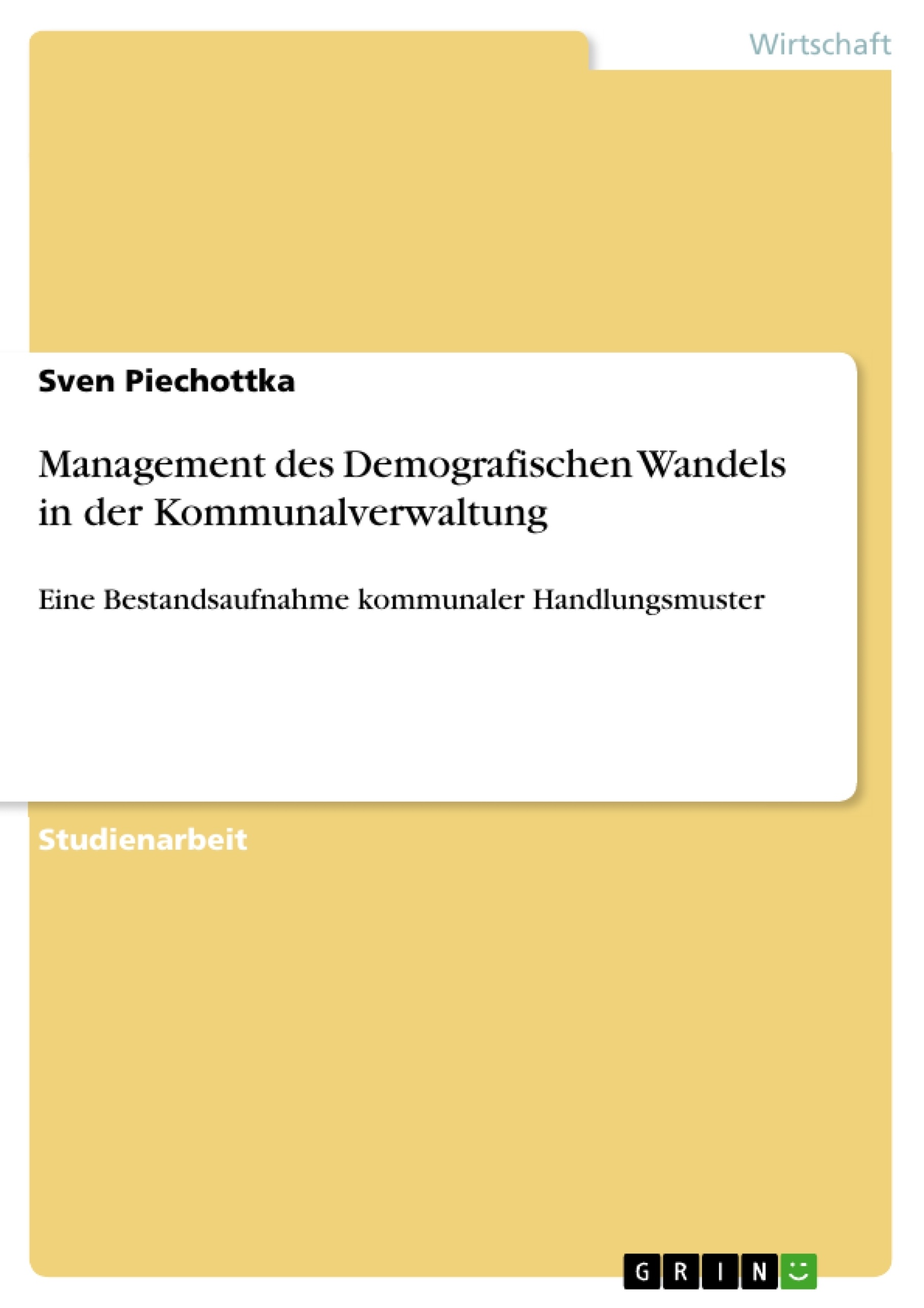Welche Maßnahmen wenden die Personalverwaltungen der Kommunen zur Bewältigung der Herausforderungen des demografischen Wandels an und lassen sich gegebenenfalls Trends im kommunalen Demografiemanagement erkennen?
In den letzten Jahren hat die Diskussion schließlich auch den öffentlichen Sektor erreicht. Die einleitenden Fragen kursieren somit am wissenschaftlichen „Puls der Zeit“. Im Oktober 2012 veröffentlichte die Unternehmensberatung McKinsey eine Studie, welche der öffentlichen Verwaltung schwerwiegende demografische Defizite attestierte: jeder vierte Beschäftigte ei-ner Landesverwaltung erwarte in den nächsten Jahren die Verrentung, nur jeder achte sei im Schnitt jünger als dreißig Jahre. Vor allem bei Fachkräften und Führungspositionen seien Nachwuchsprobleme absehbar.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Forschungsstand
3. Demografischer Wandel auf kommunaler Ebene
3.1. Demografische Veränderungen: ein Problemaufriss
3.2. Der Öffentliche Dienst auf kommunaler Ebene
3.3. Auswirkungen des Wandels auf kommunale Personalverwaltungen
4. Fallbetrachtungen
4.1. Wachstum und Alterung: Mannheim, Oldenburg und Köln
4.2. Schrumpfung und Alterung: Landkreise der ländlichen Region
5. Synopsis
5.1. Zusammenfassung
5.2. Diskussion
6. Literaturverzeichnis
7. Anhang
8. Abkürzungsverzeichnis: