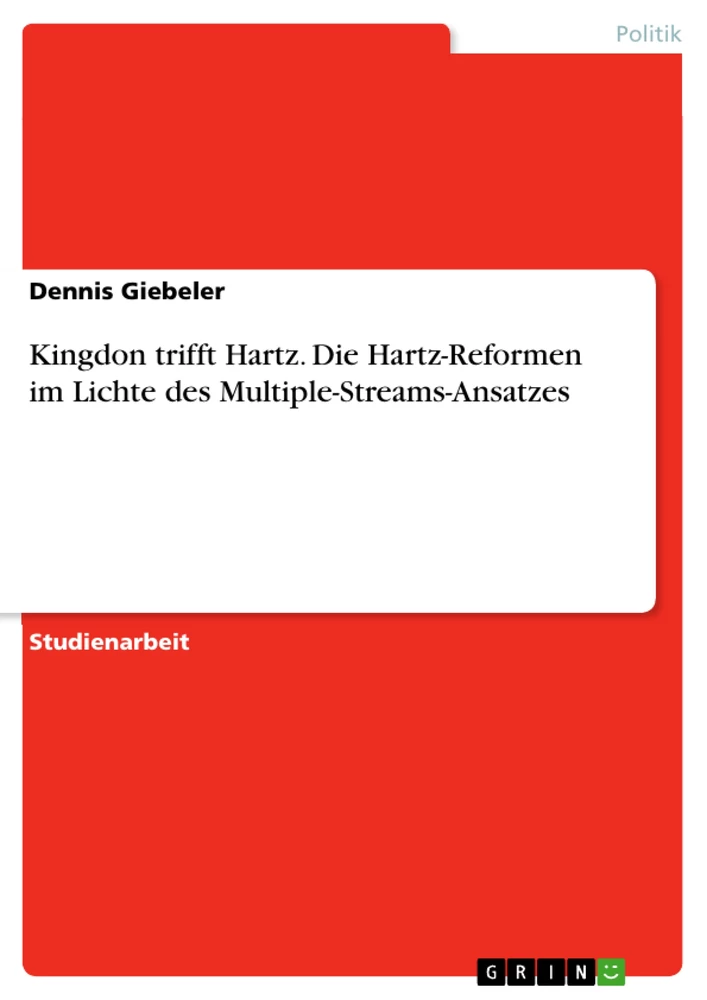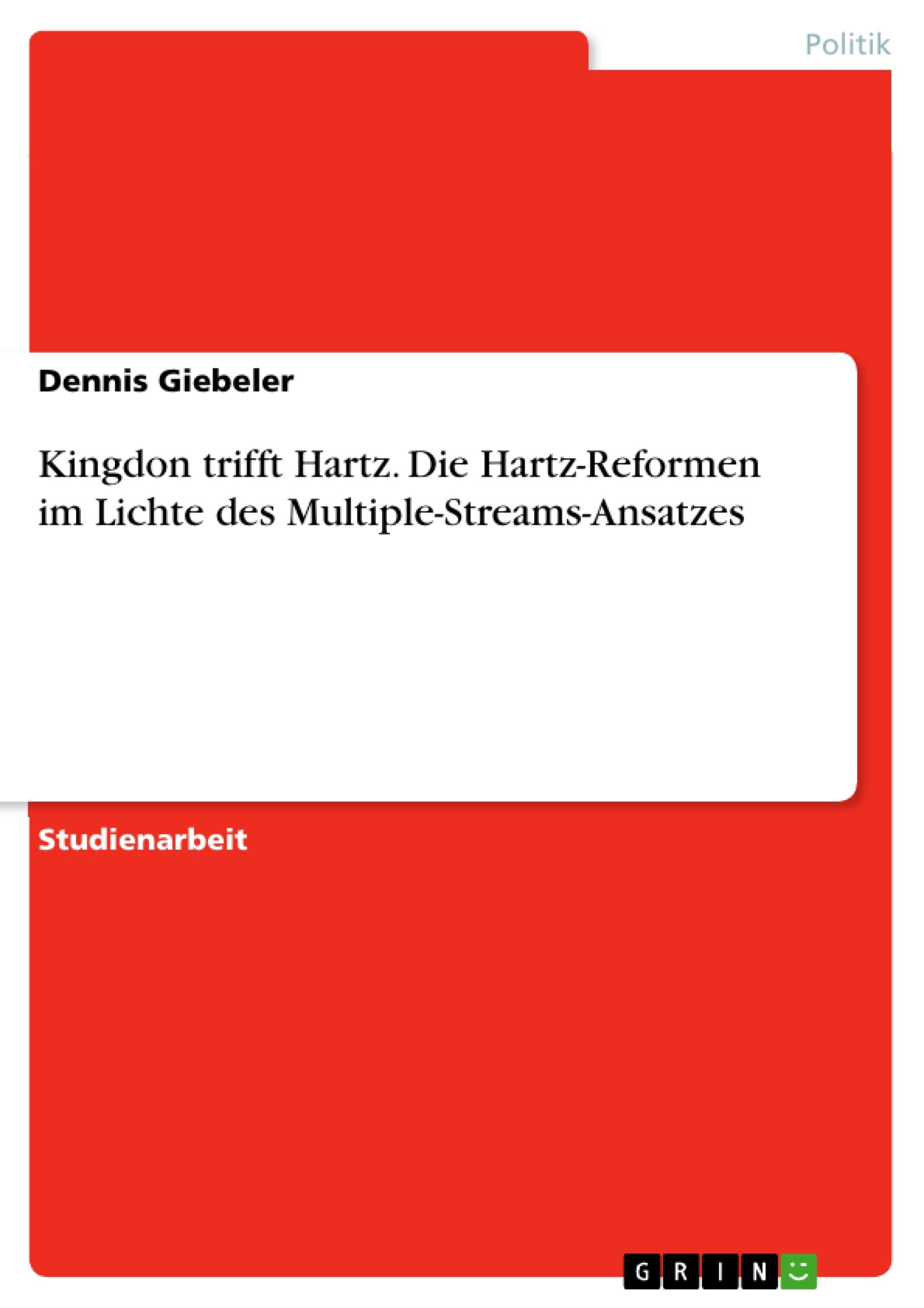Mit dem Einsetzen der Hartz-Kommission 2002 begann ein Veränderungsprozess, der die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik der Bundesrepublik Deutschland nachhaltig prägen sollte. Aufmerksamkeit gewann dieses Ereignis nicht nur aufgrund der deutlichen Problematik der hohen Arbeitslosenzahlen, sondern auch durch eine Reihe anderer Charakteristika, beispielsweise die außergewöhnliche Zusammensetzung der Hartzkommission, ihre Verknüpfung mit Schröders Wahlkampfversprechen oder die Reichweite der daraus resultierenden Reformen. Betrachtet man die Folgen der Arbeit der Kommission wie die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe oder die Verschärfung der Zumutbarkeitskriterien, drängt sich die Frage auf, wie diese Reformen möglich gewesen sind. Beschäftigt man sich näher mit den Prozessen rund um „Hartz“, so wird deutlich, dass Reformen dieser Reichweite unter „normalen“ Umständen gar nicht möglich gewesen wären. Warum aber waren die Umstände in diesem Fall nicht „normal“, was machte die Zeit reif für die Ermöglichung solcher Reformen und warum scheiterten andere Reformversuche? Auf diese und mehr Fragen, versucht der Multiple Streams Ansatz (MSA) nach Kingdon Antworten zu geben. In Kingdons Worten ausgedrückt ist eine der zentralen Fragen: „How does an idea´s time come?“. In der vorliegenden Arbeit soll deutlich gemacht werden, wie die Hartzreformen auf den Weg gebracht werden konnten und welche Punkte die dazugehörigen Entscheidungsprozesse beeinflusst haben. Dabei sollen die einzelnen Elemente der Hartzreformen mit Hilfe des MSA isoliert und gedeutet werden.
Im Folgenden wird zunächst die Basis für diese Arbeit gelegt, indem das dem MSA zugrundeliegende Garbage-Can-Modell vorgestellt wird. Anschließend werden in Kapitel 3 grundlegende Annahmen des MSA beschrieben. Im vierten Kapitel sollen diese dann auf das Beispiel der Hartzreformen angewandt und so geprüft werden, wie hoch die Erklärungskraft des MSA in diesem Zusammenhang ist. Zwangsläufig werden aber im Verlauf dieser Arbeit auch Erklärungsschwierigkeiten auftreten, die im 5. Kapitel deshalb in Form einer Kritik am MSA aufgegriffen werden. Dabei soll auch ein kurzer Vergleich zu anderen Modellen gezogen werden, um so die Stärken und Schwächen des MSA deutlicher hervorstellen zu können. Das letzte Kapitel wird in Form der Abschlussbetrachtung einige wichtige Punkte der Arbeit nochmals aufgreifen, sowie ein Fazit und einen Ausblick über die Zukunft des MSA geben.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Garbage-Can-Modell
3. Der Multiple-Streams-Ansatz nach Kingdon
4. Anwendung des Multiple-Streams-Ansatzes auf die Hartzreformen
4.1 Problemstrom
4.2 Political Strom/Politicsstrom
4.3 Policystrom
4.4 Policyfenster, Policyentrepreneur, Policyentscheidungen
5. Kritik des Multiple-Streams-Ansatzes und Vergleich mit anderen Modellen
6. Abschlussbetrachtung
7. Quellenverzeichnis