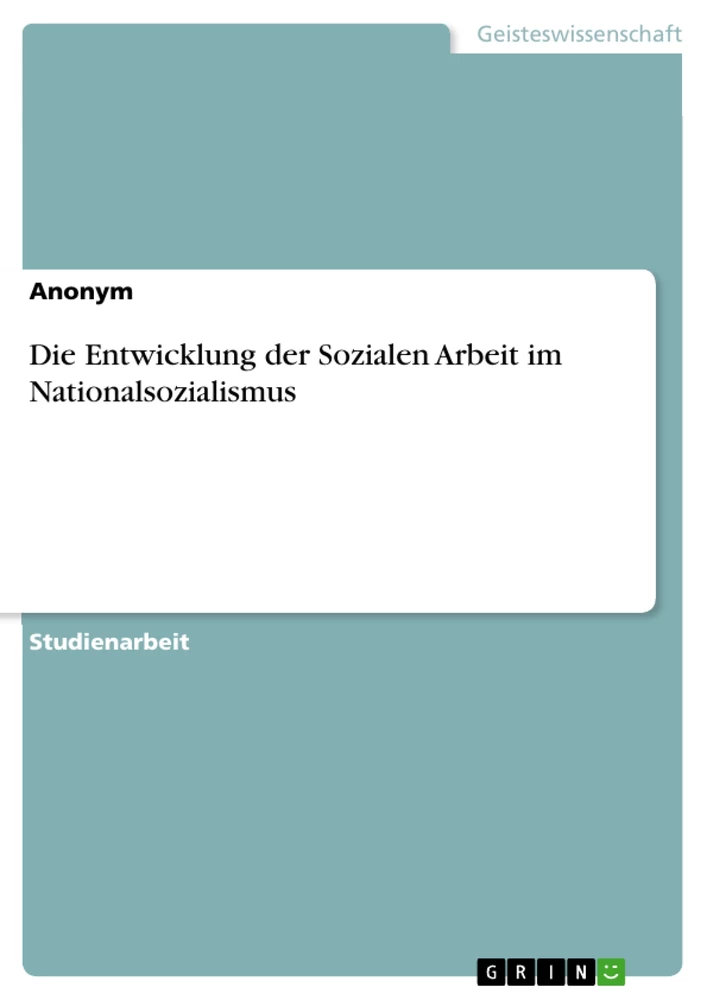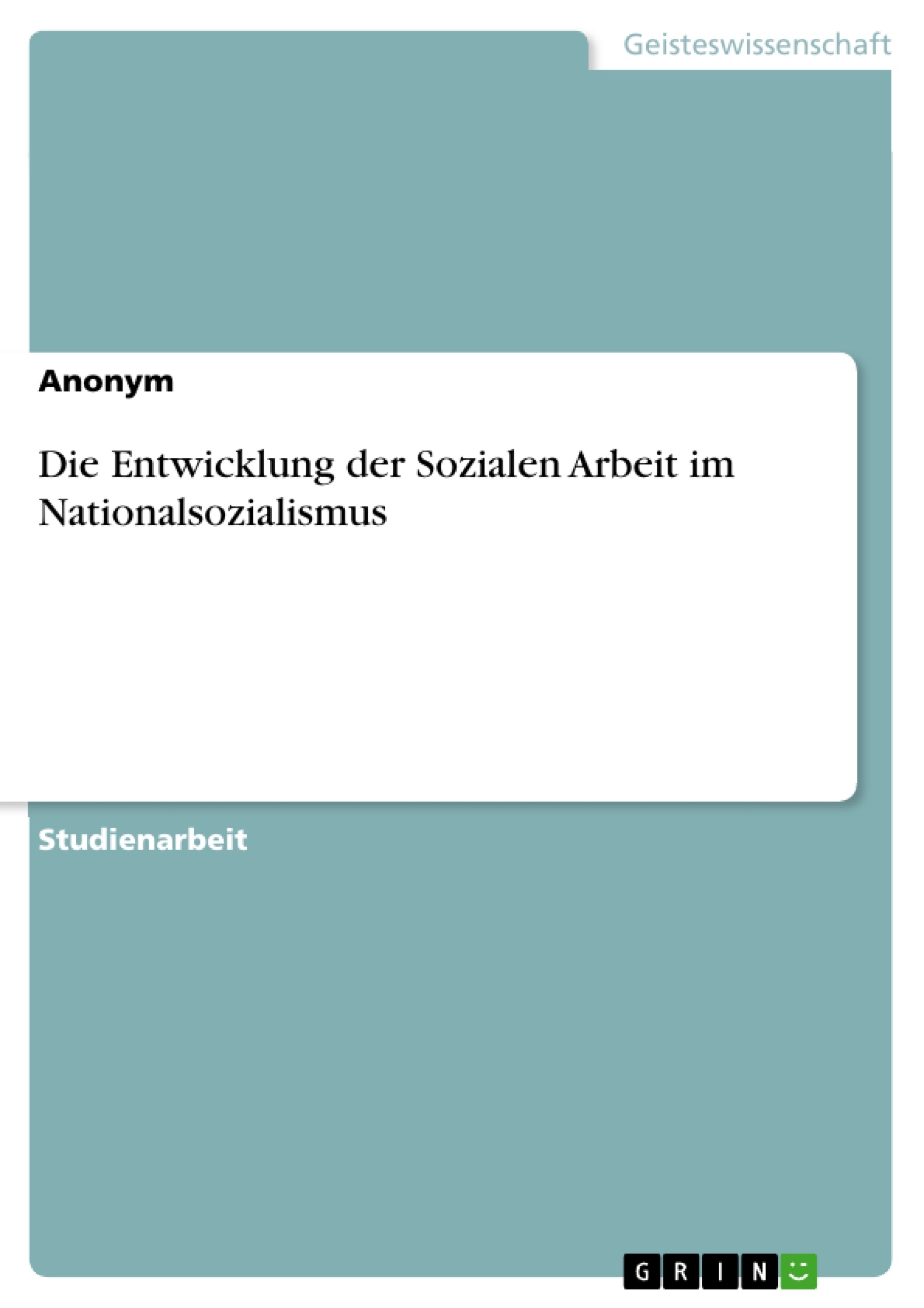Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Wandel der Sozialen Arbeit im Nationalsozialismus, ausgehend von deren Stand in der Weimarer Republik. Unter dem Begriff „soziale Arbeit“ möchte ich im folgenden gemäß der Subsumtiomstheorie nach Albert Mühlum sowohl Handlungsfelder der Bereiche Sozialarbeit als auch der Sozialpädagogik fassen (vgl. Schilling 1997, 179). Eine spezifische Untersuchung des Wandels sämtlicher Handlungsfelder im Rahmen der Hausarbeit ist weder vorgesehen noch möglich. Die Arbeit behandelt daher vor allem den Bereich der Fürsorge, dieser ist sowohl in der Weimarer Zeit, als auch im Nationalsozialismus als „der institutionelle Kern der Sozialen Arbeit“ (vgl. Schnurr/Steinacker in Horn/Link (Hrsg.) 2011, 253) zu betrachten.Der Fokus der Arbeit liegt auf der professionellen Entwicklung der Sozialen Arbeit. Wie professionalisiert war sie zum Ende der Weimarer Republik und welchen Verlauf nahm ihre Entwicklung unter dem nationalsozialistischen System? Außerdem soll deutlich werden, wie die Soziale Arbeit für den Nationalsozialismus funktionalisiert wurde und welche Bedeutung ihr in diesem System zukam. Um einen umfassenden Einblick in die Ursachen des Wandels der Sozialen Arbeit zu erhalten, werden auch damit zusammenhängende sozialpolitische und gesellschaftliche Prozesse erläutert. Das zweite Kapitel stellt kurz die Entwicklung der Semantik sozialer Hilfe vom Mittelalter bis zum Ende des ersten Weltkriegs, sowie darauf folgend ausführlicher die Entstehung und Entwicklung der Sozialen Arbeit in der Weimarer Republik, die mit dem Ausbau eines Wohlfahrtsstaates begann, dar. Der Professionalisierungsniveau der Sozialen Arbeit in der Weimarer Republik wird unter Zuhilfenahme des Konzepts der Professionalisierung der Berufssoziologie verdeutlicht (siehe 2.2.3). Bezug nehmend auf den Stand der Sozialen Arbeit in der Weimarer Zeit wird das dritte Kapitel die Instrumentalisierung Sozialer Arbeit im Nationalsozialismus sowie die Gleichschaltung der Wohlfahrts- Ausbildung und Organisationen behandeln. Welche Auswirkung hatten die sozialpolitischen Veränderungen und ideologischen Vorstellungen im Nationalsozialismus für die Soziale Arbeit allgemein, ihre Aufgaben und ihr Professionalitätsniveau?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Anfänge Sozialer Arbeit
2.1. Armenpflege vom Mittelalter bis 1918
2.2. Soziale Arbeit/Wohlfahrtspflege in der Weimarer Republik (1918- 1933)
2.2.1. Selbstbild und Adressaten der Sozialen Arbeit
2.2.2. Rechtliche Entwicklung
2.2.3. Stand der Professionalisierung der Sozialen Arbeit
3. Soziale Arbeit im Nationalsozialismus
3.1. Die Gleichschaltung und Instrumentalisierung der Sozialen Arbeit
3.2. Selbstbild und Adressaten der Sozialen Arbeit
3.3. Rechtliche Entwicklung
3.4. Stand der Professionalisierung der Sozialen Arbeit
4. Fazit
Literatur