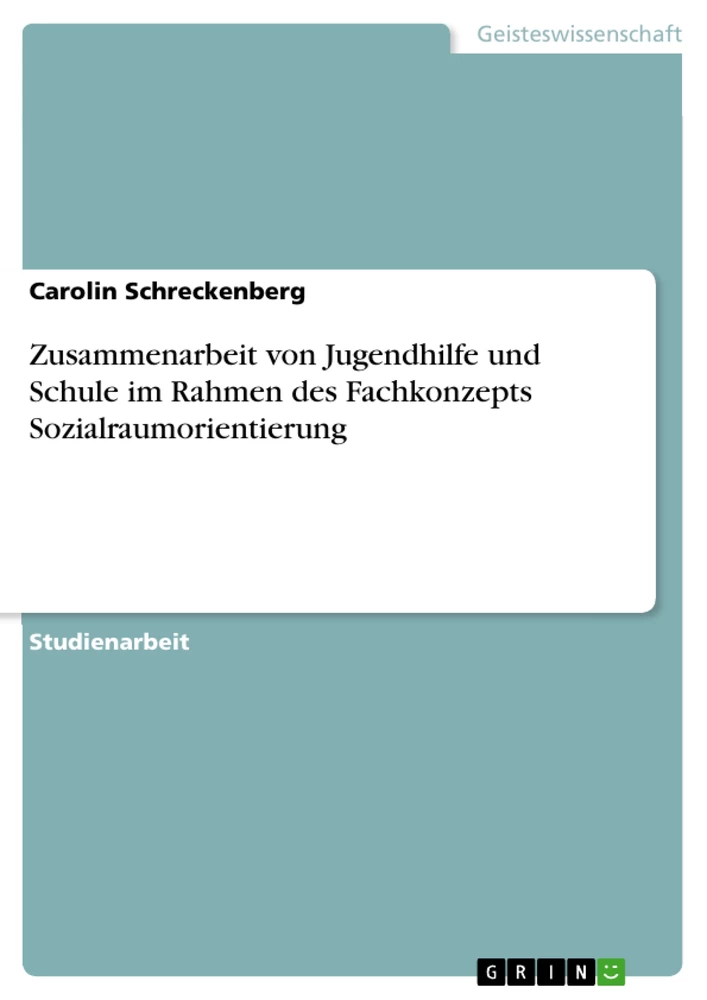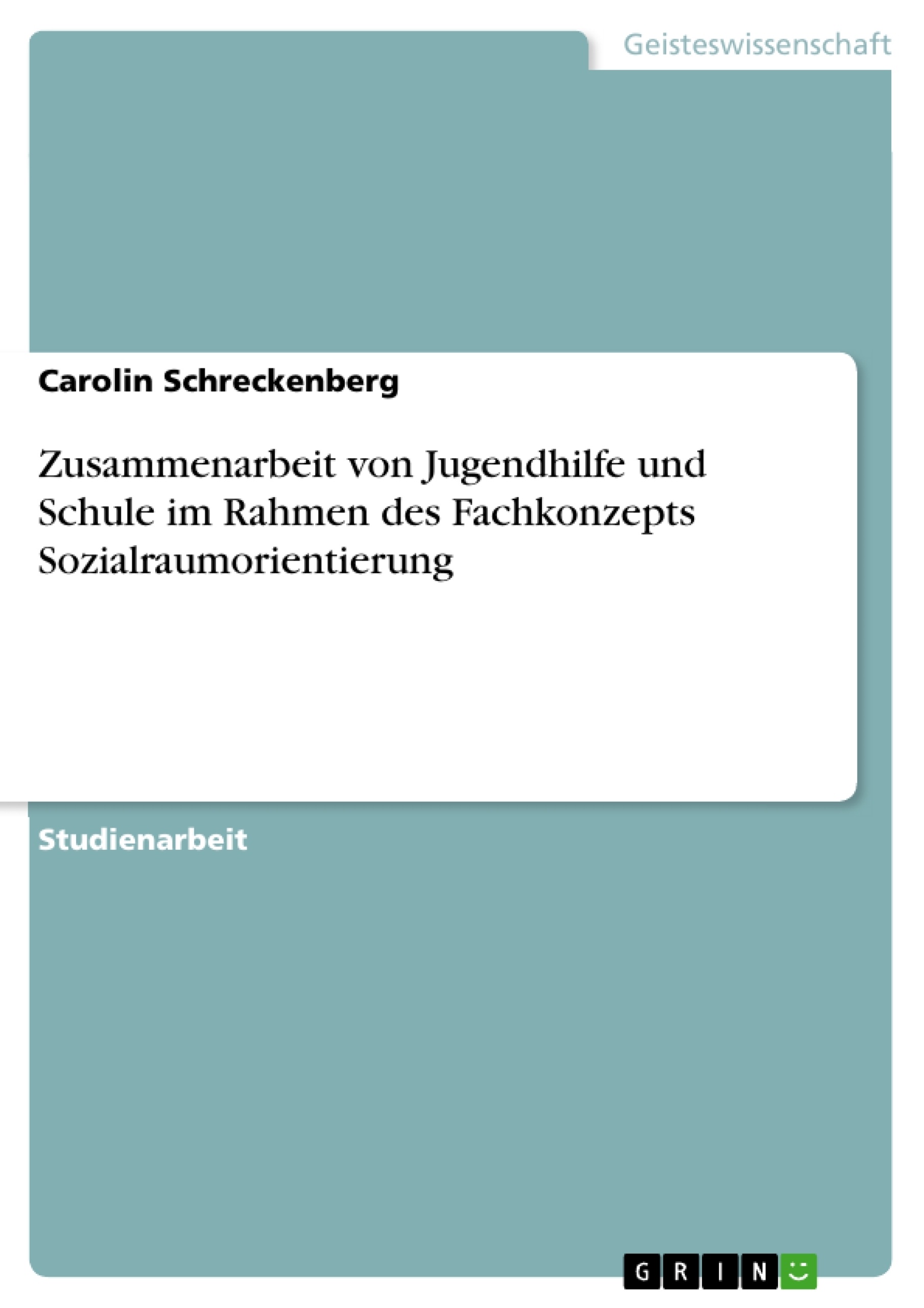Sozialraumorientierung ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Handlungsprinzipien der Sozialen Arbeit. Veränderte gesellschaftliche und familiäre Strukturen fordern eine Ausrichtung nach den Begriffen Sozialraum und Sozialraumorientierung.
Nicht nur die Soziale Arbeit bedient sich den Paradigmen der Sozialraumorientierung, sondern auch in Schulen werden Verhaltensweisen der Kinder vermehrt unter dem Gesichtspunkt des Sozialraums gesehen.
In der vorliegenden Hausarbeit soll geklärt werden in wie fern eine Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule unter dem Aspekt der Sozialraumorientierung möglich ist.
Zunächst stelle ich das Konzept der Sozialraumorientierung vor und gehe dabei zum einen genauer auf die Begriffe Sozialraum und Sozialraumorientierung ein und zum anderen erläutere ich die Prinzipien sozialräumlicher Arbeit. Im weiteren gehe ich dann auf das Konzept in Bezug auf die Kinder- und Jugendhilfe und auf die Institution Schule ein. Wichtig ist es mir dabei die gesetzlichen Grundlagen und die jeweiligen Funktionen darzulegen.
Nachdem ich das Konzept vorgestellt habe möchte ich dann auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule eingehen und die Kooperation im Rahmen der sozialraumorientierten Arbeit darstellen. Außerdem möchte ich durch sozialraumorientierte Projektbeispiele einen Bezug zur Praxis herstellen und die Umsetzung der theoretischen Darlegung aufzeigen.
Abschließend fasse ich ich meine Erkenntnisse über die Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendhilfe und Schule zusammen.
INHALT
Abbildungsverzeichnis
Einleitung
1. Fachkonzept Sozialraumorientierung
1.1 Begriff Sozialraum
1.2 Begriff Sozialraumorientierung
1.3 Prinzipien Sozialräumlicher Arbeit
1.3.1 Orientierung an Interessen und am Willen des Menschen
1.3.2 Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe
1.3.3 Konzentration auf die Ressourcen
1.3.4 Zielgruppen- und bereichsübergreifende Sichtweise
1.3.5 Kooperation und Koordination
2. Sozialraumorientierung im Bezug auf Kinder- und Jugendhilfe
2.1 Gesetzliche Grundlagen
2.2 Funktion Jugendhilfe
3. Institution Schule
3.1 Gesetzliche Grundlagen
3.2 Funktion Schule
4. Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule
4.1 Notwendigkeit der Zusammenarbeit
4.2 Kooperation im Rahmen Sozialräumlicher Arbeit
4.2.1 Schulische Entwicklungsaufgaben
4.2.2 Entwicklungsaufgaben der Kinder- und Jugendhilfe
5. Sozialraumorientierte Projektbeispiele der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule
Fazit
Literaturverzeichnis