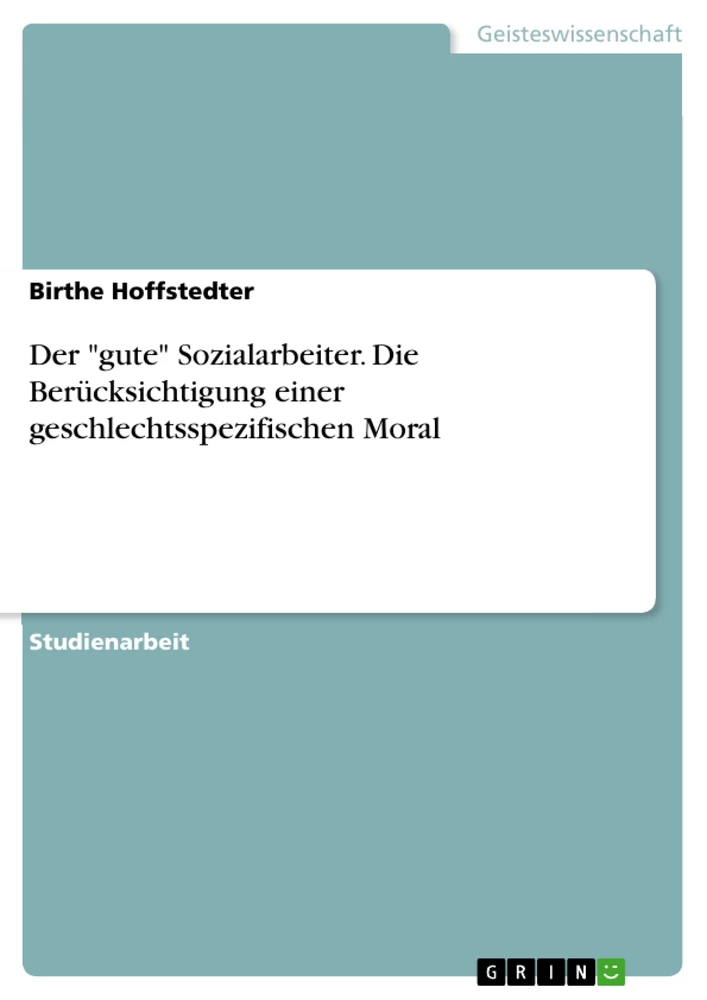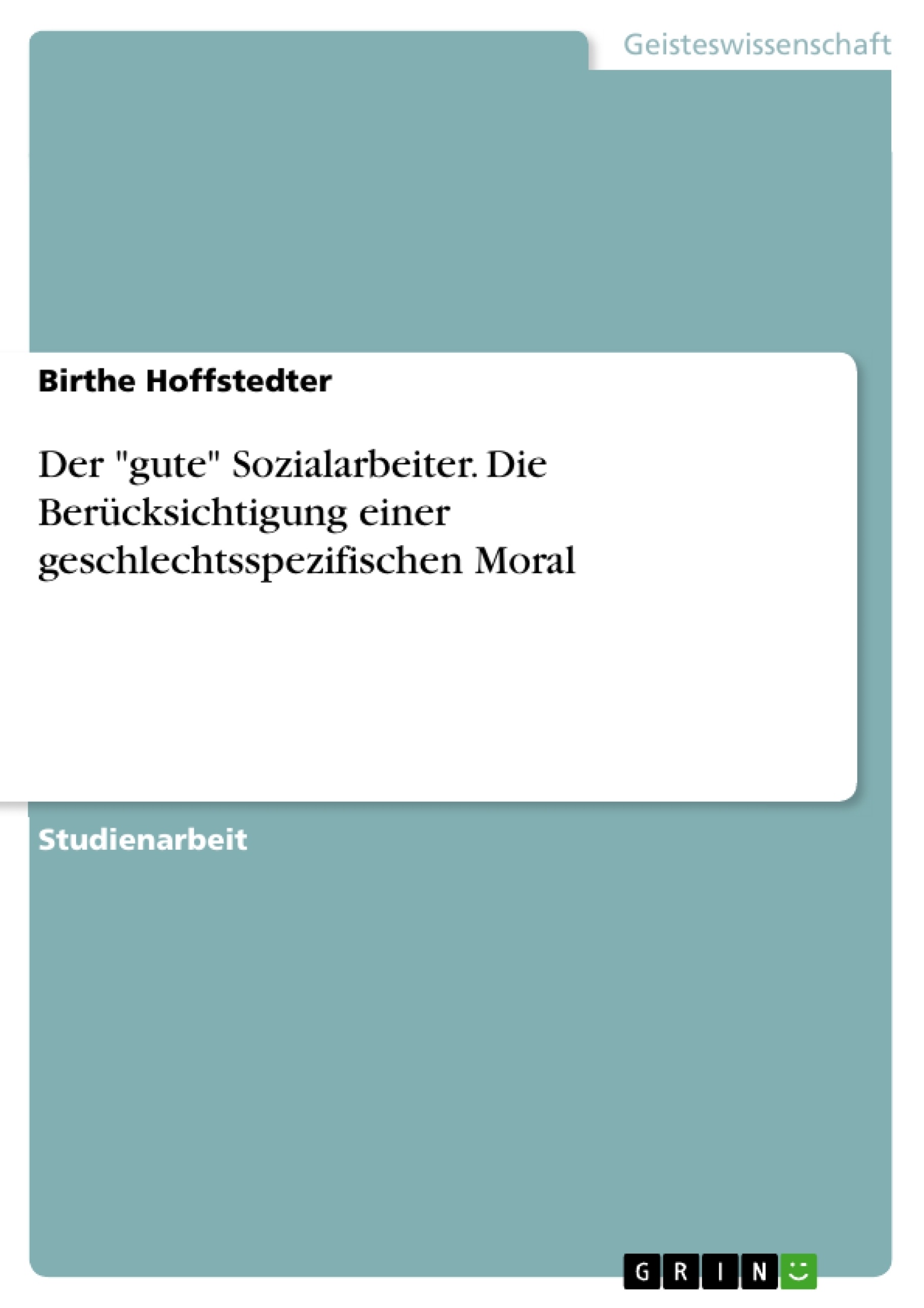„Können Frauen überhaupt gerecht sein, wenn sie so gewohnt sind zu lieben?“ (Friedrich Nietzsche).
„Gerechtigkeit ist mehr die männliche, Menschenliebe mehr die weibliche Tugend.“ (Schopenhauer).
Die Thematik, die in diesen Fragestellungen steckt, ist seit langem in der Entwicklungspsychologie kontrovers diskutiert. Ausgehend von dieser Ausgangsfrage werde ich in der vorliegenden Arbeit das Handeln des guten Sozialarbeiters oder der guten Sozialarbeiterin unter Berücksichtigung der weiblichen Fürsorgemoral nach Carol Gilligan beleuchten. Zudem werde ich kontroverse Ansichten darstellen sowie ein Fallbeispiel aus meiner Praxis zum Zweck des Bezuges auf die Soziale Arbeit heranziehen.
Der Berufsalltag eines Sozialarbeiters liefert ständig konfliktreiche Situationen, die es zu bewältigen gilt. Notwendiger Teil hierbei ist das ethische Bewusstsein, das immer dann eine Rolle spielt, wenn Konflikt- und Dilemmasituationen auftreten und eine Entscheidung zu fällen ist.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Gilligans Modell der Fürsorgemoral
2.1. Kontroverse
2.2. Hinweise auf das Bestehen einer geschlechterabhängigen Moral
3. Fallbeispiel
3.1. Falldarstellung
3.2. Reflexion nach berufsethischen Grundlagen des DBSH
4. Bezug der geschlechterspezifischen Moral zur Sozialen Arbeit
5. Fazit
6. Literatur