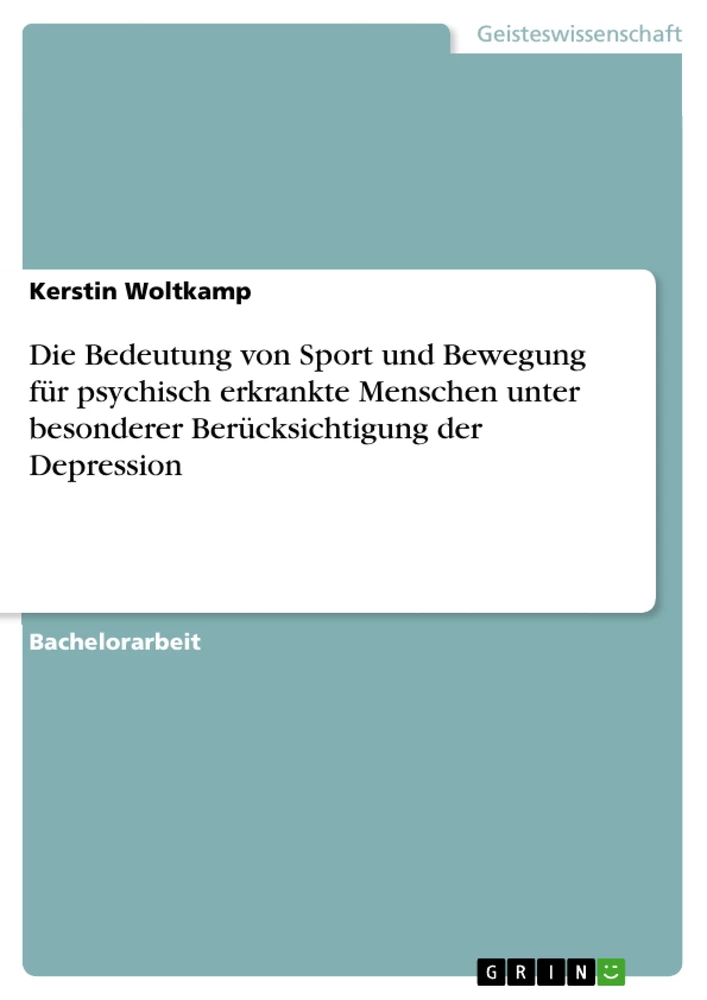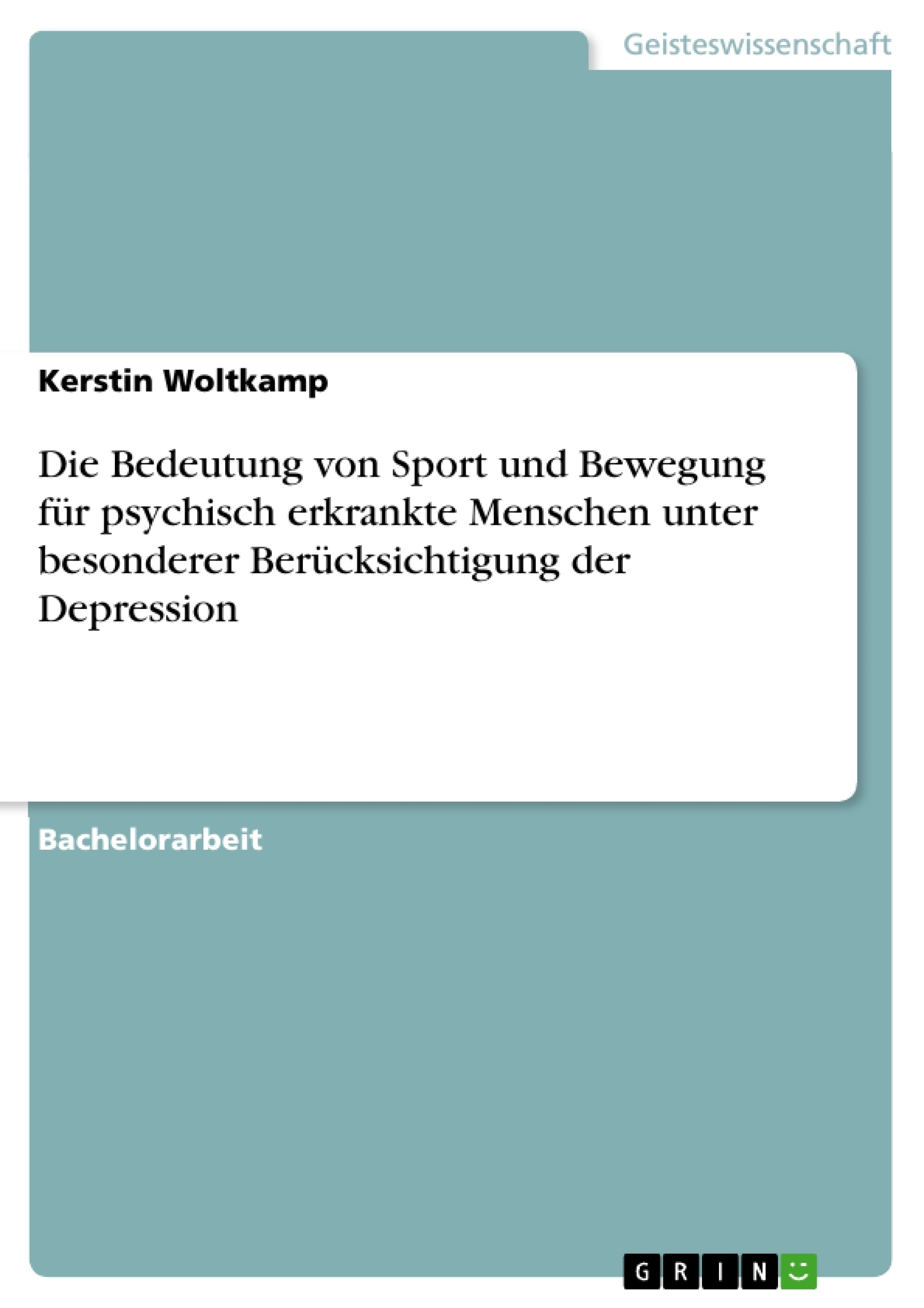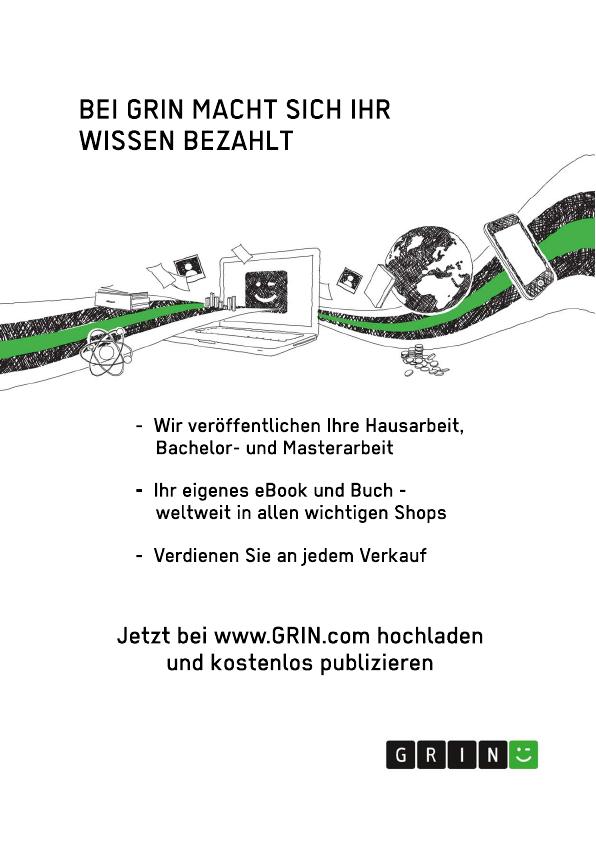Ziel meiner Arbeit ist es herauszufinden, welche Bedeutung Sport und Bewegung für psychisch erkrankte, insbesondere für depressiv erkrankte, Menschen haben. Psychische Erkrankungen überschreiten alle Grenzen - kulturelle, ökonomische, emotionale und intellektuelle - und können somit jeden treffen. Die Jahresprävalenz beträgt rund 30%. Offensichtlich stellen psychische Erkrankungen ein gewichtiges, sogar allumfassendes Problem unserer Gesellschaft dar (Comer 2008: 1 ff.). Es stellt sich die Frage, was man präventiv, aber auch im Rahmen einer Therapie und Rehabilitation tun kann, um den psychischen Störungen entgegenzuwirken.
Laut populären Hochglanzmagazinen stellen sportliche Aktivitäten immer ein wirksames Heilmittel für unsere seelische Gesundheit da (vgl. Fuchs/ Schlicht 2012: 1). Auch in der Praxis hat sich neben Psycho- und Pharmakotherapie inzwischen Sport und Bewegung als enorme Ressource etabliert (vgl. Weigelt u.a. 2012: 91). Dies wirft die Frage auf, wie sich die möglichen Wirkmechanismen sportlicher Aktivitäten erklären und ob positive Effekte des Sporttreibens unter allen Umständen und für alle Facetten der seelischen Gesundheit zu erwarten sind. Ebenso die Frage nach der Rolle der Sozialen Arbeit in diesem Kontext. Auf diese Fragen wird nachfolgend eingegangen werden.
Zu Beginn dieser Arbeit bedarf es eines generellen Verständnisses von Sport und Bewegung. Nachfolgend wird auf psychische Erkrankungen, zunächst allgemein und daran anschließend sehr detailliert auf Depression als Schwerpunkt dieser Arbeit, Bezug genommen.
Ich habe mich für den Themenschwerpunkt Depression entschieden, da er zum einen die häufigste psychische Störung darstellt und in Bezug auf den positiven Einfluss durch Sport eine gute empirische Absicherung hat (vgl. Brooks/ Wedekind 2009: 127). Die Befundlage von Depressionen ist deutlich robuster als die Befundlage anderer psychischen Erkrankungen (vgl. Schwerdtfeger 2012: 186). Schließlich stelle ich im 4. Kapitel den Zusammenhang von Sport bzw. Bewegung und psychischen Erkrankungen dar. Einleitend gehe ich auf Grundaspekte ein und erwähne exemplarisch den Einfluss von Sport und Bewegung auf verschiedene psychische Erkrankungen und folglich sehr ausführlich auf die Depression. [...]
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung und Fragestellungen
2. Sport und Bewegung
2.1 Verständnis von Sport und Bewegung
2.2 Eine Ressource für das Leben
2.3 Sport und Bewegung in der Sozialen Arbeit
3. Psychische Erkrankungen: Das Beispiel der Depression
3.1 Wesentliches über psychische Erkrankungen
3.2 Depressionen
3.2.1 Definition
3.2.2 Epidemiologie und gesellschaftliche Begünstigungsfaktoren
3.2.3 Biologische Grundlagen
3.2.4 Ursachen und Auslöser
3.2.5 Erscheinungsformen und Symptome
3.2.6 Diagnostik
3.2.7 Therapie
3.2.8 Psychodynamik
3.3 Psychisch erkrankte Menschen als Klienten der Sozialen Arbeit
4. Sport und Bewegung für psychisch erkrankte Menschen
4.1 Grundaspekte sportlicher Aktivität und seelischer Gesundheit
4.1.1 Affektive Reaktionen
4.1.2 Soziales Wohlbefinden
4.1.3 Stressregulation
4.1.4 Selbstkonzept
4.2 Der Einfluss von Sport und Bewegung auf verschiedene psychische Erkrankungen
4.3 Der Einfluss von Sport und Bewegung auf die Depression
4.3.1 Erklärungsansätze der Wirkweisen
4.3.2 Das Modell der Sport- und Bewegungstherapie
4.3.3 Sport und Bewegung statt Pharmako- und Psychotherapie
4.3.4 Empirische Befunde der Wirksamkeit
4.3.5 Interview - „Mit dem Fußball durch die Depression“
4.4 Exkurs: Sport und Bewegung nicht als „Allheilmittel“
4.5 Welche Rolle nimmt die Soziale Arbeit ein?
5. Fazit und Ausblick
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Anhang
1. Einleitung und Fragestellungen
„Mein Geist bewegt sich nicht, wenn meine Beine ihn nicht bewegen“
(Michel de Montaigne zit. in Eckel u.a. 2012: 238)
Ziel meiner Arbeit ist es herauszufinden, welche Bedeutung Sport und Bewegung für psychisch erkrankte, insbesondere für depressiv erkrankte, Menschen haben. Psychische Erkrankungen überschreiten alle Grenzen - kulturelle, ökonomische, emotionale und intellektuelle - und können somit jeden treffen. Die Jahresprävalenz1 beträgt rund 30%. Offensichtlich stellen psychische Erkrankungen ein gewichtiges, sogar allumfassendes Problem unserer Gesellschaft dar (Comer 2008: 1 ff.). Es stellt sich die Frage, was man präventiv, aber auch im Rahmen einer Therapie und Rehabilitation tun kann, um den psychischen Störungen entgegenzuwirken.
Laut populären Hochglanzmagazinen stellen sportliche Aktivitäten immer ein wirksames Heilmittel für unsere seelische Gesundheit da (vgl. Fuchs/ Schlicht 2012: 1). Auch in der Praxis hat sich neben Psycho- und Pharmakotherapie inzwischen Sport und Bewegung als enorme Ressource etabliert (vgl. Weigelt u.a. 2012: 91). Dies wirft die Frage auf, wie sich die möglichen Wirkmechanismen sportlicher Aktivitäten erklären und ob positive Effekte des Sporttreibens unter allen Umständen und für alle Facetten der seelischen Gesundheit zu erwarten sind. Ebenso die Frage nach der Rolle der Sozialen Arbeit in diesem Kontext. Auf diese Fragen wird nachfolgend eingegangen werden.
Zu Beginn dieser Arbeit bedarf es eines generellen Verständnisses von Sport und Bewegung. Nachfolgend wird auf psychische Erkrankungen, zunächst allgemein und daran anschließend sehr detailliert auf Depression als Schwerpunkt dieser Arbeit, Bezug genommen.
Ich habe mich für den Themenschwerpunkt Depression entschieden, da er zum einen die häufigste psychische Störung darstellt und in Bezug auf den positiven Einfluss durch Sport eine gute empirische Absicherung hat (vgl. Brooks/ Wedekind 2009: 127). Die Befundlage von Depressionen ist deutlich robuster als die Befundlage anderer psychischen Erkrankungen (vgl. Schwerdtfeger 2012: 186). Schließlich stelle ich im 4. Kapitel den Zusammenhang von Sport bzw. Bewegung und psychischen Erkrankungen dar. Einleitend gehe ich auf Grundaspekte ein und erwähne exemplarisch den Einfluss von Sport und Bewegung auf verschiedene psychische Erkrankungen und folglich sehr ausführlich auf die Depression.
In der Konzeption dieser Arbeit habe ich mich dafür entschieden, mich ausführlich auf ein Störungsbild zu beziehen und ergänzend kurz auf einige andere Störungsbilder einzugehen, um so einen guten Vergleich herzustellen.
Hierzu stelle ich das erfolgreiche Modell der Sport- und Bewegungstherapie vor und gehe auf die Ansicht vieler Autoren, dass bei Depressionen Sport sogar genauso wirksam sei wie eine Pharmako- oder Psychotherapie ein. Ebenso stelle ich empirische Befunde dar, welche diese Ansicht eher kritisieren und die Autoren eher skeptisch sind.
Um diesen gegenüberstehenden Ansichten gerecht zu werden, diskutiere ich den kritischen Ansatz, dass Sport und Bewegung nicht als „Allheilmittel“ gesehen werden sollte. Zusätzlich gehe ich in jedem Kapitel einzeln auf die Soziale Arbeit ein, um diese aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Folglich lässt sich die Rolle der Sozialen Arbeit in diesem Setting besser erkunden, wenn es denn die Rolle der Sozialen Arbeit sei.
Des Weiteren habe ich zwei Interviews durchgeführt und einfließen lassen. Hierdurch werden das Thema und die damit verbundenen Fragestellungen nochmals aus der Sicht der Praxis gut veranschaulicht, sodass sowohl Zusammenhänge als auch Unterschiede zu den theoretischen Grundlagen deutlich werden. Beide Interviews habe ich als qualitative Interviews durchgeführt, damit durch die offene Strukturierung, die Befragten möglichst viel von sich explizieren können (vgl. Kruse 2014: 150).
Das erste Interview habe ich mit dem Motologen2 der Don Bocso Klinik der Alexianer Münster geführt. In meiner Arbeit sind in einigen Kapiteln interessante Abschnitte aus diesem Experteninterview3 zusammengefasst zitiert, um so die Expertenmeinung direkt gegenüber der wissenschaftlichen Literatur zu stellen.
Das zweite Interview habe ich mit einer Betroffenen geführt. Sie ist depressiv erkrankt und spielt nebenbei in meiner Fußballmannschaft, was eine sehr bedeutsame Ressource für sie ist. Sie sagt unter anderem, dass Fußball sie am Leben gehalten habe. Dieses stelle ich in einem eigenen Kapitel (Kapitel 4.3.4) vor, da das Interview sehr zusammenhangsvoll ist und somit ein Herausnehmen einzelner Beiträge meiner Ansicht nach sinnlos wäre. Die Begründung dieser Interviewwahl und die Charakteristik ebenfalls stehen in diesem Kapitel.
Anzumerken ist noch, dass im Folgenden der besseren Lesbarkeit halber für Sozialarbeiter, Klienten, Patienten, etc. die männliche Form verwendet wird. Zudem verwende ich die Begriffe psychische Störung und psychische Erkrankung als Synonym. Dies gilt auch für Sport und Bewegung (vgl. Kapitel 2.1).
2. Sport und Bewegung
Die heutige „Fitnesswelt“ wird kulturell groß geschrieben. Um in der Disziplin und in den professionellen Handlungsfeldern Sport und Soziale Arbeit nutzbringend miteinander zu verbinden, bedarf es nach Michels (2007: 15) vorab einer Klärung des Sportverständnisses, mit dem die Akteure diese Verknüpfung denken und leben. Beginnend werde ich auf allgemeiner Basis das Verständnis von Sport und Bewegung zugrunde legen und begründen, warum es eine Ressource für das Leben ist, um folglich den Bezug zur Sozialen Arbeit aufzugreifen.
2.1 Verständnis von Sport und Bewegung
Nach Röthig (1972: 212) fluktuiere Sport zwischen den Phänomenen Spiel, Kampf und Arbeit. Daraus würden die Unsicherheit seiner Theorie und die Vielzahl umstrittener Deutungen resultieren. Im Folgenden werde ich einige Definitionsversuche aus der Literatur für Sport und anschließend für Bewegung aufgreifen.
Grupe (2000: 14) bezeichnet Sport als gesellschaftliches „Kulturphänomen“, da es für immer mehr Menschen attraktiv geworden sei. Die damit verbundene Ausbreitung des Sportbegriffs habe zur Entstehung einer eigenen „Sportkultur“ geführt. Grupe und Mieth (2001: 478) verstehen unter Sport nach Regeln betriebene Leibesübungen, Spiele und Wettkämpfe. Außerdem sei Sport in spezifische soziale und kulturelle Kontexte eingebunden und lasse sich mit erzieherischen und gesundheitlichen Zwecken verbinden. Aufgrund dieser individuellen Sinnzuschreibung würden sich ausdifferenzierte Systeme (Leistungs-, Freizeit-, Gesundheitssport uvm.) und zahlreiche Sportarten entwickeln (vgl. Bös/ Feldmeier 1992: 183).
Weiterhin ergänzt Röthig (1972: 212), dass der Sport zum Lebensstil der modernen Gesellschaft und zu den Inhalten ihrer Freizeit gehöre. Primär sei Sport der Oberbegriff für alle Arten wettbewerblicher Spielformen, die in den allgemein körperlichen Fertigkeiten enthalten und in der Interaktion mit anderen Personen ausgeübt würden. Sport liege auf einem Kontinuum zwischen Spiel und Arbeit. Die mit der sportlichen Aktivität verbundene Belohnung bestimme die Stelle auf dem Kontinuum.
Laut Röthig (1972: 43) trete Bewegung als sichtbares Produkt einer sensomotorischen Leistung, als Ortsveränderung des ganzen Körpers oder seiner Teile in Raum und Zeit in Erscheinung. Wobei der Verlauf objektiv bestimmbar sei und ein sinnvoller Bezug des Menschen zu anderen Menschen oder zur dinglichen Umwelt zu interpretieren wäre. Menschliche Bewegung konkretisiere sich als zielgerichtete, gestaltete und repräsentative Bewegung, sowie als Ausdrucksbewegung in verschiedenen Bereichen des Lebens. Somit würden sich Alltagsbewegungen, Arbeitsbewegungen und sportliche Bewegungen entwickeln.
Im Gegensatz dazu sind Bös und Feldmeier (1992: 42 f.) der Ansicht, dass die ausschließlich physikalische Betrachtung der menschlichen Bewegung nicht gerecht werden würde (z.B. gäbe es so ohne Beweggründe keine Bewegung). Bei menschlichen Bewegungen stehe das komplexe Wechselspiel von Organismus und Umwelt im Vordergrund. Bei zielgerichteten, willkürlichen menschlichen Bewegungen spreche man deshalb auch von Bewegungshandlungen. Diese seien zielgerichtet und würden zu einem Bewegungsresultat führen, an dem immer motorische, psychische, somatische und soziale Fähigkeiten beteiligt seien.
Des Weiteren sei die Bewegung weltoffen. Kultur und Geschichtlichkeit gehörten zu ihren Bestimmungsmerkmalen. Eine „natürliche“ Bewegung gebe es demnach nicht. Menschliche Bewegung sei als Medium der Lebensgestaltung zugleich von ethischer und moralischer Bedeutung anzusehen. Im weitesten Sinne diene sie als Vermittlung zur Welt und als Wahrnehmung der Welt (vgl. Gruppe/ Mieth 2001: 66 ff.).
Als Nächstes definiere ich den für meine Arbeit zentralen Begriff „sportliche Aktivität“ nach Fuchs und Schlicht (2012: 3 f.). Der Begriff „sportliche Aktivität“ ist in großer Abgrenzung zu den Begriffen „körperliche Aktivität“ und „Sport“ zu verstehen. Körperliche Aktivität umfasst alle Bewegungen, welche durch den Einsatz größerer Muskelgruppen eine substantielle Erhöhung des Energieverbrauchs provozieren. Somit sind nicht nur sportliche Tätigkeiten gemeint, sondern auch berufliche, freizeitliche und routinemäßige Alltagsaktivitäten, wie zum Beispiel Gartenarbeit, Treppensteigen oder Auto waschen. Im Gegensatz dazu bezieht sich der Begriff „Sport“ lediglich auf körperliche Aktivitäten, welche in standardisierten Räumen stattfinden (Sportplätz, vermessene Laufstrecken, usw.), in einem Regelwerk eingebunden sind (z.B. Tenninsregeln), sowie dem Erreichen eines Sieges oder dem Erlangen eines Rekordes dienen. Diese Charakterisierung des Sports ist eher traditionell und inzwischen kann Sport auch in Gestalt des Ausgleichs-, Erlebnis- oder Gesundheitssport auftreten.
„Sportliche Aktivität“ geht im Sprachgebrauch weiter als der traditionelle Begriff „Sport“, welcher aber enger gefasst ist als die „körperliche Aktivität“. In der Literatur sind die Abgrenzungen bislang nur sehr schwammig vorzufinden. Sportliche Aktivität hingegen kann als eine körperliche Aktivität verstanden werden, welche die typischen Bewegungsinszenierungen des Sports übernimmt, ohne zwangsläufig den Charakteristiken des Sports nachzugehen. Exemplarisch wäre dies eine Person, welche Langlauf betreibt, ohne in einem Wettbewerb gegen die Uhr oder einen Gegner zu stehen. Es ist nicht von vornherein eine bestimmt motivationale Ausrichtung impliziert.
Im Hinblick auf meine Arbeit sind die Begriffe Sport, Bewegung, Sportaktivität, Sporttreiben, etc. als Synonym für sportliche Aktivität zu verstehen, die über Alltagsbewegung hinaus gehen aber nicht unbedingt den Wettkampfsport darstellen.
2.2 Eine Ressource für das Leben
„Sport tut gut“ – das steht in vielerlei Hinsicht fest, aber inwieweit, auf welche Art und Weise und unter welchen Umständen Sport und Bewegung unser Leben begünstigt, werde ich in diesem Kapitel genauer erläutern.
Insgesamt bleibt der Mensch durch Sport und Bewegung fit, fördert seine Gesundheit, bildet soziale Kontakte und für viele ist es eine Beschäftigung, welche sie mit Spaß und Vergnügen, sowie mit Erholung, beispielsweise vom Arbeitsalltag in Form von „abschalten“, verbinden. Auch kann Sport sich negativ auf das Leben auswirken, z.B. in Form von Sportsucht oder einem zu hohen Leistungsdruck. Um den Rahmen nicht zu sprengen und im Hinblick auf mein eigentliches Anliegen dieser Arbeit, werde ich lediglich auf die positiven Aspekte von Sport und Bewegung eingehen.
Vorab gehe ich im anthropologischen Sinne auf die Frage nach dem Sinn des Sports ein. Laut Grupe (2000: 56 f.) ist der Sport wichtig für Gesundheit, Erziehung und Bildung der Menschen sowie für die Förderung des sozialen Ausgleichs und gegenseitigen Verstehens. Bewegungshandlungen sind sozusagen „Sinnträger“ und sportliche Bewegungshandlungen die konkreten und symbolischen Darstellungen dessen, was Sport an Sinn anbieten kann. Sie sind Voraussetzungen jeder sportlichen Betätigung und liegen zugleich dem Sport zugrunde. Die einzelnen Sportarten, Sportdisziplinen, Formen, Ereignisse und Bereiche des Sports bieten uns bestimmte Sinnmuster an und zugleich finden wir die uns wertvoll erscheinenden in ihnen.
Der Motologe einer Kinder- und Jugendpsychiatrie, welchen ich als Experten interviewt habe, sieht Sport und Bewegung als Ressource für das Leben wie folgt (vgl. S. 76):
„Ich glaube, wir bewegen uns alle bis zum 15. Lebensjahr sehr gerne. Wir haben selber die Möglichkeit für uns zu entscheiden, wollen wir lieber in die Bewegung sein? Gibt uns das was Gutes? Sind wir durch Sport ausgeglichen? […] Ich denke, es ist eine große Ressource, alleine um sich auch mal selbst zu spüren, um ein besseres Verständnis für seinen Körper und für die Leiblichkeit zu bekommen.“
Wirft man einen Blick in die Literatur, finden sich zahlreiche weitere Legitimierungen, dass Sport und Bewegung eine bedeutsame Ressource für das Leben bieten. So leitet die Universität Bayreuth (vgl. Wagner o.J.: 1 ff.) einen Beitrag zu diesem Thema mit der Überschrift „Bewegung als Schlüssel zur Prävention und Gesundheitsförderung“ ein. Die Gesundheitsförderung zielt ab, Menschen zu befähigen, Kontrolle über ihre Gesundheit auszuüben und dadurch ihr physisches, psychisches und soziales Wohlbefinden zu verbessern (WHO4 1986, zit. in Wagner o.J.: 5). Denn wie die wissenschaftliche Erkenntnis zeigt, ist körperliche Inaktivität ein zentraler Risikofaktor für die Gesundheit (Herzkreislaufsystem, Halte- und Bewegungssystem etc.). Mitunter wird durch Sport und Bewegung das Risiko, an psychischen Störungen zu erkranken, deutlich minimiert.
Ergänzend hierzu schreibt die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg (o.J.: 5) auf ihrer Homepage über ganzheitlich ausgerichtete Gesundheitsmodelle. Die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg versteht die Faktoren Bewegung, Spiel und Sport als präventive Elemente einer gesunden Lebensführung, generalisierte Widerstandsquelle, Bewältigungsstrategie, Elemente der Gesundheitserziehung im Schulsport und Stärkung psychischer Ressourcen.
Weiterhin stellt Suter (2012: 130 ff.) die Förderung der Lebenskompetenzen durch Bewegung am Beispiel von Kindern dar. Über Bewegung erkunden Kinder die Welt, erweitern ihren Radius, machen Erfahrungen und lernen. Bewegung meint hier all die unzähligen Tätigkeiten, welche das kindliche Spiel und den kindlichen Alltag prägen. Die WHO (1994, zit. in Suter 2012: 131) definiert Lebenskompetenz als „diejenigen Fähigkeiten, die einen angemessenen Umgang sowohl mit unseren Mitmenschen als auch mit Problemen und Stressregulationen im alltäglichen Leben ermöglicht.“ Eine vertiefte Darstellung bezüglich der engen Verknüpfung von Bewegung und Lebenskompetenz kann in dem Aufsatz von Suter (2012) nachgelesen werden.
Meyer (2011) nennt weitere positive Aspekte von Sport und Bewegung für das Leben. Dazu zählen unter anderem:
Wohlgefühl: Sporttreiben könnte zu einer verbesserten Lebenszufriedenheit führen und dient somit dem Wohlbefinden (ebd.: 36).
Selbstbestimmung: Bewegungen nach eigenem Willen (ebd.: 48).
Konzentration: Aufmerksamkeit gezielt und beabsichtigt auf eine bestimmte Sache richten (ebd.: 64).
Stressbewältigung: Umgang mit Stress wird erlernt (ebd.: 82).
Motivation: Förderung der Realisierung und Umsetzung von Zielen (ebd.: 86).
Selbstbild, Selbstkonzept: Wie definiere ich mein Selbst, was bin ich? (ebd.: 88)
Selbstreflexion: Überlegt handeln und dieses reflektieren (ebd.: 90).
Selbstbeobachtung: Sich selbst und sein eigenes Handeln zu beobachten (ebd.: 92).
Selbstkontrolle: Eigene Bewegungen und Emotionen kann man kontrollieren (ebd.: 94).
Selbstvertrauen: Der Zugang zu sich selbst, sich zu fühlen, eine Ahnung von sich selbst zu erhalten (ebd.: 96).
Selbstbewusstsein: Wahrnehmungsfähigkeit seiner Selbst (ebd.: 98).
Selbststeuerung: Bewusste Kontrolle und reaktiver Reflex (ebd.: 100).
Selbstmanagement: Abläufe selbst organisieren (ebd.: 102).
Natürlich wirken sich Sport und Bewegung auch positiv auf die psychische Erkrankungen eines Menschen aus. Dies erläutere ich ausführlich im 4. Kapitel. Ich habe bewusst diese Unterteilung vorgenommen, um vom generellen Verständnis und den Ressourcen für das Leben auf mein Kernthema, den Einfluss von Sport und Bewegung auf psychische Erkrankungen, einzugehen.
2.3 Sport und Bewegung in der Sozialen Arbeit
Im Handbuch Soziale Arbeit (2011: 1569) wird Sport als Förderung für die Gesundheit und einer stabilen Persönlichkeit, Abbau von Spannungen und Stress sowie als Unterstützung für das soziale Miteinander und für soziales Lernen einleitend definiert. Zudem wird auf die Sozialisation „in“ und „durch“ Sport eingegangen. Das bedeutet, wenn junge Menschen in den Sport eingebunden werden und wie dann die Auswirkungen auf die „allgemeine“ Persönlichkeitsentwicklung (Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse, Wertvorstellungen) sind. Weiterhin geht es um soziale Integration, insbesondere um Möglichkeiten und Grenzen einer Integration von Migranten, normabweichendes Verhalten auf und außerhalb des Sports und Sportangebote für verhaltensauffällige Jugendliche.
Bewegung, Sport und Spiel sind in der heutigen sozial- und sonderpädagogischen Praxis, besonders in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, elementare Bestandteile. Hierfür gelten nach Seibel (2004: 16) handlungsleitende Grundsätze wie Alltagsorientierung, Ressourcenorientierung, Kommunikation, Empowerment, Ganzheitlichkeit, Integration, Lebensweltorientierung, Partizipation, Prävention, Sozialraumbezug und Vernetzung. Gleiches gilt für die Erlebnispädagogik, die mit Elementen des Abenteuers, die Lust auf den Umgang mit Wagnis, Risiko und Unsicherheit, meist in Zusammenarbeit mit Bewegungsaktivitäten, in den Vordergrund stellt (vgl. Michels 2007: 13). Ebenso ist der Einfluss von Sport und Bewegung auf psychisch erkrankte Klienten von großer Bedeutung. Diese Ausführungen finden sich in Kapitel 4 und, bezogen auf die Soziale Arbeit, im Kapitel 4.5.
Des Weiteren wird im Wörterbuch der Sozialen Arbeit (vgl. Kreft/ Mielenz 1996: 579) das Medium „Sport“ als geeignetes Mittel der pädagogischen Sozialen Arbeit benannt. Sport wurde als Bewegungserziehung in Kindergärten, als Sportgruppenangebot in Jugendfreizeitstätten, als wichtiges Angebot zur Integration ausländischer Kinder, für Behinderte (z.B. Reittherapie), für Verhaltensgestörte (unter anderem therapeutisches Segeln), als familienorientiertes Angebot (Eltern-Kind-Angebote), für Strafgefangene und für ältere Menschen (Altensport) entdeckt.
Jedoch spiegelt sich dies kaum in den konzeptionellen und theoretischen Überlegungen der Sozialen Arbeit wieder. Körper und Bewegung sollten als Grundkategorie professionellen Denkens und Handelns in der Sozialen Arbeit berücksichtigt werden. Auch um die vielfältigen körper- und bewegungsbezogene Konzepte, die in der sozialpädagogischen Praxis längst etabliert, aber wenig reflektiert sind, zu legitimieren (vgl. Gräfe/ Witte 2014: 6, 7, 11). Nur an wenigen Fachhochschulen gibt es ein Ausbildungskonzept für den Bereich Sport, wodurch die Studierenden der Sozialen Arbeit ausreichende Kenntnisse zur Planung und Durchführung von Sportangeboten in Sozialen Arbeitsfeldern erwerben. Der Bereich Sport ist in der Ausbildung von Sozialarbeitern im Hinblick auf Zielsetzung, Inhalte, Umfang und Gestaltung meist schwammig definiert (vgl. Seibel 1998: 83). Michels (2007: 14 f.) spricht hier von einem wissenschaftlichen Desiderat5. Sportwissenschaft und Soziale Arbeit stehen als wissenschaftliches Arbeits- und Ausbildungssystem unverbunden nebeneinander, obwohl es zahlreiche Zusammenhänge in der Praxis gibt.
Allerdings lassen sich in der Literatur einige gute Beispiele von Fachhochschulen finden, welche diese Zusammenhänge als Studienelemente bereits erfolgreich gestalten. Mitunter wird das SPOSA-Projekt (Sportbezogene, lebensweltorientierte Soziale Arbeit mit sozial benachteiligten jungen Menschen) der Evangelischen Fachhochschule Freiburg dargestellt (vgl. Seibel 1998: 83 f.). Dort heißt es in der Zielsetzung:
„Sport kann einen entscheidenden Beitrag bei der Lösung von sozialen und gesellschaftlichen Problemen leisten, insbesondere im Sozialisations- und Entwicklungsprozess junger Menschen oder bei der Integration von gesellschaftlichen Randgruppen. […] Es ist Aufgabe […] ausreichend auf soziale Benachteiligungen und Gefährdungen einzuwirken. Sportbezogene Arbeit spricht Jugendliche aus bildungsfernen Schichten und solche in besonderen Problemlagen an, bietet ihnen Beratung und Hilfe und fördert ihre Integration in die Gesellschaft. […] Sportangebote können positive Wirkungen in unterschiedlichen Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsbildung ermöglichen. […] Die Schaffung von dauerhaften Kontakten und festen Beziehungsstrukturen in der Lebenswelt ist dabei das hauptsächlich verfolgte Ziel.“
Die Studierenden der Sozialen Arbeit können theoretische und sportpraktische Grundlagen im Freizeitsport in der Ausbildung zum Übungsleiter absolvieren. Ergänzt wird dies durch einen Kooperationslehrgang über sportbezogene Soziale Arbeit mit sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Dadurch können Studierende Sport als Medium der Sozialen Arbeit gezielt in ihrem jeweiligen Arbeitsfeld einbringen und nutzen. Die genauere Beschreibung der einzelnen Module sind bei Seibel (1998: 86 ff.) zu finden.
In einem weiteren Buch von Seibel (2004)6 werden dieses sowie weitere Konzepte (SPACE-Projekt, Bachelorstudiengang Soziale Arbeit, Sport und Freizeit an der Evangelischen Fachhochschule Freiburg, etc.) detailliert und gut verständlich dargestellt.
Auch im Rahmen des sog. „Düsseldorfer Modells“ (vgl. Michels 2014: 78) wird an der Fachhochschule in Düsseldorf die Verknüpfung von Sozialer Arbeit und Sport nachhaltig und systematisch in das Lehrangebot integriert. Dies stützt sich auf verschiedene Konzepte, unter anderem auf den „Bewegungs- und körperzentrierten Ansatz“ von Becker oder den Ansatz der „Sportbezogenen, lebensweltorientierten Sozialen Arbeit“ nach Seibel. Unter der Berücksichtigung, dass laut der Definition der „International Federation of Social Worker“ (2000: 1) Soziale Arbeit dort vermittelt, wo Menschen und ihre sozialen Umfelder aufeinander treffen, sowie Menschenwürde und ein Recht auf Bildung von Wichtigkeit sind, wird der Bezug zum Sport deutlich. Denn nach Michels (2014: 79 ff.) ist das Recht auf ein menschenwürdiges Leben, also auf Inklusion, auf eine umfassende Teilhabe am Sport und ungehinderten Zugang in verschiedene Bereiche des Sportsystems, eine bedeutsame Perspektive der Sozialen Arbeit. Außerdem ist Sport mit vielfältigen persönlichen und sozialen Bildungspotenzialen verbunden, wie die sportorientierte Jugendforschung, beispielsweise im 1. und 2. Kinder- und Jugendbericht (Schmidt 2003, 2009) zeigt. Ergänzend sind Gesundheitsförderung und soziales Wohlbefinden weitere Zieldimensionen der Sozialen Arbeit, durch welche sich der Sport als Medium anknüpfend und mit seinen Wirkungspotenzialen nachhaltig einbringen kann.
Somit gilt Sport im weiteren Sinne als präventions- und problemorientierte Soziale Arbeit. Jedoch können andere gesellschaftliche Systeme (Arbeitssystem, Familiensystem, Finanzsystem, Politiksystem etc.), die für soziale Probleme ursächliche Relevanz besitzen, nur begrenzt problemreduziert durch Sport beeinflusst werden. Auf der Ebene des Umgangs mit sozialen Problemen (Verhaltensprävention) kann der Sport in vielen Bereichen problemrelevante Ressourcen zur Bewältigung und Veränderung mobilisieren. Auch bezieht sich das Düsseldorfer Modell (vgl. Michels 2014: 81) auf die Abenteuer- und Erlebnispädagogik, bei der es um die Lebensbewältigung geht. Diese meint „das Streben nach subjektiver Handlungsfähigkeit in kritischen Lebenssituationen, in denen das psychosoziale Gleichgewicht - Selbstwertgefühl und soziale Anerkennung - gefährdet ist“ (Böhnisch 2010: 223). Wird der Sport als Abenteuer inszeniert, ermöglicht er individuelle Erfahrungen, durch die eine Selbstwirksamkeit in schwierigen Handlungssituationen erlebbar werden kann.
Weiterhin sieht Michels (2007: 13) Sport als Impulsgeber für die Soziale Arbeit: „Ohne Bewegung kein bewegtes Leben. Bewegung, Sport und Spiel sind mehr als willkommene Nebensachen und Freizeitbeschäftigungen sozialpädagogischer Handlungsfelder.“ Auf der sozialen Dimension von Bewegungsaktivitäten und des Sports entwickeln wir soziale Kompetenzen, entfalten Verhaltensmuster, die über Bewegungshandlungen hinausgehen und entwickeln unsere eigene Persönlichkeit und Identität.
Es mag so scheinen, dass demnach die gesamte Jugendarbeit der Sportvereine Soziale Arbeit wäre. Doch Pilz (zit. in Michels 2007: 16) weist zu Recht darauf hin, dass ein Übungsleiter im Sportverein mit Jugendlichen noch keine Soziale Arbeit im engeren Sinne leistet, sondern höchstens eine gute Jugendarbeit im Sport realisiert. Nicht grundlos differenziert das Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 11 und 13) in Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit.
Offensichtlich sind im Laufe der Jahre Sport und Soziale Arbeit ein für beide Seiten förderliches Miteinander geworden (vgl. Kreft 2011: 14). „So ist der Sportverein nicht nur die Nr. 1 sportbezogener Jugendarbeit, sondern der außerschulischen Jugendarbeit überhaupt“, so der 1. und 2. Kinder- und Jugendbericht“ (Schmidt 2003, 2009).
Gemeint ist, dass der Zugang zur Bewegung und zum Sport für Menschen in prekären Lebenslagen im Mittelpunkt der Sozialen Arbeit stehen sollte. Beispielsweise erhält man guten Zugang zum Klientel durch ein Basketballangebot als Plattform der Jugendberufshilfe im Projekt „Körbe für Köln“ (vgl. Michels 2007: 16). Diese Instrumentalisierung des Mediums Sports (z.B. in der Gewalt- und Suchtprävention, der interkulturellen Arbeit, der frühkindlichen Entwicklung) ist durchaus akzeptabel. Auch Menschen, die sonst nicht zum Sport und zur Bewegung finden (Exklusion) sollten Beteiligungs- und Bildungschancen im Sport durch Angebote der Sozialen Arbeit erhalten (vgl. ebd.: 16).
Somit sollte Bewegung, Sport und Abenteuer vermehrt in den sozialpädagogischen Institutionen konzeptionell verankert und eine Qualifizierung der Mitarbeiter vorangetrieben werden. Hier sind vor allem auch die freien Träger der Sozialen Arbeit gefordert, diese Herausforderung anzunehmen. Zudem sollten verstärkt konzeptionelle sozialpädagogische Ansätze (Sozialraumorientierung etc.) mit Ansätzen der sportwissenschaftlichen Konzepte verknüpft werden (vgl. ebd.).
Jedoch bemerkt Kreft (vgl. 2011: 14) auch die deutliche Trennung von Sport und Soziale Arbeit. Beide haben ihre eigenen Organisationen, Träger, speziellen Ziele und Zielgruppen, Inhalte und Finanzierungsregelungen, zum Teil unterschiedliche Leitbilder und arbeiten nach verschiedenen Prinzipien. Nur aufgrund der Verschiedenheit konnten sich die Reize entwickeln, die besonderen Möglichkeiten des anderen Handlungsfeldes zu nutzen. Beide Seiten sollten sich respektieren und nichts vermengen, denn dann fehlt rasch dieser Reiz des anderen.
3. Psychische Erkrankungen: Das Beispiel der Depression
Auch wenn in dieser Arbeit der Schwerpunkt auf die Depression liegt, möchte ich diese in ein generelles Verständnis von psychischen Erkrankungen einbetten. Zunächst geht es allgemein um psychische Erkrankungen, was es bedeutet psychisch erkrankt zu sein, wie sehen die Dimensionen aus, wie entstehen psychische Erkrankungen, was sind typische Symptome, etc. Auch erläutere ich kurz die Krankheitsbilder der Schizophrenie, Sucht und Angststörung, da ich diese weiter hinten in meiner Arbeit in einem Zusammenhang zu Sport und Bewegung darstelle. Im zweiten Unterkapitel gehe ich speziell und sehr detailliert auf die Depression ein. Abschließend erläutere ich, wie wichtig die Soziale Arbeit mit psychisch erkrankten, vor allem depressiv erkrankten, Menschen ist.
3.1 Wesentliches über psychische Erkrankungen
Der Begriff „psychische Erkrankung“ ist aufgrund der vielfältigen Formen psychischen Verhaltens schwer nach allgemeinen Kriterien zu definieren (vgl. Denner 2008 b: 14). Nach Comer (2008: 2) hat sich keine der im Laufe der Jahre vorgeschlagenen Definitionen durchgesetzt, wobei die meisten Definitionen Merkmale, wie Abweichung, Leidensdruck, Beeinträchtigung und Gefährdung gemeinsam haben. Diese sind z.B. bei Stemmer-Lück (2009: 24) detailliert nachzulesen.
Nach Hülshoff (2011: 13) gibt es eine Vielzahl von biografischen, familiären, kulturellen, sozialen und politischen Faktoren, welche krank machen können. Somit umfasst die Krankheit immer den gesamten Menschen in all seinen Bezügen. Die Entwicklung einer Störung lässt sich letztlich als bio-psycho-sozialer Prozess beschreiben (vgl. Stemmer-Lück 2009: 114). Demnach werde ich bei Symptomen, Ursachen und Therapien der Depression Unterteilungen in diese drei Ebenen des Menschen vornehmen und miteinander in Verbindung setzen. Denn, um z.B. eine Depression zu verstehen, wird nicht nur das Wissen über körperliche Erscheinungsformen, sondern auch über das psychische Erleben und über die Beziehung zur Umwelt benötigt (vgl. Hülshoff ebd.).
Das klassische medizinische Krankheitsmodell definiert Krankheit als „einen regelwidrigen Funktionszustand körperlicher Organe, der eine spezifische Ursache, bestimmte Grundstörung, typische Symptome und eine beschreibbare Prognose aufweist“ (Hülshoff 2011: 16). Jedoch erfasst dieses naturwissenschaftliche Modell nur einen Teil der Erkrankung. Psychologische, pädagogische und soziokulturelle Aspekte, sowie Potenziale des Patienten und seiner Umwelt werden nicht berücksichtigt. Auch der WHO zufolge ist Gesundheit „ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefinden“ (Waller zit. in ebd.). Erscheinungsformen, Symptome, Diagnostik und Therapie sind zunächst Aspekte der biologischen Ebene. Jedoch ist es auch wichtig Verlusterlebnisse, Ängste, sozialen Rückhalt bei Freunden und in der Familie, psychosoziale und berufliche Rehabilitation in den Blick zu nehmen. Denn all diese Faktoren wirken sich stark auf die Lebensqualität aus und stärken zugleich das Immunsystem und tragen somit sekundär zur Genesung bei (vgl. Hülshoff 2011: 17). Außerdem richtet sich die Definition von krank und gesund nach kulturellen Gegebenheiten, z.B. erkennen wir im sog. „Zappelphilipp“ heute das hyperkinetische Syndrom (vgl. ebd.: 15).
Auch im „Psychologie Lexikon“ (vgl. Reclam 2010: 159 ff.) wird eine klare Unterscheidung zum medizinischen Krankheitsmodell vorgenommen. Die klinische Psychologie arbeitet mit dem Konzept der „Störung“, welches Beeinträchtigungen als Abweichung von einer Norm darstellt. Psychische Störungen äußern sich in emotionalen Reaktionen, im Verhalten, im Denken und in Art und Intensität körperlicher Empfindungen. Zweitens werden sie von psychosozialen Faktoren beeinflusst. Viele Veränderungen psychischer Vorgänge müssen erfragt, beobachtet und interpretiert werden. Eine objektive Feststellung, wie etwa beim Bluthochdruck, ist nicht möglich.
Insbesondere sind psychosomatische Krankheitsmodelle für meine Arbeit von Relevanz. Sie stellen Wechselwirkungen zwischen körperlichen Phänomenen und seelischem Erleben dar, wie z.B. das Stress-Coping-Modell von Lazarus zeigt (vgl. Hülshoff 2012: 264) (vgl. Kapitel 4.1.3).
Weiterhin ist die Compliance durch die Kooperation in der Therapeuten-Patienten-Beziehung wichtig. Diese wird durch den Glauben an die Wirksamkeit der Therapie, Zufriedenheit mit der Behandlung, soziale Unterstützung, Glaube an die Ernsthaftigkeit der Erkrankung, klare Behandlungsvorgaben, sowie Empathie des Therapeuten unterstützt. Zudem können psychosoziale Risiko- sowie Schutzfaktoren beim Entstehen und bei der Entwicklung psychischer Erkrankungen bedeutsam sein (vgl. Hörning 2011: 27) (vgl. Kapitel 3.2.4).
Außerdem ist für die Behandlungsorientierung zunächst wichtig, ob überhaupt ein Krankheitserleben vorliegt, wie Stemmer-Lück (2009: 52 ff.) zeigt. Es geht vor allem um den Leidensdruck infolge psychischer Störungen und um die Veränderungsmotivation, welche von Emotionen und von kognitiven Funktionen begleitet ist. Dies meint die Fähigkeit das Problem zu erkennen und einen Hilfewunsch, sowie die Behandlungsbereitschaft zu äußern. Auch sind persönliche Ressourcen, wie aktiver und gesunder Lebensstil, gute Beziehungsgestaltung, sowie die Fähigkeit zum Alleinsein, Distanzieren und Entspannen wichtig. Diese verhelfen den Patienten ihre Störungen, Symptome, Verhaltensmuster oder Probleme in einer konstruktiven und adaptiven Weise zu bewältigen. Grundsätzlich haben alle Menschen Ressourcen, welche es zu entdecken, zu aktivieren und zu fördern gilt. Zudem ist das Krankheitserleben durch erlebte Beeinträchtigungen im Alltagsleben oder durch Stigmatisierungen bestimmt. Ebenfalls ist die subjektive Krankheitstheorie der Klienten am Krankheitserleben beteiligt. Sie beeinflusst die Erwartungen an eine Behandlung und ist mitunter vom Alter, Geschlecht und Gesundheitssystem geprägt.
Ergeben sich aus Verhalten und Äußerungen eines Menschen Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung, so muss diese zunächst diagnostiziert werden, um dann gezielt therapeutisch und sozialpädagogisch zu handeln (vgl. Schwarzer 2011: 216 ff.). Die Diagnostik umfasst ein erkundendes Gespräch, Beobachtung von Verhalten, eine körperliche medizinische Untersuchung und eine Erhebung des psychischen Befundes mit einhergehender Sozialanamnese. Schwarzer spricht hier auch von der Psychopathologie. Dies meint Beschreibung, Benennung und Einordnung psychischer Störungen. Hierzu verhelfen Klassifikationssysteme, wie das ICD-10 (International Classification of Diseases) der WHO oder das DSM-IV (Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen). Im ICD-10 werden psychische Störungen in 10 Hauptkategorien eingeteilt, wie der Abbildung 1 (Anhang S. 61) zu entnehmen ist.
Zum einen gibt es psychotische Störungen, wie die Schizophrenie (siehe Abb. F2). Sie ist durch Denk- und Wahrnehmungsstörungen charakterisiert. Typische Symptome sind Wahn, Gedankenlautwerden, Halluzination, Beeinflussungsgefühl, Antriebsmangel, Teilnahme- und Leidenschaftslosigkeit und Affektabflachung (vgl. Müssigbrodt u.a. 2006: 49, Brand/ Kahlert 2012: 209).
Weiterhin können Menschen unter verschiedene stoffgebundene Süchte leiden (siehe Abb. F1), z.B. unter Alkohol- oder Drogensucht. Daraus ergeben sich Symptome wie depressive Verstimmtheit, Schlafstörungen, Übelkeit, Entzugserscheinungen, Halluzinationen, Angstzustände, Stimmungsschwankungen, Antriebsmangel, rechtliche oder soziale Probleme wie Schwierigkeiten in der Partnerschaft oder Probleme am Arbeitsplatz sowie Verhaltensänderung in Form von vermehrter Reizbarkeit (vgl. Müssigbroedt u.a. 2006: 35,44). Zudem gibt es Angststörungen (siehe Abb. F4), plötzliche Angst- oder Panikattacken treten auf und führen zur Furcht vor neuen Situationen, in denen solche Attacken auftreten können (vgl. ebd.: 77). Auch treten Affektstörungen (siehe Abb. F3) mit Veränderungen von Stimmung und Antrieb auf. Hierzu zählt neben manischen Störungen vor allem die Depression (vgl. ebd.: 61), welche ich im Anschluss an dieses Kapitel ausführlich erläutere. Es gibt noch eine Reihe weiterer psychischer Störungen (Demenz (siehe Abb. F0), Anpassungs- und Belastungsstörungen (siehe Abb. F4), Zwangsstörungen (siehe Abb. F4), Persönlichkeitsstörungen (siehe Abb. F6), Essstörungen (siehe Abb. F5), Intelligenzminderung (siehe Abb. F7), Entwicklungsstörungen (siehe Abb. F8), etc.), wie der Abbildung 1 (Anhang S. 61) zu entnehmen ist. Hierfür empfehle ich die präzise Übersicht von Müssigbrodt u.a. (2006: 147 ff.) nachzuschlagen. Um den Rahmen hier nicht zu sprengen, habe ich nur einige, für meine Arbeit relevante, psychische Störungen kurz definiert.
An dieser Stelle möchte ich auf einige Modelle psychischer Krankheit eingehen. Das bedeutsame Vulnerabilitätsstress-Modell lasse ich außen vor, da ich dies im Kapitel 3.2.4 beschreibe.
Nachfolgend wird das Salutogenese-Modell von Antonovsky erläutert (vgl. Stemmer-Lück 2009: 20 f.). Er kritisiert die pathogenetische Sichtweise für die Entstehung und Behandlung von psychischen Störungen. Viel wichtiger sei es, seiner Auffassung nach, zu fragen, wie es Menschen trotz enormer Belastungen schaffen, gesund zu bleiben bzw. keine psychischen Störungen zu entwickeln. Sogenannte „generalisierte Widerstandsressourcen“ (ebd.: 21) mobilisieren Menschen bei belastenden Lebenserfahrungen. Diese Ressourcen werden in Verbindung mit dem individuellen Kohärenzgefühl gesetzt. Dieses wiederum setzt sich aus den Dimensionen „Verstehbarkeit“ (Lebenseinstellung, Zuversicht), „Machbarkeit“ (Überzeugung verschiedene Ressourcen zu besitzen) und „Bedeutsamkeit“ (Leben als emotional und sinnvoll empfinden) zusammen. Somit befindet sich die psychische Gesundheit immer in einem dynamischen Prozess.
Abschließend soll auf Zusammenhänge von Emotionen mit dem Erleben und der Bewältigung von psychischen Störungen eingegangen werden. Wie weiter hinten noch erklärt wird, tritt Trauer häufig als Folge von Verlusterlebnissen auf. Dies ist ein wichtiges emotionales Regulativ, welches die Adaption an den neuen Status ermöglicht und die körperliche wie seelische Heilung vorantreiben kann. Bei belastenden Lebensereignissen führt fehlende Trauerarbeit zu einer erhöhten Krankheitsanfälligkeit. Insgesamt sind Emotionen sinnvolle, unserem seelischen Gleichgewicht und unserer Gesundheit dienliche Phänomene (vgl. Hülshoff 2012: 271 ff.).
Es ist deutlich geworden, dass es sich bei psychischen Erkrankungen um ein komplexes Gesehen handelt, welches neben körperliche Faktoren auch emotionales Erleben und psychosoziale Interaktionen berücksichtigen muss.
3.2 Depressionen
Beschäftigt man sich mit dem Einfluss von Sport und Bewegung auf depressiv erkrankte Menschen, so ist die Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher Literatur zum Thema Depression sicherlich notwendig. Sport- und Bewegungstherapien und ähnliches als Konzepte der Depressionsbehandlung sollten auf den Grundlagen der Entstehung, der Symptome, der Diagnostik und der Therapie etc. einer Depression aufbauen (vgl. Huber 1989: 10 f.).
3.2.1 Definition
„So sinnvoll die Trauer ist: Wie andere Gefühle auch kann sie umschlagen in ein Extrem, in die Depression“ (Hülshoff 2011: 307). Depression bedeutet ursprünglich Bedrückung oder bedrückte Stimmung. Viele Menschen kennen depressive Symptome, wie Traurigkeit, Antrieblosigkeit und Rückzugstendenzen bei Verlusten, Erkrankungen oder sozialen Stresssituationen. Zunächst hat das Erscheinungsbild einer Depression äußere Ähnlichkeit mit einer normalen Trauerreaktion (vgl. Stemmer-Lück 2009: 104). Jedoch unterscheiden diese sich wesentlich voneinander. Bei depressiven Menschen färbt diese dauerhafte Stimmungslage all ihre Interaktionen mit der Welt und stört ihr übliches Erleben und Verhalten (vgl. Comer 2008: 214). Charakteristisch für die Depression ist nach Hülshoff (ebd.), dass sie wesentlich länger andauert als die Trauerreaktion, oft einbruchsartig ist, in Ausprägung und Stärke manchmal unerklärlich und oft in keinem Verhältnis zu einem eventuellen Auslöser steht. Eine Depression ist insbesondere durch den starren Affekt, dies meint die Unfähigkeit auch andere Gefühle, wie Liebe, Interesse oder Wut wahrzunehmen, geprägt. Normalerweise reagieren Menschen in Trauerphasen emotional angepasst auf andere Eindrücke. Dennoch können sie gelegentlich lachen oder Aggressionen empfinden. Im Gegensatz dazu tritt bei schweren Depressionen das starre Verharren in der Niedergeschlagenheit auf. Es kann sogar dazu kommen, dass nicht einmal die Trauer erlebt werden kann, sondern eine tiefe Leere und Gefühllosigkeit entsteht (vgl. ebd.).
Weiterhin äußern sich Depressionen auf vegetativ-körperlicher Ebene, in Antrieb und Verhalten, im Fühlen und im Denken (vgl. Hülshoff ebd.). Depressive Patienten sind durch Erschöpfung und Energielosigkeit geprägt. Sie sind müde, leiden unter Einschlaf- oder Durchschlafstörungen, kommen nicht aus dem Bett und haben häufig eine Tagesschwankung ihrer Depression. Zudem zeigen sie eine Verschiebung der „zirkadianen Rhythmen“, auch als biologische Uhren (z.B. innerer Schlaf-Wach-Rhythmus) bekannt.
Ditfurth (zit. in ebd.: 307 f.) benennt einen engen Zusammenhang zwischen Niedergeschlagenheit und Zeitempfinden. Normalerweise können Menschen ihre alltäglichen Verfehlungen im sozialen Kontakt ertragen, sodass sie in Zukunft etwas ändern können. Nicht so bei Verlusterlebnissen, denn exemplarisch ist der Abschied von einem verstorbenen Menschen endgültig und Ungesagtes bleibt ungesagt. Bei Depressionen kann es zu einer Verschiebung der inneren Werdenszeiten, einem subjektiv erlebten Stillstehen der Zeit, kommen. Erlebte Hoffnungslosigkeit tritt auf, der Deprimierten ist nicht davon zu überzeugen, dass es für ihn noch eine Chance oder einen Neubeginn in der Zukunft gibt.
Nach Hülshoff (2011: 308) treten somatische Störungen, wie Schwindelgefühle, Schmerzen, Appetitlosigkeit, Gewichtsveränderungen und Druck auf der Brust auf. Ergänzend zeigt sich die Antriebslosigkeit in Form von Schwierigkeiten beim Verrichten von leichter Arbeit, Konzentrationsproblemen, Interessenverlusten, Aufschieben von Aufgaben, hektischer Betriebsamkeit, sowie Entscheidungsschwierigkeiten. Mitunter isolieren sich die Betroffenen und die Aufrechterhaltung ihrer sozialen Kontakte fällt ihnen schwer. Metaphorisch sind sie hinter einer Glaswand, vor der sie ihr soziales Leben und Freude anderer Menschen sehen, aber nicht dazu gehören. Weinen, Trauermimik oder Seufzen sind mögliche Begleiterscheinungen. Mehr zu den Symptomen ist im Kapitel 3.2.5 zu lesen.
Des Weiteren erwähnt Hülshoff (ebd.) den grammatikalischen Suffix „-los“ auf der psychischen Ebene einer Depression: man fühlt sich antriebslos, hoffnungslos, ziellos, kraftlos, lustlos, nutzlos, wertlos und ähnliches. Statt Lebensfreude zeigt sich eine tiefe Traurigkeit und es kann zur inneren Unruhe, unerklärlichen Angstzuständen oder Gereiztheit kommen. Gedanken über vermeintliches Versagen, über die Hoffnungs- und Sinnlosigkeit in ihrem Leben treten immer wieder auf. In der schwersten Form der Depression können sich diese Gedanken wahnhaft verdichten. Man ist der Überzeugung schwerste Schuld auf sich geladen zu haben, unheilbar krank zu sein oder vor dem finanziellen Untergang zu stehen. Sogar die menschlichen Grundbedürfnisse nach Gesundheit, sozialer Integrität und sozialer Sicherheit werden als hoffnungslos gesehen. Folglich entstehen oft suizidale Gedanken (vgl. ebd.).
3.2.2 Epidemiologie und gesellschaftliche Begünstigungsfaktoren
Laut Hautzinger und Wolf (2012: 165) wachsen die Depressionen in den letzten Jahrzenten deutlich und erfassen immer jüngere Altersgruppen. Diese sogenannte „Volkskrankheit“ zählt zu den Krankheiten, welche die meisten gesunden und unbeeinträchtigten Lebensjahre rauben. Bereits im Jahre 1985 wurden Beiträge wie „Depressionen, die Pest des 20. Jahrhunderts“ oder „Leiden der Zeit: Depression“ in der Stuttgarter Zeitung veröffentlicht (zit. in Huber 1990: 11). Rund 20% aller Menschen erleiden mindestens einmal in ihrem Leben eine behandlungsdürftige Depression (vgl. Hülshoff 2011: 308 f.). Im Folgenden erläutere ich hierfür mögliche Begünstigungsfaktoren nach Huber (1990: 12 ff.), der trotz der alten Auflage des Buches vieles äußerst präzise darstellt, was auch noch heute so zutrifft:
Ärzte zeigen erhöhte Bereitschaft, psychiatrische Erkrankungen zu diagnostizieren und zu behandeln
Patienten zeigen erhöhtes Krankheitsbewusstsein und sind eher bereit Hilfe zu suchen
Gesellschaftliche Erweiterung des Krankheitsbegriffes und Erniedrigung der Schwelle zwischen gesund und krank
Erhöhte Lebenserwartung, Altersstruktur, erhöhter Anteil von Risikogruppen und somit erhöhte Wahrscheinlichkeit, psychisch krank zu werden
Wandel der Arbeitswelt, Umweltbedingungen und Familienstruktur, sowie Erhöhung der Risikofaktoren (z.B. Arbeitslosigkeit, Leistungsdruck, Zerfall der Großfamilie)
Darüber hinaus betont der gleiche Autor (vgl. ebd.: 14), dass sich viele depressive Erkrankungen hinter einer Maske von somatischen Dysfunktionen verstecken und solchermaßen „larvierte Depressionen“ sehr schwierig zu diagnostizieren sind. Auch ist die grundlegende Frage nach der Grenze zwischen normaler Trauer und dem Krankheitsbild der Depression unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen, politischen und sozialen Rahmenbedingungen schwer zu beantworten (vgl. ebd.: 16). Weiterhin heißt es, dass depressive Syndrome in anderen Kulturen vorkommen, sich diese jedoch im Umgang damit deutlich unterscheiden. Insgesamt wird deutlich, vor welchen Schwierigkeiten die epidemiologische Forschung steht, wenn es um die Erfassung genauer Daten geht (vgl. Pfeiffer/ Tellenbach/ Wulf zit. in ebd.).
3.2.3 Biologische Grundlagen
Gemäß Hülshoff (2011: 309) werden alle sinnlichen Wahrnehmungen vom Limbischen System, dem „Mischpult unserer Gefühle“ (ebd.), bewusst bearbeitet und emotional bewertet. Äußere Ereignisse oder innere Zustände werden gefühlsmäßig eingeordnet und führen zu vegetativen und hormonellen Reaktionen. Daraufhin werden diese vom Großhirn „erlebt“, indem sich körperliche Veränderungen als gefühltes Erleben widerspiegeln.
Nachfolgend wird auf die körperliche, psychische und soziale Ebene eingegangen (vgl. ebd.). Auf der körperlichen Ebene lässt sich Trauer durch den Verlust von Energie und Vitalität beschreiben: in Form von gebückter Haltung, Hemmung vieler Aktivitäten, Appetitlosigkeit, Interessensverlust an Sexualität, Spiel und Zerstreuung sowie der Unfähigkeit seine Energie auf ein Ziel zu bündeln. Ebenfalls kann eine längere Trauerreaktion zu Schlafstörungen führen, wodurch man sehr erschöpft und müde ist, und es kommt zu einem mimischen Ausdruck von Trauer, welcher vom limbischen System gesteuert wird. Psychisch gesehen fühlen wir uns einsam, ohnmächtig, ungeliebt und wertlos. Auf der sozialen Ebene bereiten uns Alltagsaufgaben und Kontakte zu anderen große Mühen. Das Interesse am sozialen Austausch nimmt ab, man zieht sich zurück, zeigt sich verletzlich und hilflos sowie manchmal abhängiger von anderen Menschen.
Es stellt sich die Frage nach dem Sinn der Trauer. Der Körper ist erschöpft und benötigt Erholung und Ruhe, in der seine Kräfte sich regenerieren können. Auch in psychischer Hinsicht ist es wichtig, nach einem Verlust innezuhalten, diesen zu verarbeiten und zu trauern (vgl. Hülshoff 2011: 309 f.). Ebenfalls handelt es sich bei Trauer um ein Bindungsemotion: „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ (vgl. ebd.: 310).
Das gemeinsame Trauern oder der Beistand bei Verlusten erweist sich als hilfreich und wohltuend für den Trauernden und zugleich stärkt es das Gemeinschaftsgefühl aller Beteiligten. Aufgrund der Spiegelneuronen sind wir Menschen empathiefähig und können gefühlsmäßig „mitschwingen“ (ebd.), wenn wir bestimmte Prozesse bei unserem Gegenüber erleben.
3.2.4 Ursachen und Auslöser
Ebenso manifestieren sich die multifaktoriellen Ursachen einer Depression auf körperlicher, seelischer und sozialer Ebene. Hülshoff (2011: 311 f.) sieht in der Ursache für Depressionen einen Mangel an Neurotransmittern, insbesondere Serotonin. Diese sorgen im synaptischen Spalt für die Erregung von einer zur anderen Nervenzelle. Auch sorgen sie im Limbischen System für den Erregungs- und Wachheitszustand, die Konzentrationsfähigkeit, Lernprozesse, subjektiv erlebte Vitalität, Interesse und das Erleben von Emotionen. Zudem sind die Rezeptoren der Nervenzellen in Struktur und Funktion verändert. Darüber hinaus kann Lichtmangel zu einer Veränderung zirkadianer Rhythmen (vgl. Kapitel 3.2.1) und daraufhin zur Irritation des Neurotransmitterhaushaltes führen. Auch Dysstress (negativer Stress) und körperliche Erschöpfung führen zu Veränderungen von Hormonen und vom Neurotransmitterhaushalt.
Inzwischen sind genetische Faktoren vermehrt wissenschaftlich untersucht worden (vgl. Hülshoff ebd.). Zu 50-60% erkrankt ein eineiiger Zwilling mit derselben Wahrscheinlichkeit an einer Depression wie sein Geschwisterkind. Wobei nicht die Depression, sondern eher eine gewisse Verletzlichkeit vererbt wird. Denn das Reagieren auf Verlusterlebnisse, insbesondere die Reaktion des Neurotransmitterhaushaltes, ist bei allen Menschen vererbt (z.B. Empathiefähigkeit und Empfindsamkeit). Man spricht hier von einer „genetischen Vulnerabilität“. Wobei diese erst in Kombination mit psychosozialen Faktoren zu einem Auftreten der Depression führen kann (vgl. Wittchen u.a. 2010: 15). Folgende Abbildung zeigt das „Vulnerabilitäts-Stressmodell“, indem drei skizzierte Personen der gleichen Stressintensität ausgesetzt sind, aber eine unterschiedliche Vulnerabilität haben. Bei der rechten Person kommt es schon bei geringen Stresserlebnissen zu einer Depression.
(Pitschel-Walz 2003: 21)
Des Weiteren zählen nach Hülshoff (2011: 313) biografische Einflüsse, wie Vernachlässigung, Verlusterlebnisse, Fehlen von Geborgenheit, Halt, emotionaler Zuwendung und sozialer Strukturen (z.B. Flucht) in prägenden Kindheitsphasen zu den Risikofaktoren. Diese können eine schon bestehende Verletzlichkeit verstärken und den Menschen möglicherweise für Depressionen anfälliger werden lassen. Ebenfalls berichten viele depressive Patienten über eine einengende Überbehütung bei gleichzeitiger geringer elterlicher Anteilnahme, dadurch ist eine adäquate Autonomieentwicklung und Individuation behindert (vgl. Will 2000: 77). Zudem können belastende Lebensereignisse, wie Arbeitslosigkeit oder Verlusterlebnisse (materieller Güter, eines geliebten Menschen, der körperlichen Integrität, des Arbeitsplatzes, der Heimat, von Hoffnungen und Zukunftsplänen) und Erschöpfung eine Depression auslösen (vgl. Hülshoff ebd). Laut Stemmer-Lück (2009: 107) zählen auch narzisstische Kränkungen dazu, d.h. den Verlust des gut funktionierenden Selbstsystems (Selbstwertgefühl, Selbstachtung).
Weiterhin erklärt Wittchen u.a. (2010: 16 f.) durch lerntheoretische und kognitive Modelle die Entstehung der Depression. Die Verstärker-Verlust-Theorie meint einen Mangel an positiver Verstärkung (Belohnung), dies vermindert das Wohlbefinden und ist mit negativem Affekt verbunden (z.B. führt der Verlust eines Partners (negativer Verstärker) zu sozialem Rückzug und negativen Emotionen). Nach der kognitiven Triade von Beck entstehen dysfunktionale Kognitionen. Deren Beziehungen zueinander führen zu pessimistischen Ansichten von sich selbst, der Umwelt und der Zukunft in Verbindung mit negativen Überzeugungen. Diese werden durch negative Lebenserfahrungen ausgelöst und sind mit kognitiven Verzerrungen verbunden. Nach Comer (2008: 229) zählen hierzu negatives Schlussfolgern aus widerlegendem Beweismaterial, Konzentration auf eine negative Einzelheit und Ignoranz des größeren Zusammenhangs, Übergeneralisierung aus einem einzigen bedeutungslosen Ereignis, Unterschätzung positiver Ereignisse und Übertreibung negativer Ereignisse.
Bei der „gelernten Hilflosigkeit“ (vgl. Wittchen u.a. ebd.) wird durch wiederholte Erfahrungen mangelnder Kontrolle über Situationen und unangenehmen Konsequenzen Passivität und das Gefühl sich selbst und sein Leben nicht steuern zu können gelernt. Negative Erfahrungen werden als unkontrollierbar und unveränderlich wahrgenommen und verallgemeinert. Wenn eine Situation nicht erfolgreich bewältigt wird, schreibt man den Misserfolg irgendeiner Ursache zu.
Depression entsteht demnach, wenn erwünschte Ziele als unerreichbar gelten, die Misserfolge zusätzlich der eigenen dauerhaften Unzugänglichkeit zugeschrieben werden und folglich das Selbstwertgefühl sinkt. Weiterhin kommt es zur Hoffnungslosigkeit, indem erstrebenswerte Ereignisse nicht bzw. unerwünschte Ereignisse eintreffen und keine Gelegenheit vorhanden ist, diesen Zustand zu ändern. Gemäß Robinson und Alloy (zit. in Comer 2008: 228) können nur durch den zusätzlichen Faktor der Hoffnungslosigkeit Depressionen mit größerer Präzision vorhergesagt werden.
Auch Persönlichkeitstypen, die sehr festgelegt, ordentlich, gewissenhaft und pflichtbewusst sind, sowie zwanghafte Züge besitzen, gelten als Risikogruppe. Weiterhin können Menschen, die bereits an Angststörungen oder anderen psychischen Störungen oder körperliche Beschwerden, wie Schilddrüsenüberfunktion, Herzinfarkt, Schlaganfall, AIDS, Parkinson und Alzheimer leiden, eher depressiv werden (vgl. Wittchen u.a. 2010: 17 f.).
Abschließend ist zu betonen, dass nicht jeder depressiv Strukturierte eine depressive Störung entwickeln muss. Es bedarf immer eines Auslösers (vgl. Stemmer-Lück ebd.). Hierfür sollte das gesamte Ursachenbündel, geprägt durch die individuelle körperliche und biografische Belastung berücksichtigt werden (vgl. Hülshoff 2011: 314).
[...]
1 Die Häufigkeit einer Krankheit in einer Bevölkerung innerhalb eines Jahres (vgl. DocCheckFlexion o.V. o.J.).
2 Fachmann auf dem Gebiet der Motologie: Lehre von der menschlichen Motorik und deren Anwendung in Erziehung und Therapie (vgl. Duden o.V. 2013).
3 Eine Variante von Leitfadeninterviews. Aufgrund des informationsorientierten Sinnverstehens und Forschungsinteresses hat der Leitfaden meistens eine starke steuernde und strukturierende Funktion hat. Es werden sehr konkrete Fragen hinsichtlich eines spezifischen Themas gestellt, um die Einschätzungen und Beurteilungen von dem befragten Experten einzuholen (vgl. Kruse 2014: 169).
4 Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen (vgl. Duden o.V. 2013)
5 Etwas was fehlt, was nötig gebracht wird (vgl. DocCheck Flexion o.V. o.J.)
6 Titel: Sport und Soziale Arbeit - Ein Modellprojekt der Evangelischen Fachhochschule Freiburg, der Südbadischen Sportschule Steinbach und der Badischen Sportjugend Freiburg