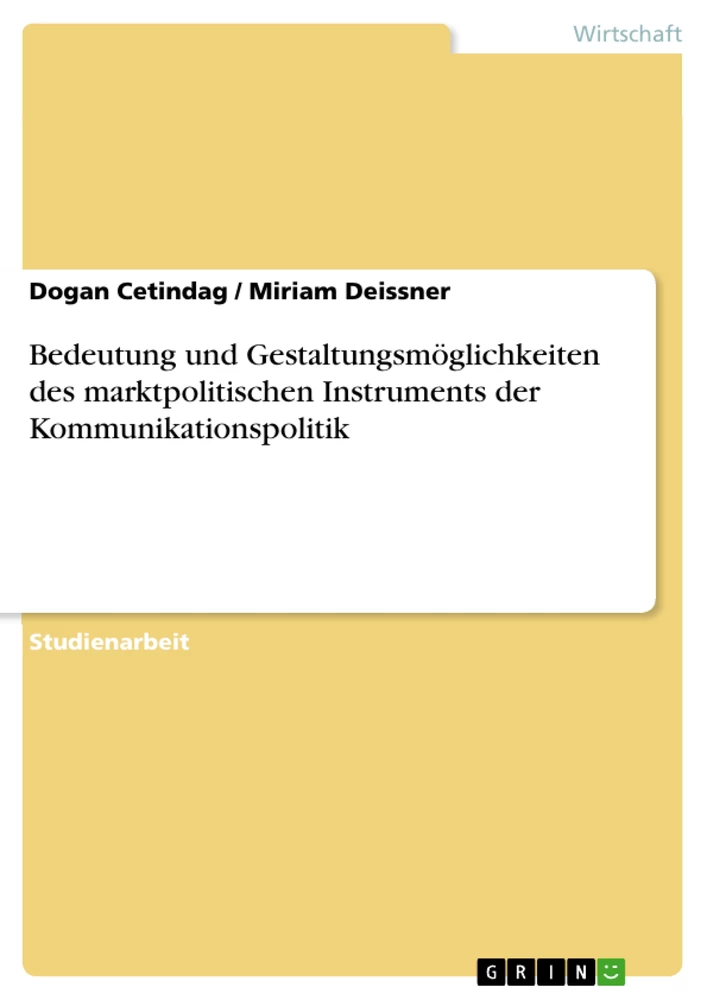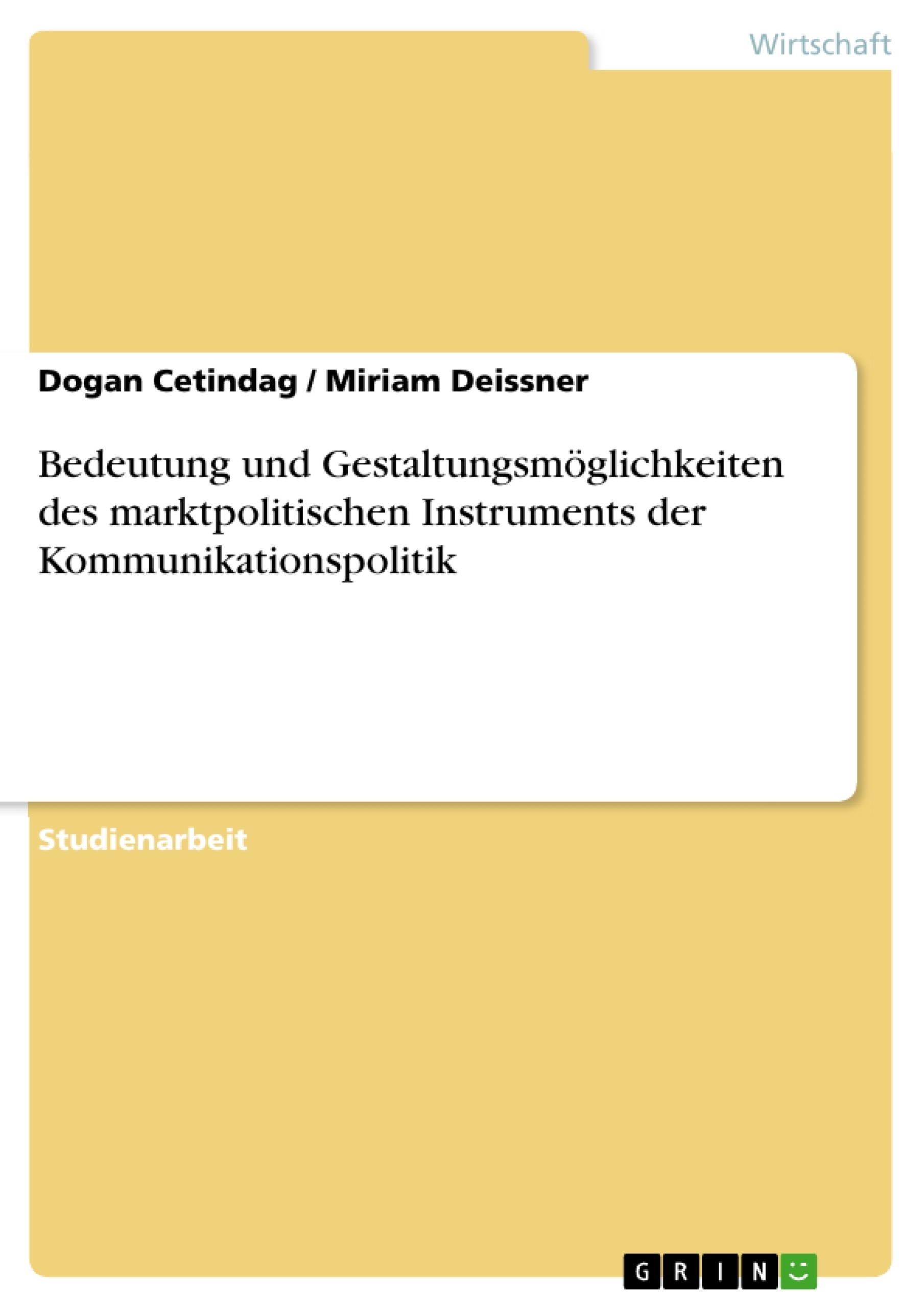Das Ziel dieser Arbeit ist eine Einführung in die Kommunikationspolitik und skizziert die zunehmende Bedeutung dieses Bereiches. Auch der damit zusammenhängende Begriff kommunikationspolitische Instrumente wird definiert und eine Einleitung der Maßnahmen erfolgt. Außerdem werden die Anforderungen an die moderne Kommunikationspolitik dargestellt.
Die vorliegende Arbeit wird sich auch auf neue Kommunikationsinstrumente, speziell dem Weblog, konzentrieren. Hierfür werden die verschiedenen Eigenschaften und Arten von Weblogs, deren Möglichkeiten und die mit ihnen verbundenen Chancen und Risiken veranschaulicht. Außerdem soll anhand eines Praxisbeispiels verdeutlicht werden, wie Blogs ein nützliches Werkzeug sein können um Unternehmensziele zu erreichen. Abschließend wird ein Fazit in Form einer Zusammenfassung gezogen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis/ Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Gegenstandsbereich der Kommunikationspolitik
2.1 Begriffliche Grundlagen der Kommunikationspolitik
2.2 Kommunikationsinstrument: Direkt -Marketing
2.3 Kommunikationsinstrument: Multimediakommunikation
2.4 Anforderungen an die moderne Kommunikationspolitik
3. Gestaltungsmöglichkeiten der Kommunikationspolitik im 13 WWW: Web 2
3.1 Web 2.0: Abgrenzung und Grundlagen
3.2 Das Weblog: Definition und Funktion
3.3 Informationsanbieter: Das Weblog als Kommunikationsinstrument
3.4 Einsatzbereiche von Weblogs
3.5 Ziele von Weblogs
3.6 Motive der Blogleser
3.7 Zielgruppen
3.8 Chancen und Risiken des Einsatzes von Weblogs
3.8.1 Chancen von Weblogs
3.8.2 Risiken von Weblogs
3.9 Erfolgsfaktoren von Weblogs
4. Praxisbeispiel
4.1 Daimler- Blog: Überblick und Einordnung
4.2 Daimler- Blog: Gründe zum Start und Ziele des Webblogs
4.3 Daimler- Blog: Erfahrungen
5. Fazit
Literaturverzeichnis/ Normverzeichnis/
Internetverzeichnis