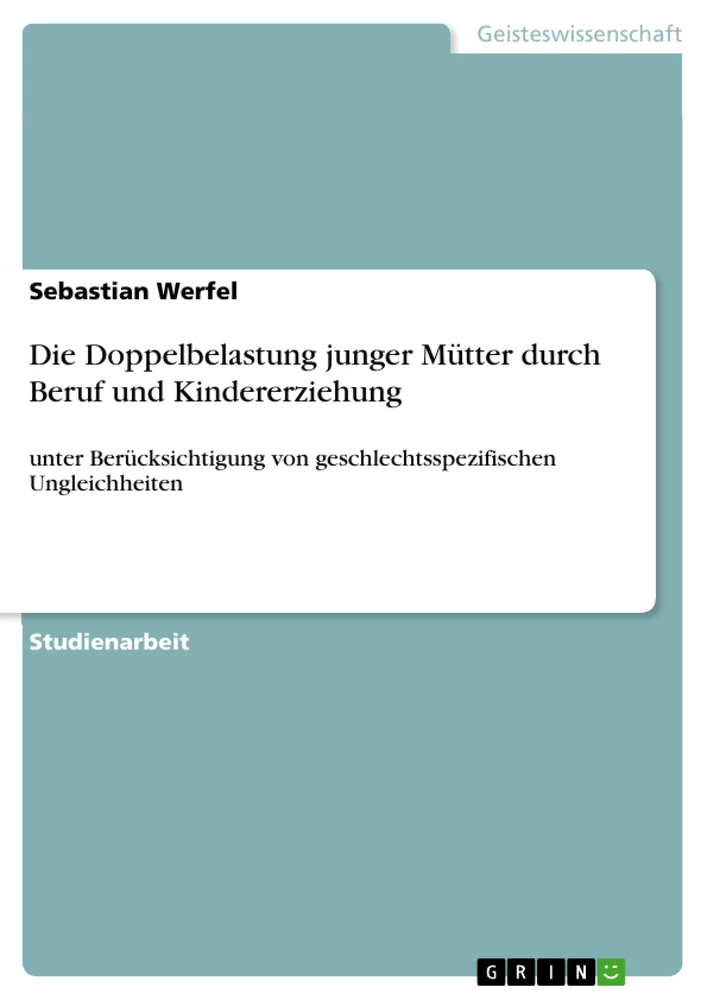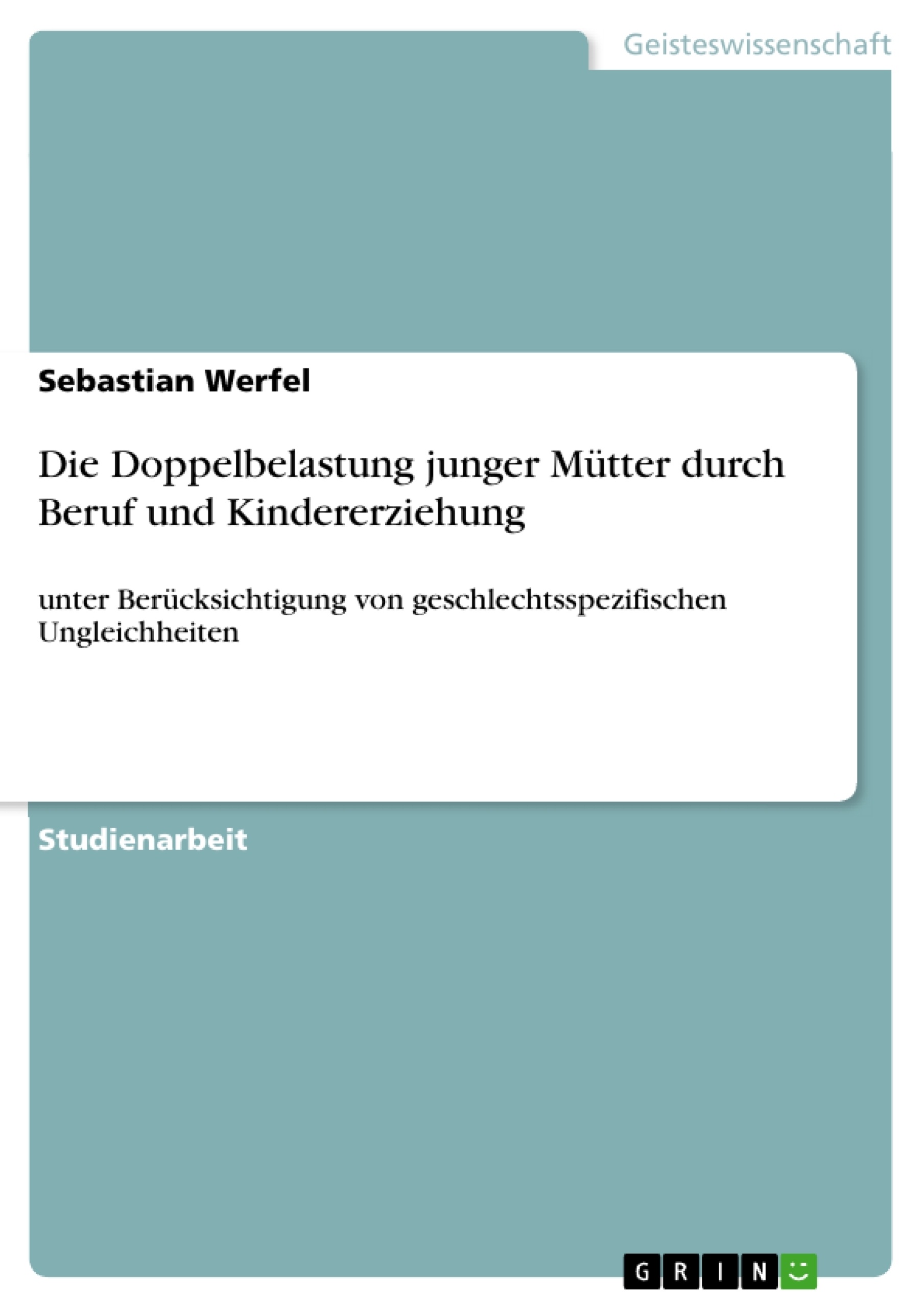In Deutschland hat sich wie in vielen modernen Staaten in den letzten Jahrzehnten ein grundsätzlicher Wandel in der Sozialstruktur vollzogen.
Es prägten sich eine Leistungs- und Wohlstandsgesellschaft, eine industrielle Dienstleistungsgesellschaft und eine Bildungsgesellschaft heraus, in denen das private Leben eng verbunden mit dem Arbeitsleben ist. Wie genau sich dieser sozialstrukturelle Wandel unter Berücksichtigung der noch immer vorherrschenden geschlechtsspezifischen Ungleichheiten vollzogen hat, möchte ich in der nachfolgenden Hausarbeit erörtern.
Denn erst wenn die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten erkannt und bewusst wahrgenommen werden, erst dann ist es möglich ein Gefühl für die Doppelbelastung junger Frauen durch Beruf und Kindererziehung zu bekommen. Das Ziel sollte in diesem Zusammenhang sein, die jungen Mütter als eine Gruppe zu erkennen, welche die Bewältigung ihrer beruflichen Tätigkeit in Kombination mit gleichzeitiger Kindererziehung nur mit einem Spagat meistern kann und dadurch die Respektierung und Unterstützung von Menschen nicht nur verdient, sondern auch brauch.
Es gilt hierbei die hochindustrialisierte Gesellschaft, in welcher wir leben, bewusst auf ihre Kinderfreundlichkeit zu prüfen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Geschlechtsspezifische Ungleichheit
2.1 In der Bildung und der Ausbildung
2.2 In der Arbeitswelt
2.3 In der Politik
2.4 In der Familie
3 Bewältigung der Kindererziehung
3.1 Der Wandel der Rollenverteilungen
3.2 Veränderungen im Erziehungsstil
4 Die gestiegene Erwerbstätigkeit junger Mütter
5 Vereinbarkeit von Familie und Beruf
5.1 Arbeitsteilung in den Familien heute
5.2 Die Balance im Blickpunkt der zeitlichen Organisation
6 Kritische Würdigung
Literaturverzeichnis
Tabellenverzeichnis