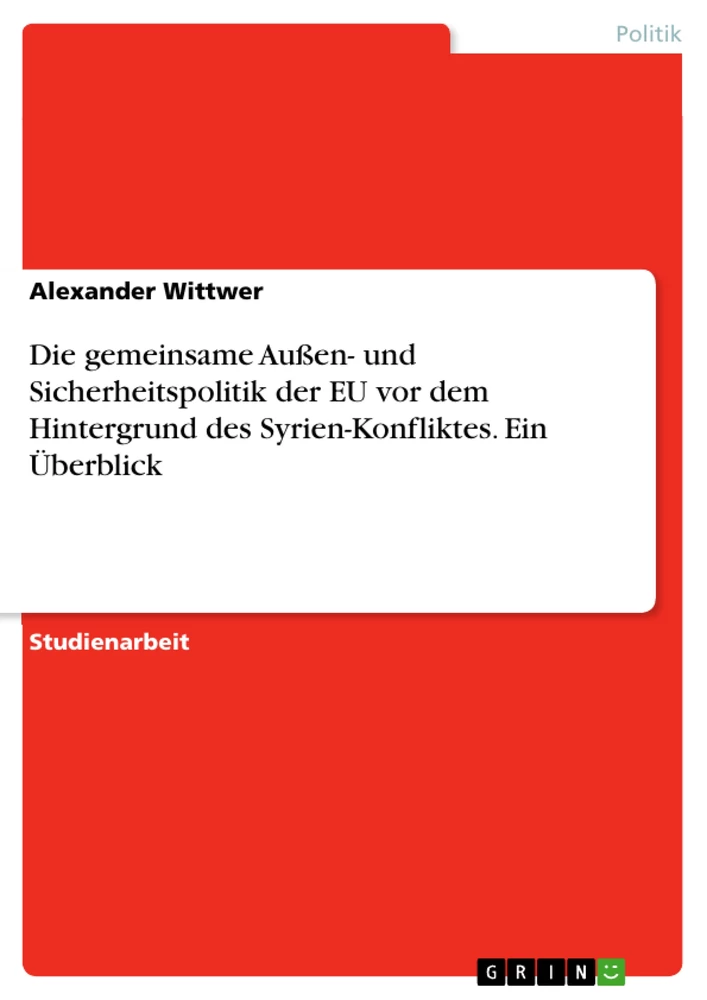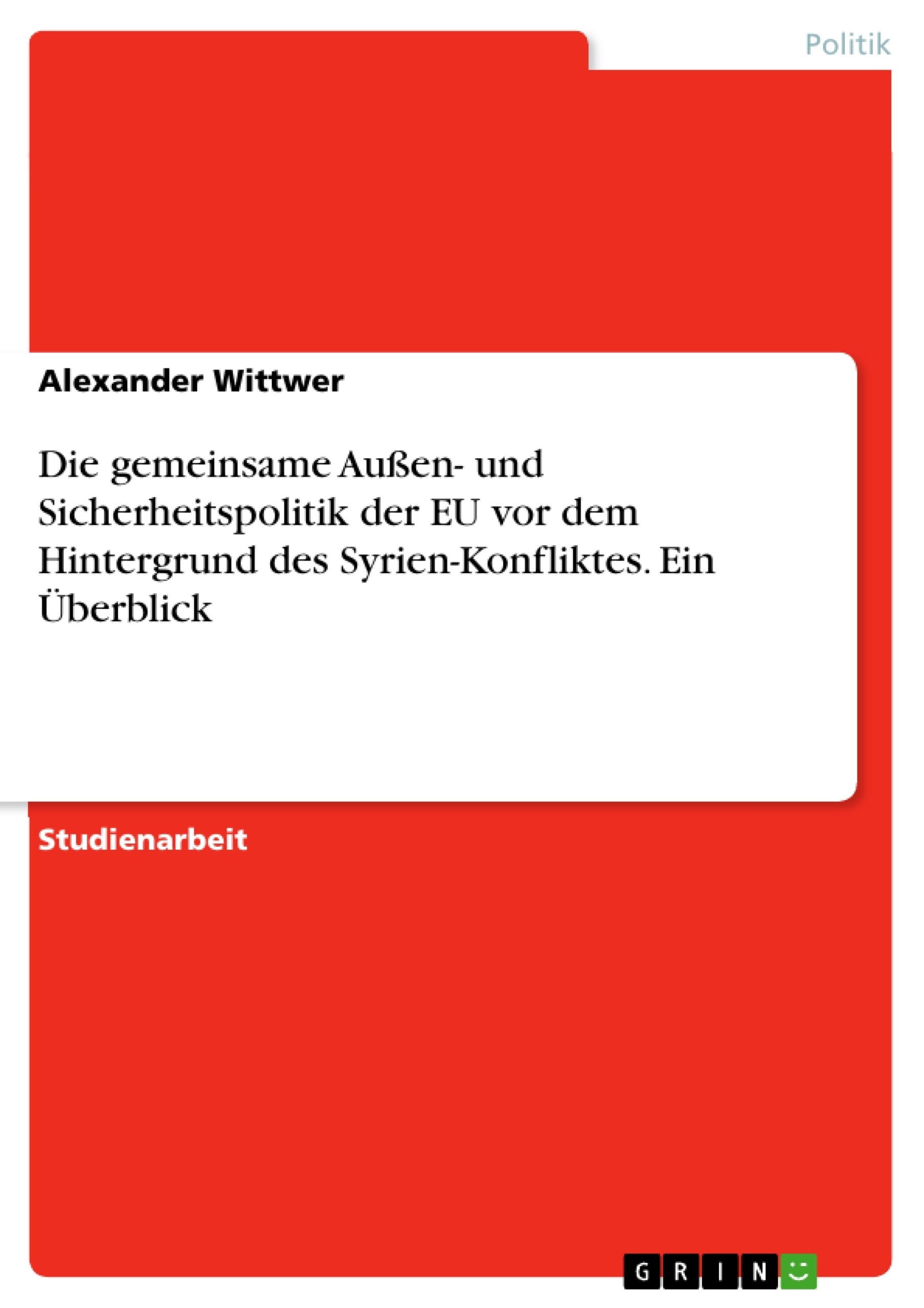Seit März 2011 überschattet der Bürgerkrieg in Syrien das internationale Geschehen. Ausgelöst durch den Arabischen Frühling in Tunesien, Ägypten, Libyen, und anderen arabischen Ländern, kam es auch in Syrien zu Aufständen gegen die Regierung und den syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad. Bis zum heutigen Tag sind mehr als 24.500 Menschen, darunter unzählige Zivilisten, ums Leben gekommen. Neben den Vereinten Nationen, der Arabischen Liga, der USA und zahlreichen Nichtregierungsorganisationen hat auch die Europäische Union im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik einen Aktionsplan erarbeitet, um den Bürgerkrieg in Syrien zu beenden.
Im Laufe der Jahrzehnte hat sie die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU ständig weiterentwickelt und ist zu einem der wichtigsten internationalen Akteure geworden. War die GASP im Kalten Krieg noch Schattenspieler der NATO, bekam sie - nicht zuletzt durch die Ohnmacht in den Kriegen im Kosovo und in Bosnien – durch eine Vielzahl von Vertragswerken eine neue Struktur. Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik wird dabei immer wichtiger im Hinblick auf zivile Missionen. Doch ist die Europäische Union nach dem Vertag von Lissabon wirklich handlungsfähig genug um internationale Konflikte wie den Syrischen Bürgerkrieg zu lösen oder benötigt sie einen größeren Maßnahmenkatalog? Und ist die Europäische Union überhaupt in der Lage in angemessener Zeit Maßnahmen zu ergreifen, oder wird sie durch die Vielzahl von institutionellen Akteuren innerhalb der EU in ihrer Entscheidungsfindung gehindert?
Gliederung
1 Der Syrienkonflikt als neuer Krisenherd der Welt
2 Entwicklung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik nach 1945
2.1 Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) & Europäische Politische Gemeinschaft (EPG)
2.2 Westeuropäische Union (WEU)
2.3 Fouchet-Pläne
2.4 Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ)
2.5 Einheitliche Europäische Akte (EEA)
3 Entwicklung zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) nach 1991
3.1 Vertrag von Maastricht
3.2 Vertrag von Amsterdam
3.3 Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik / Vertrag von Nizza
4 Die außenpolitischen Akteure der EU nach dem Vertrag von Lissabon
4.1 Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP)
4.2 Der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik
4.3 Europäischer Auswärtiger Dienst (EAD)
4.4 Präsident des Europäischen Rates
4.5 Europäischer Rat
4.6 Rat der Europäischen Union (Ministerrat)
4.7 Europäische Kommission
4.8 Europäisches Parlament
4.9 Weitere Außenpolitische Akteure
5 Handlungsspektrum der EU im Bereich GASP
5.1 Diplomatische Instrumente
5.2 Rechtliche Instrumente
5.3 Präferenz- und Anreizinstrumente
5.4 Restriktive Maßnahmen (Sanktionen)
5.5 Zivile und militärische Maßnahmen
6 Das Europäische Handeln im Syrien-Konflikt
7 Fazit
8 Literaturverzeichnis