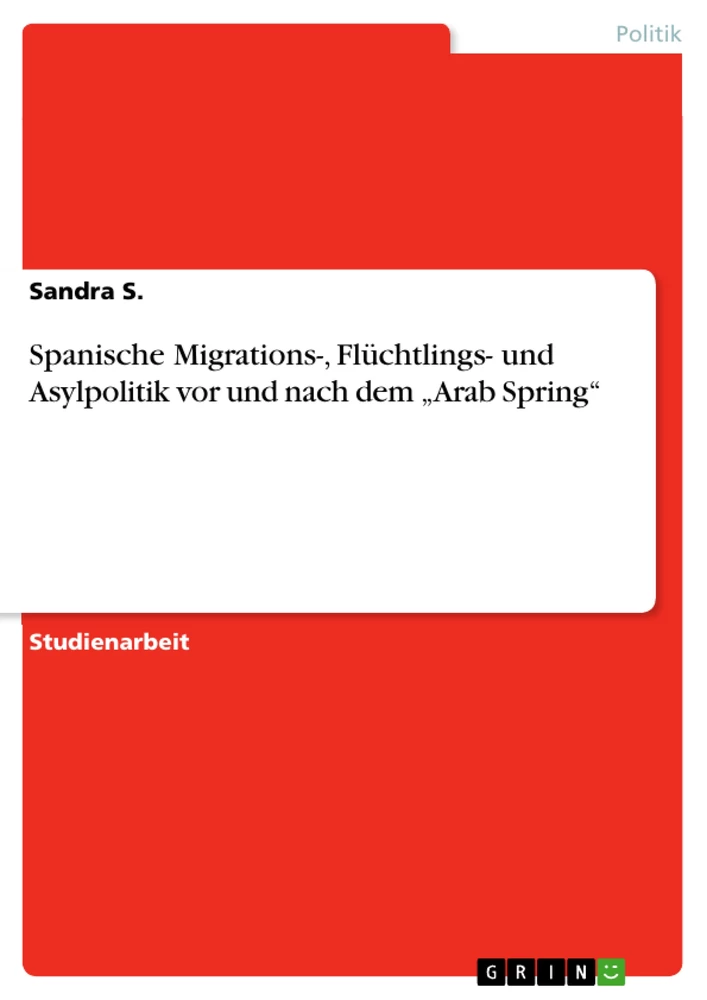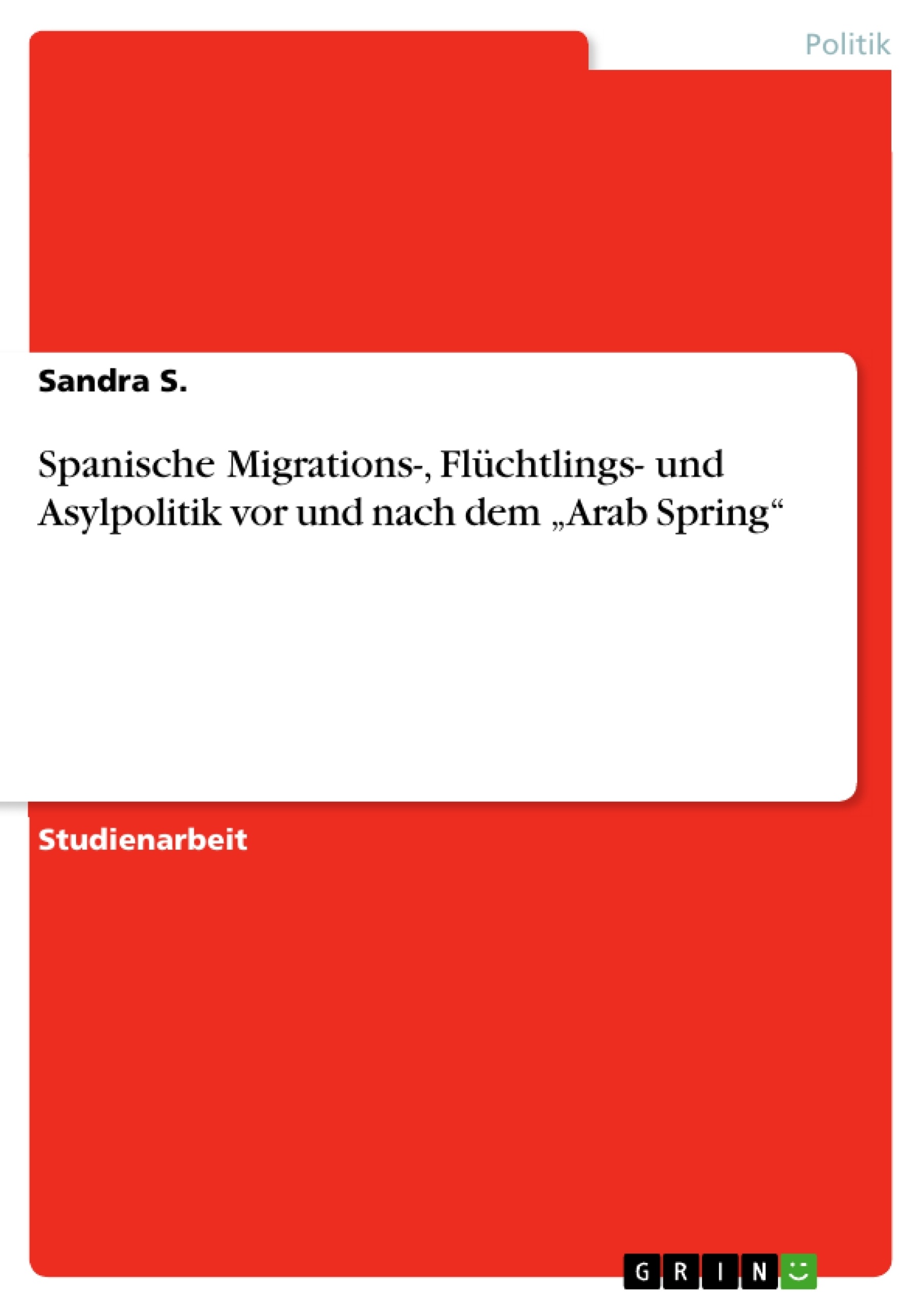Jährlich wandern mehrere tausend Menschen aus Drittländern nach Spanien ein. Sie kommen in kleinen Booten, durchschwimmen die Gewässer zwischen Nordafrika und den Exklaven Ceuta und Melilla oder schließen sich sogenannten „Schlepperbanden“ an. Andere nehmen den offiziellen Weg über spanische Behörden. Sie fliehen vor Menschenrechtsverletzungen in ihren Heimatländern, vor politischer Verfolgung oder Armut. Die Immigranten hoffen auf mehr Gerechtigkeit, eine bessere wirtschaftliche Lage oder sehen in der iberischen Halbinsel schlicht das Tor nach Europa.
Doch wie hat sich die Migration überhaupt entwickelt? Warum ist das einstige Auswanderungsland zu einem der beliebtesten Einwanderungsländer Europas geworden? Wie ist die Gesetzeslage für Flüchtlinge oder Asylbewerber und wie hat sie sich durch die verschiedenen Legislaturperioden hindurch verändert? Wie hat sich der Arabische Frühling auf die Flüchtlingsströme ausgewirkt? Bestätigt sich die in Europa publizierte Meinung, die südeuropäischen Staaten hätten immense Flüchtlingswellen zu bewältigen in statistischen Zahlen? Oder ist es vielmehr ein Irrbild, dass Medien und Politik verbreiten?
Diese Fragen sollen im Folgenden anhand von statistischen Auswertungen, Medienberichten und Regierungserklärungen beantwortet werden. Zusätzlich wird Sekundärliteratur, vornehmlich der letzten zehn Jahre, hinzugezogen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Spanische Migrations-, Flüchtlings- und Asylpolitik im Überblick
2.1 Geschichte: Vom Auswanderungs- zum Einwanderungsland
2.2 Politische Entwicklungen bis 2011
3 Exklaven, Meerengen und Inseln als Tore nach Europa
3.1 Die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla
3.2 Die Straße von Gibraltar
3.3 Die Kanaren
4 Entwicklungen nach dem Arabischen Frühling
4.1 Statistiken
4.2 Reaktionen in der spanischen Öffentlichkeit
4.3 Maßnahmen der spanischen Politik
5 Fazit
6 Literaturverzeichnis
6.1 Quellen:
6.2 Sekundärliteratur: