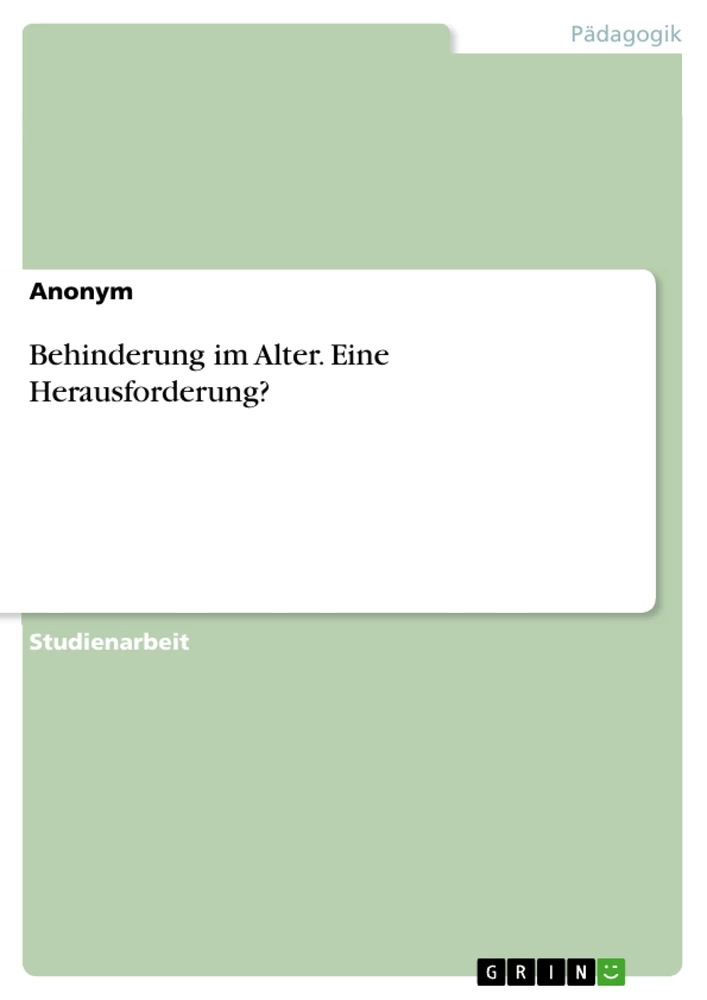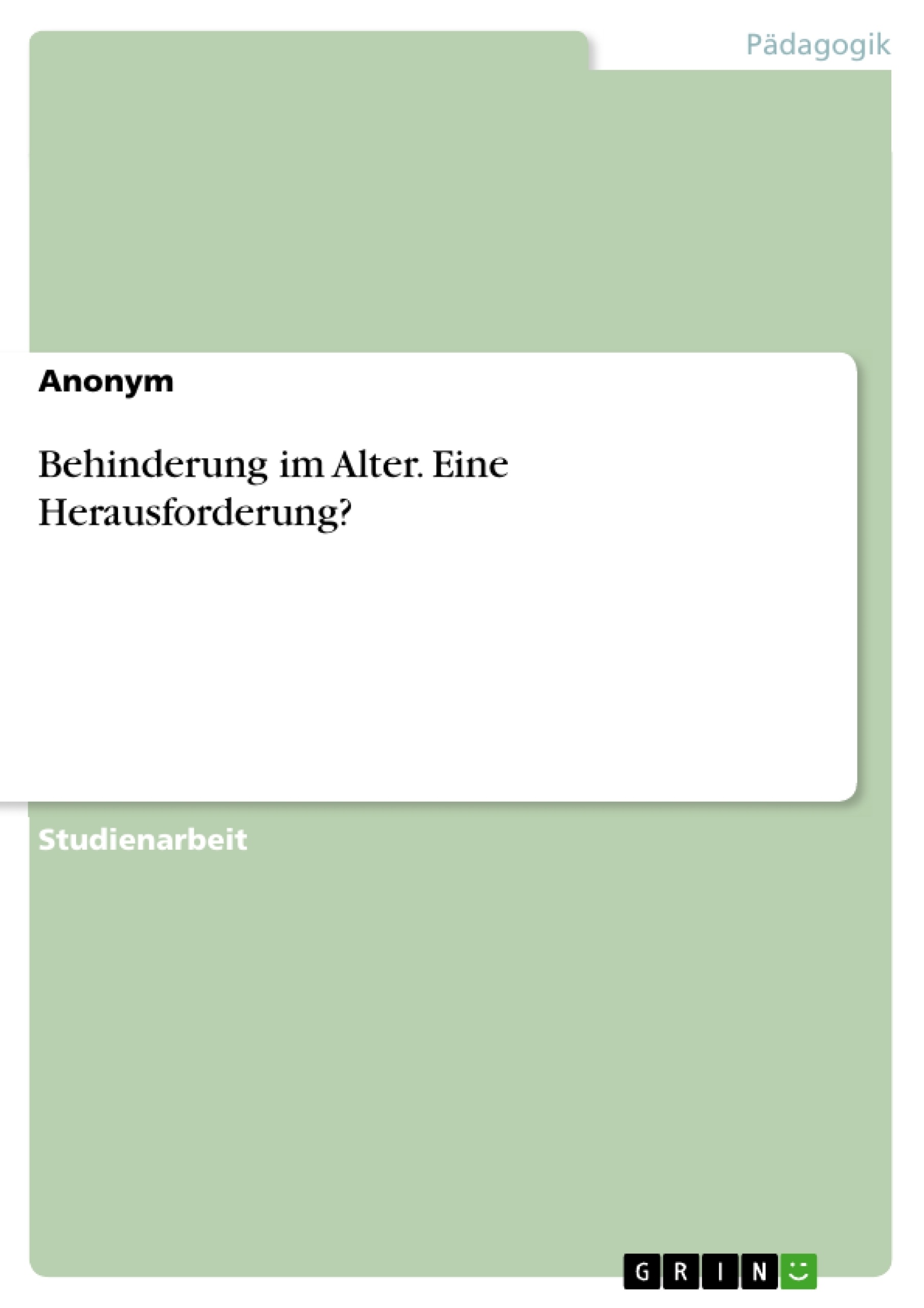Zu Beginn möchte ich etwas über meine eigenen Erfahrungen zum Thema Behinderung alter Menschen erzählen. Alles begann im Jahr 2006, als ich mein Freiwilliges Soziales Jahr im Altenheim antrat. Ich hatte mir keinerlei Gedanken gemacht was auf mich zukommen würde. Ich wurde sozusagen „ins kalte Wasser“ geschmissen was den Umgang mit pflegebedürftigen Menschen betraf. Ich musste mich niemals zuvor mit Leid, Behinderung oder gar dem Tod auseinander setzen (Buchka, 2003, S.14, siehe Anhang Bild Nr.1). Ich lernte schnell mich mit einigen Schicksalen abzufinden, Trauer zu bewältigen, mit dem alten Menschen den Tag zu verbringen und sie in ihrem Alltag zu unterstützen. Dies war zum Beispiel Hilfe bei der Nahrungsaufnahme, beim Waschen, Anziehen, usw. Aber eine alte Dame beschäftigte mich das ganze Jahr über. Sie war Demenzkrank. Nicht nur das sie Dinge wie Haare kämmen oder Zähne putzen nicht durchführen konnte, nicht weil sie es körperlich nicht konnte, sondern weil sie einfach vergessen hatte wie es geht, nein, auch dass sie mich jeden Tag aufs Neue hin kennen lernen musste, dass sie ihre Umgebung niemals wiedererkannte, dass sie viele Dinge aus ihrer Vergangenheit einfach nicht mehr wusste, machte mir klar, diese Frau braucht intensive Unterstützung um mit ihrer Behinderung weiterhin glücklich zu sein. Aber wie konnten ich und das Pflegepersonal das schaffen? Wie sollte ich mit ihr umgehen ohne sie seelisch zu verletzen und ihr wirklich eine Hilfe zu sein?
In dieser Arbeit möchte ich zum Einen ein wenig aufklären über Behinderungen im Alter, sowie die Frage beantworten, wie wir alten Menschen helfen können einen angenehmen Lebensweg zu beschreiten. Denn auch sie verdienen jegliche Würde und Achtung wie junge und gesunde Menschen und ihnen steht in jeder Art und Weise all das zu, was auch uns zu steht.
Gliederung:
1. Einleitung
2. Bedeutung Behinderung im Alter
3. Ausgewählte Krankheitsbilder.
3.1 Demenz und geistige Behinderung
3.2 Down- Syndrom im Alter
4. Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung
4.1 Ziele im Umgang mit alten Menschen mit Behinderung
4.2 Kommunikation
4.3 Freizeitgestaltung.
5. Fazit.